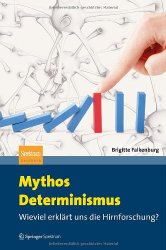19.11.2012
Vorbestimmungsglaube
Rezension von Boris Kotchoubey
Die Neurowissenschaft behauptet, der freie Wille sei nur eine Illusion. In „Mythos Determinismus. Wieviel erklärt uns die Hirnforschung?“ nimmt Brigitte Falkenburg die Glaubenssätze dieser aktuell so populären Ideologie auseinander.
Heutzutage kann man einen merkwürdigen Unterschied zwischen demokratischen Politikern (z.B. in Deutschland) und denen mit autoritärem Hang (z.B. in Russland) beobachten. Während die letzteren auf einer absoluten Alternativlosigkeit ihrer Person bestehen, behaupten die ersteren, dass lediglich ihre Politik keine Alternative haben kann. In anderen Worten sollte der Untertan eines autoritären Regimes verstehen, dass er sowieso nichts ändern kann, und dass auch keine Änderung nötig ist; dagegen soll der freie Bürger eines demokratischen Staates begreifen, dass er zwar die Namen „deren da oben“ jederzeit auswechseln kann, aber die politische Linie wird trotzdem die Gleiche bleiben.
Das ist aber einfacher gesagt als getan. Selbst die schwersten Diktaturen wie der Kommunismus oder der Nationalsozialismus konnten sich nicht allein auf ihren superstarken Gewaltapparat verlassen, sondern sie brauchten, um den Bürger zum Gehorsam zu bringen, eine Weltschau, eine allumfassende Theorie, die ihre Machtansprüche untermauerte. Umso mehr bedarf einer solchen theoretischen, ideologischen Konstruktion die moderne westliche Gesellschaft, in der die Regierenden über keinen mächtigen Apparat des Zwanges verfügen. Der Alternativlosigkeit der Politik muss deshalb eine Philosophie entsprechen, die dem Menschen keinen Freiraum für Entscheidungen lässt. Das ist die Philosophie des strikten Determinismus, die behauptet, dass der Lauf der Dinge, so wie er ist, der einzig mögliche ist; dass alles, was passiert, bestimmte Ursachen hat, so dass angesichts dieser Ursachen nichts anderes passieren könnte. Der Determinismus ist die Ideologie einer Welt, in der es kein Konjunktiv gibt; in der das Mögliche, das Tatsächliche und das Notwendige ein und dasselbe sind. Der Determinismus verkleidet sich gerne als ein naturwissenschaftliches Prinzip. Heutzutage werden in populärwissenschaftlichen Medien vor allem zwei Arten des Determinismus ausgespielt: Der genetische („alles, was mit uns geschieht, steht in unseren Genen geschrieben“) und der neurobiologische („unser Verhalten ist vollständig durch die Verschaltungen von Nervenzellen vorbestimmt“).
In ihrem Buch räumt Brigitte Falkenburg, Physikerin und Philosophin, mit dieser Ideologie auf. Sie zeigt, dass es weder in der Philosophie noch in der Physik einen einheitlichen, logisch konsistenten und widerspruchsfreien Begriff dessen, was „Ursache“, „Wirkung“, „Bestimmtheit“ usw. sein können, gibt. Noch schlimmer: Unterschiedliche Begriffe, die gleich überzeugend aussehen, sind miteinander unvereinbar. So sagen nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern auch ehrenwerte Philosophien (einschließlich so unterschiedlicher wie jene von Spinoza und Hume), dass jedem Ereignis eine oder mehrere Ursachen zeitlich vorangehen. In der Tat sehen wir täglich, dass z.B. ein Schlag auf einen davor ruhenden Ball diesen in Bewegung bringt und damit die Bewegung „verursacht“. Dieser Ursachenbegriff, engst mit den Vorstellungen über mechanische Kausalität verbunden, setzt offensichtlich eine absolute, irreversible Zeitachse voraus, auf der die Ursachen früher sein müssen als ihre Wirkungen.
Demgegenüber beschreibt die klassische Physik, auf welche die weniger fortgeschrittenen Lebenswissenschaften gerne als auf Muster der Kausalität verweisen, die Welt durch Systeme der Differentialgleichungen, die grundsätzlich reversibel sind, d.h. für die eine Zeitachse als Realität nicht existiert. Alle von diesen Gleichungen beschriebenen Prozesse können genauso gut in der anderen Richtung ablaufen; eine Antenne, die Radiowellen ausstrahlt, könnte genauso gut die Wellen aufsaugen, ohne gegen die physikalischen Gesetze um ein Jota zu verstoßen. Dies gilt nicht nur für Newton’sche Mechanik und Maxwell’sche Elektrodynamik, sondern auch für die Relativitätstheorie. (Bekannterweise behauptete Einstein, dass selbst in der Thermodynamik – trotz Boltzmann – alle Vorgänge zeitlich umkehrbar seien; es sei zwar höchst unwahrscheinlich, dass warmes Wasser in einem kalten Raum immer heißer wird und schließlich kocht, aber unwahrscheinlich bedeute nicht unmöglich, sondern lediglich, dass man auf ein solches Ereignis sehr, sehr lange warten muss!) (vgl. [1]). „In der Physik“, so die Autorin, „gibt es kein einziges Naturgesetz, das zugleich deterministisch und Zeit-asymmetrisch ist, so das nach ihm die Wirkung zwangsläufig auf die Ursache folgt“ (S.377, Kursiv im Original).
Ein Determinist, der ernst genommen werden will, muss deshalb wählen, welche Art Kausalität er eigentlich meint. Entweder wählt er die Vorbestimmung jedes Ereignisses durch die ihm vorangehenden Ursachenereignisse – dann hat seine Kausalität mit den Vorstellungen der Physik nichts zu tun. Oder meint er dagegen, dass sich alles in der Welt einschließlich unseres Verhaltens den strengen Naturgesetzen unterordnet – dann muss er den Zeitpfeil opfern und anerkennen, dass das menschliche Leben genauso auch in die andere Richtung verlaufen könnte, nämlich vom Tod bis zur Geburt. Die beiden Arten Verursachung zugleich zu haben ist so unmöglich, wie, nach dem englischen Spruch, „to have a cake and to eat it“. Auf diesen – aufgrund von physikalischen Gesetzen prinzipiell unlösbaren – Widerspruch wies Bertrand Russel bereits vor 100 Jahren hin.
Doch damit wären wir mit den Paradoxen der Kausalitätsbegriffe noch nicht am Ende. Der andere Widerspruch besteht darin, dass einerseits der strenge Determinismus behauptet, alles Geschehen ließe sich aus den Naturgesetzen und aus empirischen Tatsachen ableiten. Andererseits kann diese selbe Aussage („alles Geschehen lässt sich aus Naturgesetzen und Tatsachen ableiten“) aus keinen Naturgesetzen und empirischen Tatsachen abgeleitet werden! Denn jede wissenschaftliche Theorie kann zumindest prinzipiell in Experimenten zurückgewiesen werden, aber ein Experiment, in dem der Determinismus zurückgewiesen werden könnte, ist undenkbar.
Die Autorin stellt fest, dass der gegenwärtige Wissensstand in der Neurowissenschaft eher einem „losen Gefüge spannender Zusammenhänge“ als einem festen Netzwerk kausaler Gesetzmäßigkeiten (geschweige denn von strengen Gesetzen) gleicht. Womöglich das einzige strenge mathematische Gesetz, dass objektive physikalische Realität mit Bewusstsein verbindet, ist das Weber-Fechner‘sche Gesetz, das bereits fast 150 Jahre alt ist. Aber auch dieses ist bloß eine Korrelation, die keine Aussage über Ursache-Wirkung-Beziehungen zulässt, und das gleiche gilt für die überwiegende Mehrheit der von der Neurowissenschaft beschriebener Effekte. In der Suche nach den Quellen der völlig unbegründeten Ansprüche der Neuroforscher, in wenigen Jahrzehnten das Bewusstsein auf die Hirnaktivität kausal zu reduzieren, kommt Falkenburg auf folgende Komponenten. Erstens ist es die hoffnungslos überzogene, wenn auch heuristisch stimulierende, Analogie zwischen Gehirn und Computer. Tatsächlich arbeiten Rechner deterministisch, aber sie sind keine Organe von Lebewesen. Als Teil des lebendigen Körpers ist das Gehirn im Gegensatz zum Rechner auf den ständigen Energieaustausch (nicht nur Informationsaustausch!) mit der Umwelt angewiesen (es verbraucht im Vergleich mit den anderen Organen eine Unmenge von Energie), und solche Systeme funktionieren grundsätzlich als stochastische, nicht als deterministische Systeme. Zweitens vergleichen die Neuroforscher und „Neurophilosophen“ das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Gehirn mit den anderen Verhältnissen, die im Laufe der Wissenschaftsgeschichte erfolgreich aufgelöst wurden, z.B. das Verhältnis zwischen der Temperatur und der Kinetik einzelner Moleküle, oder zwischen chemischen Reaktionen und quantenmechanischen Vorgängen, oder zwischen den vitalen biologischen Funktionen und den Eigenschaften einzelner Eiweiße und Nukleinsäuren [2]. Allerdings handelte es sich in all diesen Beispielen ausnahmslos um die kausale Erklärung eines Ganzen durch Eigenschaften seiner Teile. Das Verhältnis zwischen Gehirn und Bewusstsein ist eben nicht eines zwischen Teilen und Ganzen, denn auch das Gehirn ist ein Ganzes, und das Bewusstsein hat womöglich seine Teile, obgleich wir nicht genau wissen, was es sind. Dem Teil/Ganzes-Verhältnis entspricht daher das zwischen einzelnen Nervenzellen und der Funktion ganzer neuronaler Netzwerke, oder zwischen einzelnen Gedanken und momentanen Gefühlen und der Ganzheit eines Selbst – aber nicht zwischen Gehirn und Bewusstsein.
Drittens begehen Neuroforscher regelmäßig einen logischen Fehler, den die Autorin als Ignoranzdeutung der Wahrscheinlichkeit bezeichnet. Nehmen wir an, dass wenn ich an einen bestimmten Gegenstand denke, ein bestimmtes Areal in meinem Gehirn mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent aktiviert wird. Wohin mit den restlichen 30 Prozent? Sie werden unserem gegenwärtigen Unwissen zugeschrieben, dass „im Laufe der künftigen Entwicklung der Neurowissenschaften“ selbstverständlich nachgeholt wird. Dass diese Interpretation der Wahrscheinlichkeit absurd ist, zeigt das folgende Beispiel: Mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 99 Prozent können Menschen keine Musik komponieren. Bedeutet das, dass wir eigentlich wissen, dass Menschen keine Musik komponieren können, aber unserem Wissen fehlt noch das letzte Prozent Zuversicht? Nein, das bedeutet ganz im Gegenteil, dass Menschen wohl Musik komponieren können (und das wissen wir dank Mozart und Dieter Bohlen sogar ganz genau, mit einer Zuversicht von 100,0 Prozent!), aber 99 Prozent von ihnen tun dies nicht.
Viertens verbinden die Neuroforscher auf unlogische Weise zwei verschiedene Philosophien: Szientismus und Konstruktivismus. Dem letzteren folgend behaupten sie, dass unser Bewusstsein inklusive des Selbst, des freien Willens und der gesamten erlebten Welt nur eine Konstruktion des Gehirns sei. Aber dann bleibt es völlig unklar, warum die Neurowissenschaft selbst keine Illusion des Gehirns ist! Letztlich betreiben die Forschung auch Menschen mit ihren Gehirnen. Ist die ganze Welt eine Illusion (bescheidener: ein Konstrukt), dann sind die wissenschaftlichen Befunde schon auf jeden Fall Illusionen oder pure Konstrukte. Nein, sagen die Neuroforscher, ihre farbigen Bilder und Hirnstromaufzeichnungen seien real, sie spiegeln die wahre Wirklichkeit wider. Das ist ein Irrwitz, denn der radikale Glaube, dass die Welt durch unseren Geist (bzw. unser Hirn) konstruiert wird, ist mit dem radikalen Glauben, dass uns Wissenschaft (und zwar nur eine bestimmte: Neurowissenschaft) die Wahrheit über die Welt erzählt, unvereinbar.
Da es zum guten Ton eines Gutachtens gehört, bei all den positiven Bewertungen des begutachteten Werkes auch ein paar kritische Punkte anzumerken (bzw. anzumeckern), möchte ich an dieser Stelle als Insider sagen, dass die Autorin trotz ihrer durchaus kritischer Einstellung gegenüber den vielgepriesenen Errungenschaften der Neuroforschung immer noch den auf diesem Gebiet publizierten Daten viel zu viel Vertrauen schenkt. Sie bespricht ausführlich die Hinweise darauf, dass unser Bewusstsein im 3-Sekunden-Takt arbeitet, obwohl diese Hinweise bisher in einem einzigen Labor erhalten wurde und daher nach allgemeingültigen Kriterien der Wissenschaftlichkeit nicht als gesichert betrachtet werden dürfen. Sie glaubt, dass kortikale Stimulation eine Illusion von bewussten Handlungsabsichten auslösen kann, obwohl die Originalberichte der Neurochirurgen das Gegenteil beweisen. [3] Sie diskutiert kritisch die Bedeutung des berühmten Libet-Experiments, nimmt aber das bloße Ergebnis des Experiments für bare Münze ohne zu bemerken, dass dieses Ergebnis großenteils auf einem arithmetischen Fehler beruht, indem das Addieren von Zahlen mit dem Addieren von Kurven verwechselt wurde. [4] Schaut man zusätzlich die Datenstreuung in solchen Experimenten, so findet man, dass die Versuchspersonen sehr häufig ihren „Wunsch den Finger zu bewegen“ sogar nach der bereits ausgeführten Bewegung datieren, was absurd ist – aber in den Mittelwerten über viele Durchgänge gehen diese absurden Daten unter, was einen falschen Eindruck „zuverlässiger Befunde“ macht. Um die Parabel der Autorin weiter auszunutzen, würde ich sagen, dass der Kaiser zwar nicht bloß steht, sondern Kleider hat, doch bestehen die Kleider allzu oft aus Fetzen. [5]
All diese Momente kommen daher, dass Frau Falkenburg über das m.E. gravierendste Problem der Hirnforschung hinwegschaut: Das Problem der fehlenden Replikation für die überwiegende Mehrheit publizierter Ergebnisse. Die Position der Autorin ist durchaus nachvollziehbar, weil sie ein Buch über Philosophie der modernen Hirnforschung schreiben wollte, nicht um deren Soziologie. Dennoch glaube ich, dass die Irrwege der Neurowissenschaft nicht ausreichend verstanden werden können, ohne die aktuelle soziale Situation zu analysieren, in der der Erwerb der Drittmittel um jeden Preis zum eigentlichen Ziel des Forschungsbetriebs wird. So könnte man auch den Satz „Wer unser Waschmittel benutzt, ist glücklich“ rational prüfen und dabei logische und faktische Inkonsistenzen feststellen, aber das hätte uns wenig erklärt, wenn wir die soziale Funktion dieses Satzes als Werbung außer Acht ließen.
Fassen wir das Gesagte zusammen. In Bezug auf die Neurowissenschaft hält die Autorin einen „Plädoyer zur Bescheidenheit“ (S.404), sieht aber ein sehr hohes praktisches Potential (was z.B. die Behandlung neurologischer und psychischer Krankheiten betrifft), „wenn die [Neuroforschung] es schafft, den mechanistischen und deterministischen Ballast des 18.Jh. über Bord zu werfen, von dem die Alltagsmethaphysik vieler Wissenschaftler und Neurophilosophen bis heute durchdrungen ist“ (S. 390). Viel skeptischer steht sie gegenüber der theoretischen Möglichkeit, das Bewusstsein aus dem Gehirn irgendwann zu erklären, denn sie besteht auf einer Inkommensurabilität der beiden: Sie lassen sich in völlig verschiedenen, ineinander nicht übersetzbaren Begriffen beschreiben. Das ist eine sehr starke These, deren Analyse den Rahmen dieser Rezension sprengen würde.
In Bezug auf das Kausalitätsprinzip stellt sich die Frage: Sollen wir den guten alten Glauben, dass jedes Ding seine Ursache hat, wie „ein Relikt vergangener Jahrhunderte“ (Bertrand Russel), über den Haufen werfen? Nein, meint Falkenburg, sondern wir sollen im Einklang mit Kant die Kausalität als normativen Grundsatz betrachten, also eine Verfahrensregel: Der Naturwissenschaftler tue gut, wenn er bei jedem Phänomen nach dessen Ursachen suche. Eine Verfahrensregel kann weder wahr noch falsch sein, sondern nur nützlich oder nutzlos. Und während Kant zu den Zeiten der klassischen Naturwissenschaft seine a priori Erkenntnisformen als absolute ansehen konnte, so dürfen wir dies nach Lobatschewski und Einstein, nach Bohr und Prigogine nicht mehr. Man kann auch in der postmodernen Ära an die absolute Wahrheit glauben; aber Nutzen ist auf jeden Fall nur relativ, und was mir gestern nutzte, nutzt mir morgen vielleicht nicht mehr.
So ist z.B. der christliche Glauben womöglich nützlich in dem Sinne, dass bekennende Christen und stete Kirchengänger statistisch gesehen gesünder leben als Atheisten. Doch kein ernst zu nehmende Theologe wird in diesen medizinischen Fakten einen Beweis für die Wahrheit des Christentums sehen. Dasselbe gilt für Determinismus: Er ist völlig okay, solange er als vorwissenschaftlicher Glaubenssatz angesehen wird, der für den Fortschritt in vielen Wissensbranchen vom Nutzen ist (in den anderen vielleicht nicht). Als solcher steht er dem freien Handeln der Menschen im privaten wie im politischen Bereich nicht im Wege. Aber die Larve einer wissenschaftlich nachgewiesenen, zwingenden „Wahrheit“ muss er ausziehen. Das 20.Jh. hat uns bereits gezeigt, zu welch ernsthaften sozialen Konsequenzen es führen kann, wenn sich eine Ideologie als Wissenschaft darzustellen versucht. Einen weiteren derartigen Fall brauchen wir wahrlich nicht.