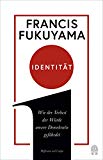24.05.2019
Die Politisierung von Identität
Rezension von Frank Furedi
Wieso heute jeder über Identität spricht. Frank Furedi rezensiert Francis Fukuyamas „Identität: Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet“.
Das öffentliche Leben wird heute dominiert von einer Politisierung der Identität. Die großen Erzählungen des Zeitalters der Ideologie wichen einer Kakophonie an Forderungen nach Bestätigung durch immer neue Akteure auf dem Marktplatz der Identitäten. Kaum wird die Gruppe angeblich privilegierter Weißer (engl. white privilege) wegen ihres „farbenblinden“ Mangels an Sensibilität gegenüber angeblich diskriminierten Gruppen kritisiert, beginnen unsichere Angehörige jener privilegierten Gruppe, ihre Anliegen über das Mediums einer voreilig konstruierten weißen Identität zu formulieren.
Francis Fukuyamas sehr lesenswertes Buch „Identität: Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet“ versucht mit dem gegenwärtigen identitären Moment abzurechnen. Er will erklären, warum wir einen Punkt erreicht haben, an dem Identität so starken Einfluss auf das öffentliche Leben nimmt.
„Identität“ fährt fort, wo sein einflussreiches „Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?“ aufgehört hat – nämlich mit dem Sieg eines globalen Systems basierend auf liberalen demokratischen Idealen. Fukuyama dämpfte damals etwaigen Triumphalismus mit dem Hinweis auf das nach wie vor ungelöste platonische Problem des „Thymos“, also der Begierde des Menschen nach Anerkennung seiner Würde. In „Identität“ vertieft er sein Bild dieses Verlangens und fügt zwei weitere Konzepte hinzu: Die „Isothymia“, also die Forderung auf gleicher Augenhöhe mit anderen Menschen respektiert zu werden, und die „Megalothymia“, die Begierde, als überlegen wahrgenommen zu werden. Er argumentiert, dass diese unterschiedlichen Manifestationen des Strebens nach Anerkennung die Hauptfaktoren der Identitätspolitik sind. Die Forderung nach Anerkennung sei das „Grundkonzept, das vieles von dem, was heute in der Welt vor sich geht, vereint“, so seine Schlussfolgerung.
Die Konstruktion der Forderung nach Anerkennung als ein Grundkonzept, ermöglicht es Fukuyama, ansonsten unvereinbare politische Phänomene als ein Problem zu behandeln. Unmut über die Demütigung nicht anerkannt und bestätigt zu werden, untermauert Russlands aggressive Außenpolitik, den militanten Islam, die Wahl von Donald Trump, das Ergebnis der Brexit-Abstimmung, den Aufstieg des Populismus in Europa und die Verbreitung identitätsbasierter Gruppen in westlichen Gesellschaften. Es besteht kein Zweifel an Fukuyamas Anspruch. Jedoch riskiert er, indem er das Netz so weit auswirft, spezifische Dynamiken und Zusammenhänge, die die verschiedenen Ereignisse beeinflussen, aus den Augen zu verlieren. Können Phänomene so unterschiedlich wie der Brexit und Trans-Aktivismus wirklich in gleicher Weise als eine „Identität, die keine Anerkennung findet“, erklärt werden? Was ist das zudem für eine Identität, die immer auf der Suche nach Anerkennung ist?
Die Identitätsgeschichte
Fukuyama erläutert, dass Identität aus der „Differenzierung zwischen dem wahren inneren Selbst und der äußeren Welt der sozialen Ordnung“ herauswächst. Das innere Selbst des Menschen bildet die Grundlage der Menschenwürde, die wiederum immer auf der Suche nach Anerkennung ist. Die Spannung und Trennung „zwischen dem Inneren und dem Äußeren“ erschafft das Fundament der Identität. Für ihn ist die Idee der Identität während der Reformation geboren, als Luther das innere Selbst externen Institutionen gegenüber aufwertete.
Luthers Bestätigung des menschlichen Gewissens und Innenlebens spielte zweifellos eine wichtige Rolle bei der Befreiung des Einzelnen von äußeren Zwängen. Luthers Fokus auf das Innenleben führte jedoch nicht unmittelbar zu einer Forderung nach Anerkennung von anderen Menschen oder Institutionen. Die Erforschung des inneren Selbst mag die Frage „Wer bin ich?“ aufgeworfen haben. Das hatte allerdings wenig Gemeinsamkeiten mit der Art und Weise, wie Identität in den letzten 50 bis 60 Jahren konzeptualisiert wurde.
„Bei Luther bedeutete Identität vor allem Selbstähnlichkeit, heute geht es um ein Bewusstsein von Differenz und Einzigartigkeit.“
Wie Gerald Izenberg in seiner meisterhaften Studie „Identity: The Necessity of a Modern Idea“, aufzeigt, hätte Luther das zeitgenössische Konzept von Identität „unverständlich“ gefunden. Luther löste die Spannung zwischen innerem Selbst und äußeren Bedingungen durch eine moralische Orientierung, die auf bereits bestehende universelle Begriffe zurückgriff. Sofern die Identität in Luthers Zeit eine Bedeutung hatte, bedeutete sie wenig mehr als Selbstähnlichkeit. Im Kontrast dazu bezieht sich Identität heute häufig auf ein Bewusstsein von Differenz und Einzigartigkeit.
Die Sorge über das Wesen des Selbst ist ein in der Geschichte wiederkehrendes Thema. Im Hinblick auf Identität ist diese aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Die ausgiebigste und verbindlichste Darstellung der historischen Spezifität von Identität findet sich in Marie Morans „Identity and Capitalism“. Wie Moran erklärt, ist Identität eine ganz neue Idee: „Vor den 1960er-Jahren war sie nie „wichtig“, weil sie bis in die 1960er-Jahre weder tatsächlich existierte noch als gemeinsame politische und kulturelle Idee funktionierte.“ Sie fährt fort: „Bis in die 1950er- oder gar 1960er- und 1970er-Jahre gab es keine Diskussion über eine sexuelle Identität, ethnische Identität, politische Identität, nationale Identität, Unternehmensidentität, Markenidentität, Identitätskrise beziehungsweise über das „verlieren“ oder „finden“ der eigenen Identität.“
Seit den 1960er-Jahren ist Identität zu einer zentralen Kategorie der Sozialwissenschaften geworden und wird sowohl in wissenschaftlichen als auch in populären Monografien häufig zitiert. Vor dem Zweiten Weltkrieg lagen die Dinge anders. Wie der Ideengeschichtler Philip Gleason betont, beinhaltete die Anfang der 1930er-Jahre herausgegebene „Encyclopedia of the Social Sciences“ „überhaupt keinen Eintrag über Identität“. Es gab nur einen Eintrag mit dem Titel „Identifizierung“, der sich mit Fingerabdruckerkennung und anderen Techniken der Strafverfolgung befasste. Was auch immer die Signifikanz der Forderung nach Anerkennung vor dem Zweiten Weltkrieg war, sie wurde durch das Medium der Identität weder wahrgenommen noch repräsentiert.
„Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte fehlte die Notwendigkeit ‚eine Identität zu haben‘.“
Weit davon entfernt, ein universelles Anliegen zu sein, fehlte die Notwendigkeit, „eine Identität zu haben“ im Verlauf der Menschheitsgeschichte innerhalb öffentlicher und kultureller Überlegungen. Izenberg behauptet, dass die erste moderne Verwendung des Begriffs Identität in Virginia Woolfs Zwischenkriegsroman „Orlando“ zu finden ist. Sigmund Freud sprach bekanntlich in einer Rede von 1926 über seine jüdische Identität, in Bezug auf sein inneres Selbst. Freuds flüchtiger Verweis auf Identität kann als Eingeständnis der Unsicherheit über seine Rolle in der Welt ausgelegt werden, was zweifellos die aktuelle Verwendung des Begriffs vorwegnimmt. Wie Izenberg darlegt, führte der Erste Weltkrieg zu einer Erschütterung des Selbstverständnisses der Menschen. Diese führte dazu, dass Fragen nach ihrer Identität aufgeworfen wurden. Allerdings würde es bis in die 1940er- und 1950er-Jahre dauern, bis sich der Gedanke herauskristallisierte, dass sich die Identität in einer Krise befand.
Es ist wichtig, sich mit der historischen Entwicklung der Bedeutung von Identität zu beschäftigen, weil wir so besser verstehen, was in unserer eigenen Ära wirklich verschieden und einzigartig ist. Die zeitgenössisch individuelle, standardisierte und fragmentierte Version von Identität ist eine relativ junge Entwicklung, angetrieben von einer Kombination aus vier wichtigen ineinandergreifenden und sich gegenseitig verstärkenden Einflüssen.
Diese sind: das noch nie dagewesene Wachstum der Konsumkultur und damit einhergehend die Propagierung des Lebensstils als Schlüsselkomponente persönlicher Identität; der mächtige Einfluss einer Therapiekultur, die eine bedeutende Rolle in der gesellschaftlichen Beschäftigung mit dem Selbst und Selbstwertgefühl spielt; die außergewöhnliche Erosion jedweden moralischen Konsenses, der zu großen Unklarheiten über die Rolle des Menschen in der Weltgeführt hat; und schließlich die Auflösung einflussreicher politischer Bewegungen und Ideologien, die zur Schwächung universalistischer Impulse im öffentlichen Leben beigetragen haben.
Diese Entwicklungen haben ein Umfeld geschaffen, in dem die partikularistischen Vorstellungen selten herausgefordert werden. In ihrer radikalsten Form – in der angloamerikanischen Sphäre – hat sich jene konsolidierte partikularistische Stimmung mit dem Trend zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Selbst verbunden. In unserer Zeit verbirgt sich in vielen Fällen hinter der Forderung nach Bestätigung einer kollektiven Identität ein selbstfixiertes Gefühl: „Es geht nur um mich“.
„Der zeitgenössische Fokus auf das Persönliche verleiht der Politik einen bisher nicht gekannten subjektiven und damit willkürlichen Charakter.“
In den meisten historischen Gesellschaften brauchten die Menschen kein Konzept von Identität, weil sie wussten, wer sie waren. Es ist erwähnenswert, dass, als Platon seine Sichtweise über „Thymus“ ausführte und die Seele in verschiedene Komponenten aufteilte, er nicht an dem Problem der Identität interessiert war, zumindest nicht in der Art und Weise, wie wir sie heute verstehen. Platons Interesse am Selbst wurde durch Fragen, ob die Seele den physischen Tod überlebt oder nicht, angeregt. Die transhistorische Behandlung der Forderung nach Anerkennung ist die größte theoretische Schwäche von Fukuyamas „Identität“. Manchmal kann sie zu schierem Anachronismus führen. Nachdem er sich mit den Auswirkungen des Übergangs vom ländlichen Dorfleben zu einer urbanen industriellen Existenz im 19. Jahrhundert beschäftigt, kommt er zu dem Schluss: „dies war der Moment, in dem das Persönliche politisch wurde!“ Nun könnte die neu entstehende Arbeiterklasse sich entfremdet und desorientiert gefühlt haben, doch hätte das Motto „Das Persönliche ist politisch“ ihnen nur mit geringer Wahrscheinlichkeit viel bedeutet.
Das Persönliche konnte nur politisch werden, als die breiten humanistischen Impulse, die die soziale Bewegungen in Folge der Aufklärung inspirierten, scheinbar ihre Bedeutung verloren. Die Politisierung der Person in den 1960er- und 1970er-Jahren war nicht einfach die jüngste Version einer romantischen Suche nach dem echten Selbst. Vor allem wurde ihre Entstehung durch die Erschöpfung und Auflösung der politischen Linken und deren Hinwendung zu einer „Politik der Differenz“ möglich.
Der heutige Fokus auf dem Persönlichen verleiht der Politik einen bisher nicht gekannten subjektiven und damit willkürlichen Charakter. Die ständige Verbreitung von Identitäten offenbart ihren zerbrechlichen und flüchtigen Charakter. Paradoxerweise sind sich diejenigen, die heute Bestätigung einfordern, nicht immer sicher, wer sie wirklich sind und wie sie wahrgenommen werden wollen.
Die Frage der Souveränität
Fukuyama erkennt den spalterischen Einfluss der Identitätspolitik und die Notwendigkeit, „gemeinsame Ziele durch Beratung und Konsens zu erreichen“. Er argumentiert zu Recht, dass ein solcher Konsens sich nur innerhalb eines nationalen Rahmens durchsetzen kann. Er plädiert für „nationale Identitäten“, die auf der Grundlage von „liberalen und demokratisch-politischen Werten, und dem Verbindenden, um das herum sich vielfältige Gemeinschaften entwickeln“, errichtet werden können. Er weist sogar darauf hin, dass die bloße Existenz einer liberalen Demokratie die Existenz einer nationalen Identität voraussetzt.
„Wir sollten versuchen das demokratische Defizit Europas zu bewahren.“
Unglücklicherweise wird Fukuyamas Unterstützung nationaler Identität gebremst durch seinen Widerwillen, das Ideal nationaler Souveränität zu befürworten. Seine Entfremdung von der Souveränität zeigt sich in seiner Populismuskritik. Die Forderung „unser Land zurückzugewinnen“ oder „die Kontrolle zurückzugewinnen“, sagt er, drücken eine Angst und Feindseligkeit gegenüber Ausländern und Einwanderern aus. Zweifellos haben verunsichertes und nativistisches Denken einige Bürger in den USA und Europa angespornt. Aber in vielen Fällen dient die Vorstellung „unser Land zurückzugewinnen“ als Abkürzung für die (Wieder-)Erlangung der demokratischen Kontrolle über das Schicksal einer Gemeinschaft. Es ist schade, dass Fukuyama sich nicht mit diesem Demokratiedefizit befasst, schließlich ist es dieses, das so viele Menschen vom öffentlichen Leben entfremdet und den aktuellen populistischen Moment hervorgerufen hat – nicht der „Deus ex machina“ einer zunehmenden Fremdenfeindlichkeit.
Natürlich ist sich ein leidenschaftlicher Politikbeobachter wie Fukuyama der verheerenden Auswirkungen des demokratischen Defizits auf das öffentliche Leben bewusst. Aber seine Lösung – zumindest im Falle Europas – ist eine technokratische. Er schreibt, dass die EU idealerweise ein eigenes Staatsangehörigkeitsrecht entwickeln sollte, welches die nationalen Staatsbürgerschaftsgesetze ersetzen könnte. Das würde die Bedeutung, Bürger einer Nation zu sein, weiter reduzieren und die Entfremdung der Menschen von ihren politischen Institutionen vertiefen. Anstatt, wie Fukuyama vorschlägt, ein „Heilmittel für die populistische Politik der Gegenwart“ zu suchen, sollten wir versuchen das demokratische Defizit Europas zu beheben.
„Ein Konsens kann nur von einem souveränen Volk erreicht werden.“
Es ist die Entwertung von Souveränität – national und im Sinne eines Staatsvolks –, die zumeist die Bedingungen geschaffen hat, unter denen die Politisierung der Identität gedeiht. Fukuyama hat recht, dass das wirksamste Gegenmittel einer Identitätspolitik der Konsens ist, aber ein Konsens kann nur von einem souveränen Volk erzielt werden. Bereits zu lange haben die Regierungen in Europa ihre Bürger nicht ernst genommen und umgingen diese oft genug, wenn sie wichtige Entscheidungen über die Form und Beschaffenheit ihrer Gemeinschaften trafen. Die politische Elite, die so sehr die Bedeutung von Souveränität verachtet, hat sich wenig bemüht, eine nationale Vision zu fördern.
Im letzten Kapitel „Was tun?“ kommt Fukuyama zu dem Schluss, dass „die europäischen Länder ihr Verständnis von nationalen Identitäten von jenen weg verlagern müssen, die auf ethnischer Zugehörigkeit beruhen“. Seinen Aufruf für ein auf zivilgesellschaftlichen Werten basierendes Nationalgefühl würde jeder aufgeschlossen und aufklärungsorientiert denkender Mensch befürworten. Allerdings kann ein Zugehörigkeitsgefühl nicht allein auf Regeln und Verfahren beruhen. Ihnen fehlt die moralische Grundlage, um zu motivieren und zu inspirieren. Nur wenn Mitglieder einer Gemeinschaft über vorpolitische Beziehungen verfügen, die sie miteinander verbinden, haben sie das Gefühl der Zugehörigkeit. Dies bedeutet nicht, dass jeder Bürger Bindungen zu den Vorfahren seiner Gemeinschaft haben muss. Dennoch müssen Bürger einen gesunden Menschenverstand, Wertvorstellungen und Wertschätzung für das Vermächtnis ihrer Gemeinschaft gemein haben. Eine derartige Staatsbürgerschaft kann nicht völlig integrativ sein und die Gesamtheit der Menschen umfassen. Indem sie den Menschen jedoch ein Gefühl der Gemeinsamkeit vermittelt, kann die Politik der demokratischen Bürgerschaft ein wirksames Heilmittel gegen die entzweienden Konsequenzen einer Identitätspolitik zur Verfügung stellen.
Fukuyama erinnert uns zu Recht daran, dass „wir nicht davor entkommen werden, über uns selbst und unsere Gesellschaft in Kategorien der Identität nachzudenken“. Die Herausforderung, vor der wir stehen, besteht daher darin, wie der gegenwärtige Drang zur Erfindung, Dramatisierung und Politisierung von Identitäten neutralisiert oder zumindest minimiert werden kann.