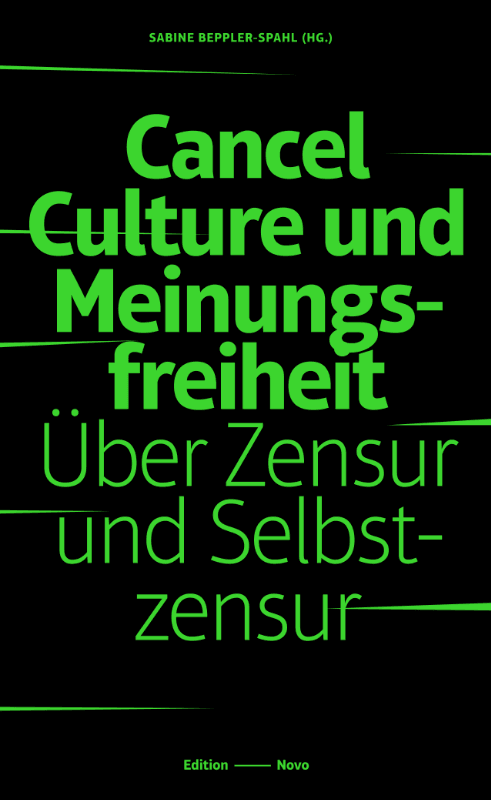23.06.2025
Zensur ohne Kontrolle
Der Fall des freigesprochenen Arztes Conzelmann steht für zunehmende Verfahren wegen Politikerbeleidigung, zu denen ein wucherndes Überwachungsnetzwerk halbstaatlicher Organisationen beiträgt.
Der Mord an dem Berliner Arzt Wolfgang Conzelmann hat nach jetzigem Stand vermutlich nichts mit dem wenige Tage zuvor stattgefundenen Gerichtsprozess gegen ihn zu tun. Und doch wirkt die Geschichte wie ein düsteres Fragment aus einem Roman von Camus – eine Erzählung über einen Staat, der zunehmend außer Kontrolle gerät.
Am 13. Juni wurde Conzelmann, ein Arzt, der sich jahrzehntelang auf die Behandlung von Drogensüchtigen spezialisiert hatte, in seiner Praxis nahe des berüchtigten Leopoldplatzes brutal getötet. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Tragisch: Nur drei Tage zuvor war Conzelmann von einem Berliner Gericht vom Vorwurf der Politikerbeleidigung (§ 188 StGB) freigesprochen worden.
Der Anlass für die Anzeige: Im Oktober 2022 hatte er eine Karikatur auf Facebook veröffentlicht. Darauf zu sehen: ein Propagandaplakat aus der NS-Zeit, in dem das Hakenkreuz durch das Logo der Grünen ersetzt worden war – daneben das Gesicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Den Post setzte er in einer Facebook-Gruppe ab, die die Corona-Politik der Regierung kritisierte.
Was dann folgte, ist exemplarisch für das neue Zensurregime in Deutschland: Eine frühmorgendliche Hausdurchsuchung, beschlagnahmte Handys und Computer – wegen eines Memes. Conzelmann verweigerte die Zahlung einer Geldstrafe von 3000 Euro und ging in Berufung. Auf seiner Website wehrte er sich mit polemischen, teils wirr wirkenden Texten – etwa unter Titeln wie „Verbrecherstaat oder Demokratie“ und „Der Staat der Drogenmafia“. Auf einem Schild an seiner Praxis soll zwischenzeitlich zu lesen gewesen sein: „Demokratie heißt: Klappe halten!“
Doch Conzelmann war kein Einzelfall. Seit der Einführung des §188 StGB in seiner jetzigen Form, im Jahr 2021 – eines Paragraphen, der „Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens“ unter Strafe stellt – wurden hunderte Verfahren eingeleitet. Die Anzeigen stammen dabei zumeist nicht von Bürgern, sondern von einem undurchsichtigen Netzwerk sogenannter zivilgesellschaftlicher Akteure – faktisch von staatlich alimentierten NGOs, die Denunziation zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben.
„HateAid ist Teil eines größeren Geflechts von halbstaatlichen Organisationen.“
Ein Beispiel für eine solche Organisation ist HateAid. Die Organisation wurde kürzlich von der Bundesregierung zum sogenannten „Trusted Flagger“ im Rahmen des Digital Services Act der EU ernannt – und damit zur offiziellen Zensurinstanz mit privilegiertem Zugang zu Plattformbetreibern. HateAid kann nun nicht nur Inhalte melden, sondern direkt Einfluss darauf nehmen, was gelöscht und was strafverfolgt wird.
In einer Dokumentation des US-Senders CBS News, die Anfang des Jahres international für Aufsehen sorgte, wurde HateAid bereits vorgestellt – zusammen mit der „Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet“ in Göttingen. In der Reportage ist zu sehen, wie sich Staatsanwälte darüber amüsieren, wie „schmerzhaft“ es für Betroffene sei, wenn ihre Geräte konfisziert werden.
HateAid ist Teil eines größeren Geflechts von halbstaatlichen Organisationen. Oft setzen sie sich aus weiteren Organisationen zusammen. Im Falle von HateAid sind das Campact oder Fearless Democracy e.V. Im Beirat der Organisation sitzen Politiker, deren Karrieren längst vorbei – oder sogar gescheitert – sind, darunter Nadine Schön (CDU), Brigitte Zypries (SPD) und Renate Künast (Grüne). Ihr Einfluss auf die politische Debatte ist durch diese Tätigkeit beträchtlich. Ihre demokratische Legitimation dafür jedoch gleich null.
Der Journalist Jakob Schirrmacher beschreibt das treffend als eine „technokratische Verschiebung von Entscheidungsgewalt weg von Öffentlichkeit und Recht – hin zu halbprivaten Meldestrukturen, die Kommunikationsräume nach vorpolitischen Kriterien ordnen“.
Organisationen wie HateAid, Respekt! oder So Done beschäftigen Dutzende digitale Kontrolleure, deren tägliche Arbeit in der Durchforstung des Internets nach „problematischen Inhalten“ besteht. HateAid allein zählt über 50 Angestellte. Die Erfolgskennzahl dieser Organisationen ist die Zahl der eingereichten Meldungen und angestoßenen Strafverfahren. Respekt! meldete 2024 über 11.000 Fälle – 31 pro Tag – und bewirbt dies als Beleg für die eigene Relevanz.
„Entstanden ist ein selbstreferenzielles Zensurökosystem, das keiner öffentlichen Kontrolle unterliegt.“
Das System erhält sich selbst. Eine Organisation rechtfertigt die andere. Die Definition von „Beleidigung“ wird dabei immer weiter gefasst. Entstanden ist so ein selbstreferenzielles Zensurökosystem, das keiner öffentlichen Kontrolle unterliegt.
Wie der Blogger eugyppius festhält, haben wir ein „autonomes, sich selbst verstärkendes Zensurregime geschaffen, das keinem anderen Zweck als seiner eigenen Verbreitung dient“. Wer gehofft hatte, mit einer neuen Regierung würde dieser Apparat abgebaut, sieht sich enttäuscht. Die Zensurstrukturen wachsen, im Gegenteil, weiter. Ihre Maschinerie folgt einer eigenen inneren Logik.
Die größte Gefahr liegt in der abschreckenden Wirkung auf die Meinungsfreiheit. Wenn anonyme Organisationen Razzien veranlassen können, wenn NGOs definieren, was sagbar ist, wenn Strafverfolgung zum Instrument politischer Kontrolle wird – dann wird das Gift der Zensur zur systemischen Realität.
Der Fall Conzelmann wirft ein grelles Licht auf diesen Zustand: Freigesprochen wurde er erst nach zweieinhalb Jahren – und für was war er überhaupt angezeigt worden? Der Fall macht deutlich, wie leicht sich ein demokratischer Staat in ein kafkaeskes System verwandeln kann, in dem nicht mehr das Urteil, sondern die Anzeigen selbst zur Strafe – und zur Methode der Einschüchterung von Bürgern – werden.