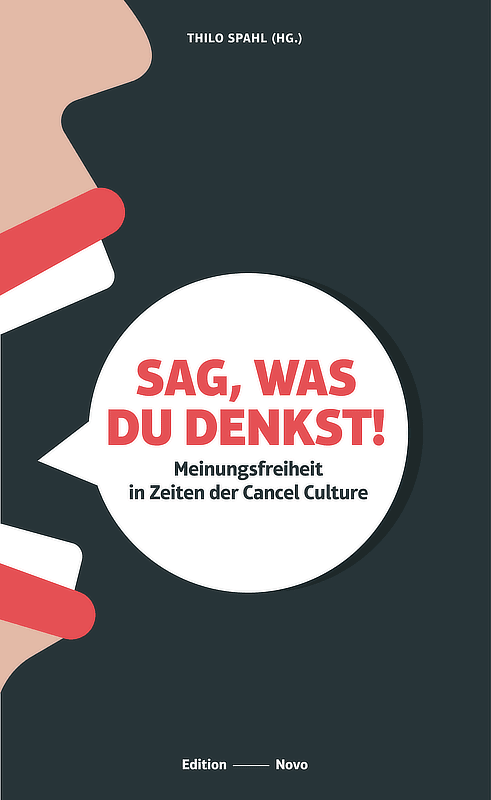01.03.2024
Vielfalt statt Toleranz?
Von Frank Furedi
Vielfalt bzw. Diversität ist erst in jüngerer Zeit zu einem Wert an sich geworden. Wer ihr huldigt, duldet oft keine abweichenden Standpunkte und will die Meinungsfreiheit weiter einschränken.
In der Vergangenheit wurden Diskussionen über die relativen Vorzüge von Vielfalt oder Homogenität nicht in den Bereich der Werte verlagert. Erst in den letzten vier oder fünf Jahrzehnten avancierte Vielfalt zum Wert an sich. Öffentliche und private Organisationen bestehen nun auf Vielfalt als integralem Bestandteil ihrer Arbeitsweise. Der Dreiklang aus Diversität, Gleichstellung und Inklusion (diversity, equity, inclusion – DEI) ist in der gesamten angloamerikanischen Welt institutionalisiert worden. Internationale Organisationen und NGOs haben der Vielfalt buchstäblich einen Heiligenschein verliehen. Die Unesco besteht darauf, dass „Vielfalt das Wesen unserer Identität ist". In Unternehmen kommt Vielfalt vor Kompetenz und Leistung. In der Hochschulbildung ist Vielfalt zu einem Wert ersten Ranges geworden, der als wichtiger als akademische Fähigkeiten und akademische Freiheit gilt.
Um die quasi-religiöse Verwandlung der Vielfalt in ein selbstverständliches Dogma zu verstehen, ist es sinnvoll, ihre historische Entwicklung zu untersuchen. Ein Wort der Warnung: Es ist immer verlockend, auf die dogmatische Behauptung der Vielfalt als heiligem Wert mit einer ebenso einseitigen Behauptung der Homogenität zu antworten. Wir halten es für weitaus fruchtbarer, die Beziehung zwischen Vielfalt und Homogenität als eine zu betrachten, die in Bezug auf den Kontext, in dem sie entsteht, bewertet werden muss.
Vielfalt: früher rechts, heute links
Heutzutage wird die Forderung nach Vielfalt und Unterschiedlichkeit in der Regel mit Bewegungen in Verbindung gebracht, die meist mit linken, liberalen oder woken Interessen verbunden sind. Im Gegensatz dazu wird die Betonung von Homogenität und Einheit im Allgemeinen mit konservativen und rechten Idealen in Verbindung gebracht. Dieser ideologisch polarisierte Zustand ist relativ neu. Historisch gesehen neigten konservative Denker dazu, Unterschiede und kulturelle Besonderheiten zu feiern, während auf Veränderung gerichtete Denker sich für Ähnlichkeit und Universalismus entschieden.
Die Bejahung des Universalismus durch die Aufklärung rief oft eine konservative Reaktion hervor, die sich für die einzigartigen Qualitäten des Lokalen und Partikularen einsetzte. Die konservative romantische Bewegung in Deutschland betonte die Bedeutung kultureller Unterschiede und behauptete, dass darauf gegründete Identitäten authentischer seien als eine abstrakte Bindung an den Universalismus. Diese Haltung war zum Teil eine Reaktion auf den wachsenden Einfluss der rationalistischen und universalistischen Ideale der französischen Aufklärung auf die europäischen Gesellschaften. Die deutschen Romantiker stellten die authentische Kultur dem abstrakten Geist des Universalismus der französischen Aufklärung positiv gegenüber. Der deutsche Philosoph Johann Gottfried Herder (1744-1803) brachte den partikularistischen Geist der neuen romantischen Verehrung der kulturellen Identität eindringlich auf den Punkt. Er behauptete, dass es die Kultur sei, die jedes Volk definiere und ihm seine eigene Identität und seinen eigenen Geist verleihe.
„Erneuerer strebten nach Uniformität, während Konservative die Differenz verteidigten. Erneuerer setzten sich für Gleichheit ein, während die Konservativen Vielfalt und kulturelle Unterschiede befürworteten.“
Im Gegensatz zu den Partikularisten, die die Vielfalt betonten, tendierten Linke und Liberale dazu, sich auf die gemeinsamen Eigenschaften der Menschen zu konzentrieren. Die englischen Liberalen seit Hume neigten dazu, die gemeinsamen Eigenschaften der menschlichen Natur zu betonen. Von diesem Standpunkt aus entwickelte Thomas Paine sein Engagement für die universellen Menschenrechte. Für die Philosophen und Radikalen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts war das Streben nach Einheit und das Verfechten einer gemeinsamen menschlichen Natur ein integraler Bestandteil ihrer Weltanschauung. Abbé Sieyès, ein politischer Theoretiker der Französischen Revolution, war zutiefst besorgt über das, was er als das Chaos der lokalen Bräuche ansah. Die Beseitigung der kulturellen Vielfalt in Frankreich war eines der Hauptziele des revolutionären Regimes. Auf die Gefahr hin, zu verallgemeinern, kann man sagen, dass die Erneuerer oft eifrige Verfechter der Vereinheitlichung waren, während die Konservativen die Dezentralisierung anstrebten.
Das Streben nach Einheit und die Behauptung einer gemeinsamen menschlichen Natur waren charakteristisch für diese radikale Denkweise. Erneuerer strebten nach Uniformität, während Konservative die Differenz verteidigten. Erneuerer setzten sich für Gleichheit ein, während die Konservativen Vielfalt und kulturelle Unterschiede befürworteten.
Differenzierter Diskurs
Im 19. Jahrhundert war die Diskussion über das Spannungsverhältnis zwischen Einheitlichkeit und Unterschiedlichkeit weitaus differenzierter als heute. Der französische liberale Philosoph Benjamin Constant verkörperte ein reifes Streben sowohl nach Einheit als auch nach Differenz. Als Liberaler betrachtete er Uniformität als ein Zeichen von Rationalität. Constant war aber auch eine Art Libertär-Konservativer und sah daher die Notwendigkeit, lokale Bräuche und Gemeinschaften zu verteidigen. Er verband seine Kritik an ungerechten Bräuchen, wie z. B. an der Sklaverei, mit der Einsicht, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gemeinschaften gewahrt werden müssen. Laut einer von Bryan Garsten verfassten Studie „vertrat Constant die Ansicht, dass langsame Prozesse lokaler gesellschaftlicher Entwicklung im Allgemeinen effektiver und letztlich fortschrittlicher [seien] als einheitliche, von oben auferlegte Vorschriften“. Es sei wahrscheinlicher, dass ein „‚Freiheitsgefühl‘" in solchen Gemeinschaften entstehe und „robustere Formen des Patriotismus [seien] in lokalen Zugehörigkeiten verwurzelt“.1
Constant befürwortete die Vielfalt aus Gründen, die man heute als konservativ bezeichnen würde. Er sprach sich gegen das Projekt der Befreiung der „Individuen von lokalen Bindungen und Vorurteilen" mit der Begründung aus, dass dieses die Freiheit und den Staat untergraben würde. „Wie bizarr ist es doch, dass diejenigen, die sich selbst als glühende Freunde der Freiheit bezeichnet haben, unermüdlich daran arbeiten, die natürliche Grundlage des Patriotismus zu zerstören und ihn durch eine falsche Leidenschaft für ein abstraktes Wesen, für eine allgemeine Idee zu ersetzen, die all dessen beraubt ist, was die Phantasie anregt und die Erinnerung anspricht", schrieb er.
Constant sah im Lokalpatriotismus die Grundlage der Freiheit, und war daher besorgt über das Gebot der staatlichen Uniformität, die das Individuum von seiner organischen Verbindung zur Gemeinschaft zu lösen versuchte. Es ist bemerkenswert, dass der Lokalpatriotismus in der heutigen Zeit zur bitteren Zielscheibe von Diversity-Unternehmern geworden ist, weil er Menschen aus einer klar abgegrenzten homogenen Gemeinschaft ausschließt. Das frühere Zelebrieren der Vielfalt unterscheidet sich grundlegend von der Nutzung, die sie heute erfährt.
„Die Befürworter der Vielfalt im 18. und 19. Jahrhundert versuchten, der homogenisierenden Tendenz entgegenzuwirken, dem Denken und Verhalten Uniformität aufzuerlegen.“
Die englischen Liberalen des 19. Jahrhunderts besaßen ebenfalls ein ausgewogenes und differenziertes Verständnis des Verhältnisses zwischen Vielfalt und Gleichheit. Obwohl sie an einen Universalismus und eine gemeinsame menschliche Natur glaubten, waren sie in sozialen Fragen oft pluralistisch orientiert. John Stuart Mills „Über die Freiheit“ kann als Beispiel für die liberale Auffassung von Vielfalt im 19. Jahrhundert dienen. In diesem Text kritisierte Mill die negativen Folgen der zunehmenden Ähnlichkeit, von der er befürchtete, dass sie der Gesellschaft eine Kultur der unreflektierten Konformität aufzwingen würde.
Zugleich und in verschiedenen Zusammenhängen vertrat Mill jedoch auch einen Standpunkt, der die Vorteile von Einheit und Solidarität propagierte. In seinem Essay „Utilitarismus“ (1861) misst Mill der Einheit große Bedeutung bei und stellt fest, dass mit „einem sich verbessernden Zustand des menschlichen Geistes die Einflüsse ständig zunehmen, die dazu neigen, in jedem Einzelnen ein Gefühl der Einheit mit allen anderen zu erzeugen".2 Wie Michael Levin feststellt, wollte Mill „sowohl die Verschiedenheit als auch die Einheit ".3
Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entging den Kommentatoren in der Debatte über Vielfalt und Einheit nicht, dass die Spannung zwischen diesen beiden Polen nicht dadurch gelöst werden könnte, indem das Verhältnis zwischen ihnen zerrissen würde. Insgesamt spielte die Vielfalt eine wichtige Rolle, um dem zentralisierenden Impuls, der im Laufe der Moderne freigesetzt wurde, entgegenzuwirken. Die Bekräftigung des Lokalpatriotismus trug dazu bei, das Erbe der Vergangenheit vor dem etatistischen Projekt zu schützen, die Gesellschaft dem Impuls der Uniformität zu unterwerfen. Die Befürworter der Vielfalt im 18. und 19. Jahrhundert versuchten, der homogenisierenden Tendenz entgegenzuwirken, dem Denken und Verhalten Uniformität aufzuerlegen. Zu dieser Zeit versuchten die Gegner der Uniformierungstendenz der Moderne, einen Raum für Ermessensfreiheit und Urteilsvermögen zu schaffen.
Künstliche Diversität
Offensichtlich hat sich die Bedeutung von Vielfalt in den letzten 250 Jahren grundlegend verändert. In der Vergangenheit ging die Bejahung von Unterschieden Hand in Hand mit der Würdigung organischer Bindungen, die die Gemeinschaften mit ihren Vorfahren verbanden. Unterschiedliche lokale Bräuche und Praktiken waren historisch verwurzelt und spiegelten die selbstverständlichen Werte wider, die in den lokalen Gemeinschaften vorherrschten. Die heutige Version der Vielfalt ist abstrakt und oft administrativ erzeugt. Sie wird häufig von oben verordnet und durch Regeln und Verfahren bestätigt. Der künstliche Charakter der Vielfalt zeigt sich darin, dass sie sich auf rechtliche und quasi-rechtliche Instrumente stützt. Es gibt ein wahres Heer von Bürokraten und Aufsehern, deren Aufgabe darin besteht, die Regeln für Vielfalt durchzusetzen. Der unnatürliche und künstliche Charakter der Vielfalt wird durch die Tatsache verdeutlicht, dass sie gelehrt werden muss. Spezielle Kurse und Workshops – in vielen Fällen verpflichtender Art – sollen das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Wahrung der Vielfalt schärfen.
Die heutige, administrativ auferlegte Vielfalt unterscheidet sich auch insofern von ihrer ursprünglichen Version, als ihre Akzeptanz obligatorisch und nicht ermessensabhängig ist. Wie bereits erwähnt, war die Vielfalt im 19. Jahrhundert eng mit der Praxis der Unterscheidung und der Wertschätzung von Ermessen und Urteilsvermögen verbunden. Seit ihrer Entstehung als grundlegender Wert wird Vielfalt häufig als Gegenmittel gegen Diskriminierung und Ermessensentscheidung dargestellt, mit der Begründung, dass diese Handlungen ausschließend und falsch seien.
„In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren erhielt die Vielfalt eine ideologische Bedeutung. Die wichtigste Triebkraft dieser Entwicklung war die Politisierung der Identität.“
In den 1950er Jahren wurde die Vielfalt als Waffe gegen den Hang zum Urteilen, Diskriminieren und Unterscheiden instrumentalisiert. Psychologen stellten die Neigung zur Vielfalt oft als moralisches Gegenteil von Vorurteilen dar. In einem bekannten Klassiker aus den 1950er Jahren, „The Authoritarian Personality“, zogen die Autoren um Theodor Adorno einen moralischen Gegensatz zwischen der „Bereitschaft, Unterschiede und Vielfalt einzubeziehen, zu akzeptieren und sogar zu lieben" und „der Notwendigkeit, klare Grenzen zu ziehen und Über- und Unterlegenheit festzustellen". Bei denjenigen, die darauf beharrten, Linien und Grenzen zu ziehen, und sich weigerten, die Vielfalt zu lieben, wurden ein autoritärer Charakter diagnostiziert. Sie wurden als moralisch minderwertig gegenüber ihren integrativen Altersgenossen dargestellt.4
In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren erhielt die Vielfalt eine ideologische Bedeutung. Die wichtigste Triebkraft dieser Entwicklung war die Politisierung der Identität. Die Erosion des Gefühls der nationalen Einheit und der Solidarität schuf die Voraussetzung für eine soziale Fragmentierung. In dieser neuen zersplitterten sozialen Landschaft versuchten verschiedene Gruppen von Minderheiten, sich durch die Politisierung ihrer Identität zu legitimieren. Die Identitätspolitik entwickelte eine parasitäre Beziehung zur vorherrschenden Tendenz der sozialen Fragmentierung. Durch die Idealisierung von Vielfalt konnten sie Inklusion fordern. Auf diese Weise konnten diese Minderheiten ihre Identität stärken und Zugang zu Ressourcen erhalten.
Die Politisierung der Vielfalt machte sie zu einem Dogma, das nicht in Frage gestellt werden durfte. Jede Kritik an der Vielfalt zog den Vorwurf der Diskriminierung und des Vorurteilbehaftung nach sich. Der Philosoph Christopher Lasch war einer der ersten, der die zersetzende und autoritäre Dimension des Ethos der Vielfalt erkannte. Bereits 1995 schrieb er in seinem Essay über die „Democratic Malaise“: „In der Praxis erweist sich die Vielfalt als Legitimation für einen neuen Dogmatismus, bei dem rivalisierende Minderheiten sich hinter einer Reihe von Überzeugungen verschanzen, die sich einer rationalen Diskussion entziehen. Die physische Segregation der Bevölkerung in abgeschlossene, rassisch homogene Enklaven findet ihre Entsprechung in der Balkanisierung der Meinungen. Jede Gruppe versucht, sich hinter ihren eigenen Dogmen zu verbarrikadieren".5
„Die Vielfalt hat sich als Feind der Toleranz erwiesen.“
Laschs Besorgnis über die Art und Weise, wie eine politisierte Vielfalt Segregation und die Balkanisierung der Meinungen hervorruft, hat sich als vorausschauend erwiesen. Die Vielfalt hat sich als Feind der Toleranz erwiesen. Ihre Ablehnung des eigenen Ermessens bedeutet eine Feindseligkeit gegenüber einer Debattenkultur. Sie verlangt Konformität mit ihren Idealen und schränkt die Ausübung der Freiheit, insbesondere der Meinungsfreiheit, ohne Zögern ein.
Universitäten als Vorreiter
In den Kultur- und Bildungseinrichtungen ist die autoritäre Dimension der Vielfalt am deutlichsten zu erkennen. Eine der wichtigsten Entwicklungen in der Campus-Kultur ist die zunehmende Tendenz, freie Meinungsäußerung und Vielfalt als widersprüchliche Werte darzustellen. Der Bericht „And Campus for All: Diversity, Inclusion and Freedom of Speech at U.S. Universities" (2016) von PEN America hob eine beunruhigende Entwicklung hervor, nämlich dass unter jüngeren Angehörigen des Lehrkörpers und unter Studenten der Wert der freien Meinungsäußerung vom dem der Vielfalt in den Schatten gestellt wird. Es wurde festgestellt, dass Campus-Kontroversen „zuweilen" dazu geführt haben, „dass einige Gruppen von Studenten den Wert der freien Meinungsäußerung an sich Frage stellen".
Das war im Jahr 2016. Heute stellen viele Aktivisten auf dem Campus nicht nur den Wert der freien Meinungsäußerung in Frage, sondern verurteilen sie auch als ein Instrument der weißen Vorherrschaft. Freie Meinungsäußerung wird häufig als Hate Speech denunziert.
„Die Forderung nach mehr Vielfalt geht mit der Forderung einher, die Rede- und Gedankenfreiheit einzuschränken.“
Seit der Jahrtausendwende stehen die Universitäten unter großem Druck, die scheinbar konkurrierenden Ansprüche von Vielfalt und freier Meinungsäußerung in Einklang zu bringen. Einige Universitätsspitzen behaupten ausdrücklich, dass freie Meinungsäußerung und Vielfalt widersprüchliche Werte sein könnten. Für Kanzler Ronnie Green von der University of Nebraska-Lincoln waren schon 2016 „unsere Überzeugungen zu Vielfalt und Integration […] nicht verhandelbar".
Wenn Vielfalt erst einmal so weit sakralisiert ist, dass der Glaube daran nicht mehr verhandelbar ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Intoleranz zu einem legitimen Standpunkt wird. Die Intoleranz gegenüber Andersdenkenden ist eines der Hauptmerkmale der Ideologie der Vielfalt des 21. Jahrhunderts. Deshalb kann von Vielfalt im Bereich der Ideen und Standpunkte keine Rede sein. Im Gegenteil, die Forderung nach mehr Vielfalt geht mit der Forderung einher, die Rede- und Gedankenfreiheit einzuschränken.
Vielfalt wird oft als ein Mittel zur Sensibilisierung für die Gefühle und Bedürfnisse verschiedener Gruppen von Menschen dargestellt. Ein nicht verhandelbarer Versuch, der Gesellschaft ein Dogma aufzuzwingen, hat jedoch nicht im Entferntesten etwas mit Sensibilität zu tun. Bei der Vielfalt geht es um die Ausübung von Kontrolle, weshalb sie zum Grundwert des neuen Autoritarismus geworden ist.