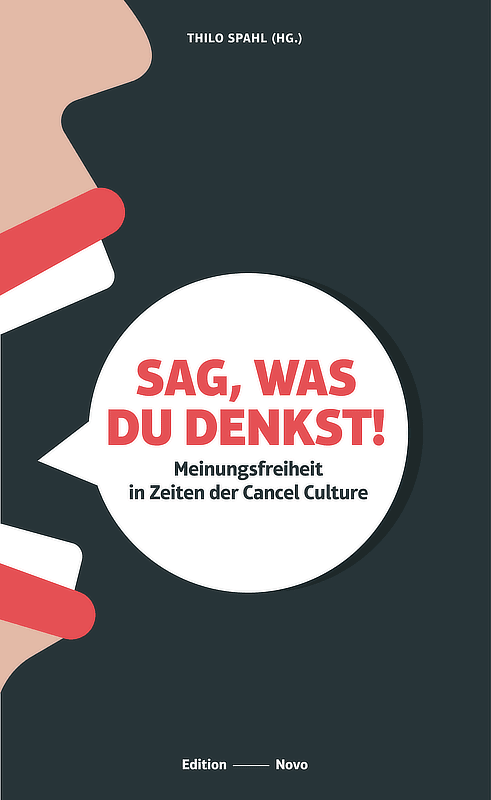09.08.2021
Schule als Safe Space?
Von Robert Benkens
Egal ob Migration, EU, Klima oder Corona: Stehen kontroverse Themen an, sind die moralisch korrekten Positionen oft klar. Schule muss bequemes Lagerdenken aber herausfordern.
„Bildung ist die Fähigkeit, fast alles anhören zu können, ohne die Ruhe zu verlieren oder das Selbstvertrauen.“ Von diesem Anspruch des Schriftstellers Robert Frost sind wir heute wohl weiter entfernt denn je. Wir erleben eine Retribalisierung politischen Denkens: Auf der einen Seite eine „Rude Culture“ „der alten weißen Männer“, auf der anderen Seite eine „Woke Culture“ der „Generation Snowflake“. Was beiden gemein ist: Kritik wird nicht als Anlass gesehen, die eigenen Annahmen zu überprüfen, sondern als aggressiver Angriff auf die eigene Identität. Alles wird dieser Identität untergeordnet – selbst Fakten. Die andere Seite wird nicht mehr als politischer Gegner gesehen, sondern als Feind. Political Correctness und Cancel Culture hier sowie Hate Speech und Fake News dort bilden zwei Seiten derselben Medaille eines sich vergiftenden Meinungsklimas – und sie treiben einander an.
Es ist nachvollziehbar, dass Schulen und insbesondere die politische Bildung in dieser an Geschwindigkeit aufnehmenden Polarisierungsspirale auf der richtigen Seite stehen wollen, vorsichtig agieren, vor Fake News und Hate Speech schützen und den Heranwachsenden ein solides Wertefundament mit auf den Lebensweg geben wollen. Dabei sollten sie allerdings aufpassen, dass der Anspruch, moralische Orientierung zu bieten, nicht in einer verkürzten Darstellung endet, in der eine zu verurteilende „populistische Position“ einer „moralischen Position“ gegenübergestellt wird.
Beispiel 1: Migration und Integration
Das erste Beispiel hierfür ist der Themenblock Migration und Integration. Auf der einen, rechten Seite stehen diesem dichotomen Weltbild nach nicht nur knallharte Nazis oder die pure Menschenfeindlichkeit, sondern auch unterschwellige Formen der Ausgrenzung. Dementsprechend sollen Schüler auf der anderen Seite für das Problem der Fremdenfeindlichkeit sensibilisiert werden, indem sie mit eigenen Vorurteilen konfrontiert werden, politisch nicht korrekte Sprache reflektieren oder sich in individuelle Fluchtgeschichten hineinversetzen. Alles richtig. Allerdings kann dies zu einer Emotionalisierung führen, in der jede rationale Abwägung von Interessen des Aufnahmelands oder Rückkopplungseffekte auf die Herkunftsländer als kalte Menschenfeindlichkeit erscheinen.
Diese vereinfachende Gegenüberstellung zeigt zwar wichtige Eckpunkte und Abwehrfronten auf, die pädagogisch geboten erscheinen – ein reiches und liberales Land muss es sich schließlich leisten können, Menschen, die vor Krieg, Hunger und Unterdrückung fliehen, Schutz zu bieten. Gleichzeitig wird diese Gegenüberstellung den vielen Zwischentönen nicht gerecht: So wichtig es ist, Empathie und Mitgefühl als Grundlage einer humanen Politik zu legen, und so richtig es auch ist, dass mit den wirklichen Rassisten kaum noch zu reden ist, so falsch ist der Ansatz, einen demokratietheoretischen, sozioökonomischen, soziokulturellen Themenkomplex wie Flucht und Migration nur auf das eine moralische Bekenntnis nach Offenheit und unbedingter Toleranz reduzieren zu wollen.
„Political Correctness und Cancel Culture hier sowie Hate Speech und Fake News dort bilden zwei Seiten derselben Medaille eines sich vergiftenden Meinungsklimas – und sie treiben einander an.“
Ja, Einwanderung und Vielfalt bereichern. Gerade Kulturen, die sich öffnen, haben Erfolg, nicht jene, die sich abschotten. Zumindest müsste aber diskutiert werden, wie diese Offenheit gestaltet werden sollte: Welche Kriterien sollte es für Einwanderung geben? Gar keine? Wenn schon eine falsche Frage wie nach der Herkunft oder ein rhetorisch nicht astrein formulierter Einwand gegen die Einwanderungspolitik einen pädagogisch-gesellschaftlichen Ächtungsmechanismus in Gang setzen, sorgt das eher für mehr Berührungsängste zwischen Gruppen, einen Rückzug der Skeptischen in digitale Meinungs- und Radikalisierungsblasen oder ein Abnicken sozial erwünschter Antworten. Eine gemeinsame Identifikation jenseits von ethnonationalistischen Homogenitätsillusionen und einem bloßen Diversitätsmanagement kommt so kaum zu Stande. Dabei wäre die Schule genau der Ort dafür.
Frankreich ist da ein mahnendes Beispiel: Wenn dort in den republikanischen Schulen Voltaires Religionskritik aus Angst oder falscher Rücksichtnahme gemieden wird, sagt das schon einiges über die doppelten Standards des Moralismus. Ahmad Mansour kennt ähnliche Berührungsängste auch aus deutschen Schulen und fordert ein umfangreiches Bildungsprogramm, um der Radikalisierung auf allen Seiten Einhalt zu gebieten. Diese Herausforderungen würden bei der Ausbildung oder der Erstellung von Lehrplänen kaum berücksichtigt. Neben der rechten Ausgrenzung sieht Mansour auch eine Sonderbehandlung „seiner“ muslimischen Herkunftscommunity von links, die dazu führe, dass man diese nicht nur vor Ausgrenzung schützen wolle, sondern „vor allem vor Kritik, weil wir ansonsten angeblich zerbrechen und nicht in der Lage sind, diese auszuhalten“. 1
Das Fördern benachteiligter Gruppen gerät zum Glück stärker in den sozialstaatlichen Fokus, um bestehende Bildungsungerechtigkeiten zu beheben. Dass aber nach den neuesten postmodernen pädagogischen Trends schon das Einfordern von Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft oder Wissenschaft und Mathematik als „weiße“ Relikte eines „eurozentrischsten Rassismus“ abqualifiziert werden, 2 ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern führt auch zu einer Nivellierung der Standards sowie zu einer Kultur der niedrigen Erwartungen gegenüber benachteiligten Minderheiten, wodurch sie erst recht den Anschluss verlieren. Was moralisch gut gemeint als eine Art „Nachteilsausgleich“ begann, verfestigt Unterschiede und Argwohn zwischen gesellschaftlichen Gruppen.
„So wichtig es ist, Empathie und Mitgefühl als Grundlage einer humanen Politik zu legen, so falsch ist der Ansatz, einen Themenkomplex wie Flucht und Migration nur auf das eine moralische Bekenntnis nach Offenheit und unbedingter Toleranz reduzieren zu wollen.“
Im Kampf dagegen können Initiativen wie „Schule ohne Rassismus“ wichtige Grundlagenarbeit leisten. Sie müssen sich den Realitäten eines multikulturellen Einwanderungslands wie Deutschland stellen. Dazu gehört, rassistische Ausgrenzung zu bekämpfen, die Vorzüge von Vielfalt sichtbar zu machen, aber auch aufzuzeigen, in welchen Fällen soziale Normen in Konflikt geraten mit dem Rechtsstaat oder den Freiheits- und Menschenrechten – und wie diese demokratisch, kultursensibel, aber ohne „Sonderbehandlung“ zu lösen sind. Konkret: Wenn ein Junge ein Mädchen als „Schlampe“ sieht, weil ihm ihr sommerliches Outfit zu westlich und freizügig ist, muss das dahinter liegende Weltbild genauso thematisiert werden wie in dem Fall, wenn jemand seine Mitschülerin diskriminiert, nur weil sie ein Kopftuch trägt.
Beispiel 2: EU und Brexit
Als zweites Beispiel kann die EU, genauer: der Brexit, angeführt werden. Das dominierende mediale Narrativ, das sich auch in Schulen wiederfindet, geht in etwa so: Die Briten haben sich von Rassisten und Europafeinden anstacheln lassen und in einem Akt kollektiver Psychose für den Austritt aus der EU gestimmt.
Demgegenüber stehen die „überzeugten Europäer“, die die Europäische Union postheroisch gegen nationalistische Engstirnigkeit verteidigen und konstatieren, Nationalstaaten könnten globale Probleme nicht mehr allein lösen. Flankiert wird diese nicht grundsätzlich falsche, aber lückenhafte Europa-Erzählung von zahlreichen Lernmaterialien oder Besuchen bei EU-Institutionen.
Schüler sollten das in vielen Medien vorherrschende Demokratieverständnis im Unterricht nicht einfach wiederholen, sondern hinterfragen: Wenn ein Abstimmungsergebnis mit den meisten je für eine Sache abgegebenen Ja-Stimmen in der Geschichte einer der ältesten Demokratien der Welt den „Pro-Europäern“ nicht passt, stimmen wir so lange ab, bis es „richtig“ ist? 3
Es ist völlig legitim, Schülern aufzuzeigen, was gegen den EU-Austritt spricht: Schließlich ist die Kooperation zwischen ehemaligen Erzfeinden, der wirtschaftliche und gesellschaftliche Austausch und die längste Wohlstands- und Friedensperiode auf europäischem Boden wirklich eine erfolgreiche Story. Diese aber mit einem moralischen Automatismus in Richtung einer „Ever Closer Union“ inklusive Schulden- und Haftungsunion zu verknüpfen, scheint gerade angesichts der „Neins“ in den Verfassungsreferenden Irlands und Frankreichs sowie des Zwists, den der Euro auch zwischen den Ländern gebracht hat, diskussionswürdig. Schüler zu „überzeugten Europäern“ zu erziehen, sollte nicht bedeuten, sie zu kritikscheuen Fans von Brüssel zu machen.
„Schüler zu ‚überzeugten Europäern‘ zu erziehen, sollte nicht bedeuten, sie zu kritikscheuen Fans von Brüssel zu machen.“
Statt auf den Brexit mit Arroganz zu reagieren, sich in klammheimlicher Freude über ein „Brexit-Chaos“ zu ergehen, sollte man ihn zum Anlass grundsätzlicher Selbstkritik nehmen: Welches Demokratieverständnis lehren wir, wenn der Wunsch der Briten nach „take back control“ nur als provinzieller Nationalismus abgetan wird, während Grundsatzentscheidungen immer weiter weg vom Souverän an demokratisch schwach legitimierte Institutionen wie die Europäische Kommission ausgelagert werden? Zumindest in Sachen Impfen konnte Großbritannien flexibler und deutlich schneller agieren als eine schwerfällige EU – an deren Spitze eine im Hinterzimmer gekürte ehemalige deutsche Verteidigungsministerin mit fragwürdiger Bilanz im Beschaffungswesen der Bundeswehr steht.
Beispiel 3: Klimaaktivismus
In wohl kaum einem anderen Bereich ist Vermischung von journalistischer Berichterstattung, moralistischer Parteinahme und pädagogischem Impetus so groß. Zahlreiche Medien schlossen sich der „Covering Climate Now-Initiative“ 4 an, die Zeitschrift Stern ließ Fridays for Future gleich die Redaktion für ein Heft übernehmen 5 und zahlreiche Wissenschaftler verstehen sich zunehmend als Aktivisten. Folgerichtig gibt es neben Fridays for Future auch Scientists for Future, Parents for Future und Teachers for Future.
Neben der Begeisterung für politisches Engagement wäre es jedoch auch Aufgabe von Lehrkräften, einer Jugendbewegung – und sei sie den eigenen Standpunkten noch so nah und sympathisch – nicht nur zu bejubeln, sondern auch Grundannahmen und Lösungsansätze kritisch zu prüfen. Es ist bezeichnend, dass sich die Kritiker darauf beschränkten, dass die Jugendlichen doch auch samstags demonstrieren könnten. Zu übermächtig scheint das kapitalismus- und wachstumskritische Narrativ inzwischen zu sein.
Nehmen wir Bangladesch 6: Obwohl sich die Bevölkerung des flächenmäßig recht kleinen Landes von 50 auf rund 150 Millionen verdreifacht hat, ist der Anteil der in extremer Armut lebenden Menschen von etwa 45 Prozent im Jahr 1990 in nur 25 Jahren auf ungefähr 15 Prozent gefallen, dank modernisierter Landwirtschaft explodierten die Reis- und Weizenerträge geradezu, während der dafür notwendige Landverbrauch von 80 Prozent der Agrarfläche auf 70 Prozent ebenso gesunken ist wie die landwirtschaftlich genutzte Fläche pro Kopf insgesamt, was wiederum ermöglichte, dass die Waldfläche in etwa gleich bleiben konnte. Berücksichtigt man, dass mit steigendem Wohlstand auch die Geburtenraten Bangladeschs sich derjenigen westlicher Länder annähern, kann der Flächenverbrauch weiter reduziert und womöglich aufgeforstet werden. Noch wichtiger sind aber die menschlichen Indikatoren: Die Kindersterblichkeit ist erfreulicherweise von unglaublichen 35 Prozent 1950 auf unter fünf Prozent 2016 gefallen, während gleichzeitig die durchschnittliche Lebenserwartung von 39 auf fast 72 Jahre gestiegen ist. Kinderarbeit ist von 17 Prozent 2003 auf heute etwa fünf Prozent gesunken. Und auch die Zahl derjenigen, die aufgrund von Naturkatastrophen umkommen, hat einen historischen Tiefstand erreicht. Die Treiber dieser großartigen Entwicklung sind Technologietransfer, Freihandel und Wirtschaftswachstum.
„Neben der Begeisterung für politisches Engagement wäre es jedoch auch Aufgabe von Lehrkräften, einer Jugendbewegung – und sei sie den eigenen Standpunkten noch so nah und sympathisch – nicht nur zu bejubeln, sondern auch Grundannahmen und Lösungsansätze kritisch zu prüfen.“
Statt solche Entwicklungstrends zu analysieren, werden viele Schüler mit apokalyptischen Bildern aus Bangladesch konfrontiert oder lesen „Arbeitsmittel zum globalen Klimawandel“ 7 von NGOs wie Germanwatch. Zwar ist das, was gezeigt wird, selten grundsätzlich falsch, schließlich wird mit Grafiken, Prognosen und Expertenstimmen gearbeitet. Aufschlussreich ist aber, was nicht gesagt wird: Von den oben genannten Trends findet sich kaum ein Wort.
In seinem Artikel „Wie Medien einer Umweltorganisation auf den Leim gehen“ 8 legt Axel Bojanowski, Chefreporter des Ressorts Wissen bei der Tageszeitung Welt dar, wie politische Voreingenommenheit die kritische Überprüfung aushebelt: Leitmedien wie Tagesschau oder Spiegel beriefen sich auf eine „Studie“ der erwähnten NGO Germanwatch, nach der Dürre, Stürme und Überschwemmungen immer mehr zunähmen, vor allem in armen Ländern. Der Wissenschaftsjournalist bestätigt, dass der Klimawandel für eine globale Erwärmung sorge, Hitzewellen und Starkregen zunehmen, Gletscher schmelzen und Meeresspiegel steigen würden. Aber: Bei Stürmen oder Dürren sei hingegen kein klarer Trend erkennbar und vor allem könnten sich ärmere Länder aufgrund des zunehmenden Wohlstands besser schützen. Mit Ausnahme von Hitzewellen hätten sämtliche Wetterkatastrophen weniger Auswirkungen als früher. Er hat Recht: Während 1970 in Bangladesch beim Zyklon Bhola bis zu 500.000 Menschen ums Leben kamen, waren es letztes Jahr beim Super-Zyklon Amphan 118. Auch Klima 9- und Katastrophenforscher 10 bestätigen diese Trends. Die omnipräsenten Fehlkonzepte, auch bezüglich der Ursachen 11 und Entwicklung 12 von Waldbränden, müssten doch im Unterricht aufgedeckt werden.
Aber wie, wenn nicht nur viele Schüler, sondern selbst Erwachsene glauben, der Klimawandel 13 werde die Menschheit auslöschen? So wichtig die Aufklärung über die komplizierten Wechselwirkungen und potenziellen Probleme des menschengemachten Klimawandels auch ist, so pädagogisch fragwürdig erscheint ein unkritisches Wiederholen von Untergangsszenarien. Neben den wichtigen Unterrichtseinheiten zu gesicherten Fakten des Klimawandels könnte in anderen Stunden doch auch mal überprüft werden, was aus den zahlreichen „ganz sicheren“ Untergangsszenarien geworden ist, die hochrangige Experten und Intellektuelle in den letzten Jahrzehnten für unsere Gegenwart heraufbeschworen haben und mit denen Lehrergenerationen selbst aufgewachsen sind. 14
„So wichtig die Aufklärung über die komplizierten Wechselwirkungen und potenziellen Probleme des menschengemachten Klimawandels auch ist, so pädagogisch fragwürdig erscheint ein unkritisches Wiederholen von Untergangsszenarien.“
Hans von Storch 15, einer der renommiertesten Klimaexperten, Mitautor an IPCC-Berichten (Intergovernmental Panel on Climate Change, Weltklimarat), Mitbegründer des Exzellenzclusters zur Klimaforschung an der Uni Hamburg und Träger des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse für seine Klimaforschung, kritisiert diesen Alarmismus. Selbst der IPCC schreibt von mitunter großen Unsicherheiten bei der Folgenabschätzung des Klimawandels. 16 So werde beispielsweise projiziert, dass Veränderungen von Bevölkerung, Altersstruktur, Einkommen, Technologie, relativen Preisen, Lebensstil, Regulierung sowie politischer Steuerung und Koordination relativ größere Auswirkungen auf künftigen gesellschaftlichen Wohlstand hätten als der Klimawandel. Und überhaupt: Seit wann ist Angstpädagogik ein legitimes Mittel politischer Bildung?
In Schulmaterialien 17 wird der Klimawandel als Hauptursache für Desertifikation und das Elend in der Sahelzone angeführt, obwohl die armutsbedingte Überbevölkerung 18 und mangelnder Zugang zu einer effizienten Energie- und Landwirtschaft einen viel größeren Druck ausüben als der Klimawandel, der dort tatsächlich eher zu einer Ergrünung führt. 19 In einer Ausgabe 20 des Jugendmagazins fluter, das die Bundeszentrale für politische Bildung herausgibt, wird Schülern angesichts einer eindrücklichen Bebilderung mit kurzem Text nahegelegt, dass der pazifische Inselstaat Kiribati wegen des Klimawandels vor dem Sinken stehe – eine seit etlichen Jahren, unter anderem vom (Fälschungs-)Reporter Relotius im Spiegel, wiederholte Erzählung. Die Sache ist nur: Kiribati hat in derselben Zeit an Land zugelegt. Solche Richtigstellungen in kleinen Magazinen wie Salonkolumnisten 21 oder Novo Argumente sind jedoch nie so öffentlichkeitswirksam wie die ursprünglichen Storys in angesehenen „Qualitätsmedien“. Sie dringen kaum zu Lehrkräften durch.
Natürlich gibt es auch andere Stimmen, aber in der Fülle der Informationsangebote leider schlicht untergehen. So hat die Bundeszentrale im selben Jahr in der Fachzeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte eine Ausgabe zum Thema „Klimadiskurse“ 22 mit erfrischend neuen Perspektiven herausgegeben:
„Alte Fragen werden mit neuem Nachdruck diskutiert: Wie lässt sich die Reduktion klimaschädlicher CO2-Emissionen effektiv umsetzen? Welche politischen Weichenstellungen sind prioritär? Welche Rolle können marktwirtschaftliche Mechanismen beim Klimaschutz spielen? Und was tragen Verhaltensänderungen auf individueller Ebene bei? Zugleich wird die Klimadebatte selbst mit Blick auf die sie auszeichnenden Katastrophenszenarien, Verzichtsaufforderungen und verkürzten Darstellungen von Zusammenhängen kritisch reflektiert.“
„In Schulmaterialien wird der Klimawandel als Hauptursache für Desertifikation und das Elend in der Sahelzone angeführt, obwohl die armutsbedingte Überbevölkerung und mangelnder Zugang zu einer effizienten Energie- und Landwirtschaft einen viel größeren Druck ausüben als der Klimawandel.“
Neben Unterrichtsmaterialien von Greenpeace oder ähnlichen NGOs bräuchte es mehr von solchen. Schulen wehren diese anderen Perspektiven nicht kategorisch ab. Sie müssen eben nur eingebracht werden. Momentan ist der Diskurs von moralisierenden Appellen dominiert. Niemand will als „Unmensch“ dastehen. Moralische Appelle sind wichtig, um Themen auf die Agenda zu setzen, sie ersetzen jedoch nicht die ökonomische Analyse: So ist es zwar toll, wenn sich Klimaaktivisten mehr Verzicht auferlegen oder grundsätzlich fordern – schließlich haben sie im Schnitt mehr Flugmeilen 23 zu verbuchen als der Normalbürger. Allerdings macht der Verzicht auf Fleisch mit etwa vier Prozent 24 oder Fliegen mit etwa drei Prozent 25 nur einen Bruchteil der Gesamtemissionen aus. Das Problem ist grundlegender: Unser gesamter zivilisatorischer Standard hängt vom Zugang zu hochleistungsfähigen, zuverlässigen und kostengünstigen Energieträgern ab. Der Erfinder des „Zwei-Grad-Ziels“ und Nobelpreisträger für Klimaökonomie William Nordhaus stellt fest: 26 Eine „radikale“ Verzichtspolitik verursacht immense Kosten, ein ökonomisch durchdachter Klimaschutz muss hingegen nicht teuer sein. 27
Das Paradoxe 28: Selbst wenn die ganze EU keine fossilen Energien mehr nachfragen würde, könnte der Preis für diese Rohstoffe fallen, was deren Nutzung am anderen Ende der Welt noch attraktiver machen würde.
Länder nutzen fossile Energien nicht aus moralischer Niedertracht, sondern weil sie sich mit Sonne und Wind allein nicht aus Armut und Unterentwicklung befreien können. Oder um es in den Worten der Premierministerin Bangladeschs auszudrücken: „Wenn man die wirtschaftlichen Bedingungen seiner Bevölkerung nicht entwickeln kann, wie will man dann seine Bevölkerung retten?“ 29 Die alternativen Niedrigenergien brauchen viel Subvention, Material und Fläche. Mangels Speicher liefern sie oft zu viel Strom oder zu wenig, wenn er dringend benötigt wird. Dann müssen konventionelle Kraftwerke die Versorgung sichern. Ironischerweise ist das „Energiewendevorbild“ Deutschland deshalb weiter von der Dekarbonisierung des Stromsektors entfernt als technologieoffenere Industrieländer. Vom Verkehrs-, Wärme- und Industriesektor ganz zu schweigen. Der Anteil der Sonnen- und Windenergie am Primärenergieverbrauch weltweit lag 2019 bei 3,3 Prozent. 30
Wir brauchen also klügere Wege. Statt planwirtschaftlicher Subventions-, Verbots- oder moralisierender Lebensstilpolitik eine konsequente CO2-Bepreisung, die den marktwirtschaftlichen Entdeckungswettbewerb um die effizientesten Wege der CO2-Vermeidung in allen Sektoren in Gang setzt, befeuert von massiven Investitionen in ergebnisoffene Forschung und Entwicklung. So könnten Schüler von einer technik- und fortschrittsfreundlichen Bildungsoffensive profitieren, indem sie mit Ingenieuren über die neuesten Speicher- und Kraftwerkstechnologien sprechen, die zuverlässig, sicher und kostengünstig den Energie- und Wohlstandshunger der Welt befriedigen, ohne mehr CO2 zu emittieren. Dazu könnten sie die „Erntefaktoren“ von Energieträgern, die tatsächlichen CO2-Reduktionsbilanzen und -Vermeidungskosten unterschiedlicher Industrieländer vergleichen.
„Länder nutzen fossile Energien nicht aus moralischer Niedertracht, sondern weil sie sich mit Sonne und Wind allein nicht aus Armut und Unterentwicklung befreien können.“
Dass eine durchgängige Multiperspektivität im Unterricht eher die Ausnahme bildet, liegt jedoch nicht daran, dass die andere, (wirtschafts-)liberale Seite vom „linksökologischen“ Bildungsbetrieb kleingehalten würde, sondern daran, dass Liberale selbst einfach zu opportunistisch sind, ihre Positionen selbstbewusst sichtbar zu machen. An meiner Schule werden neue Perspektiven dankbar aufgenommen, was auch zu anregenden Diskussionen, einem fruchtbaren Austausch im Vorfeld von gemeinsamen Unterrichtsprojekten führt. Früher gab es im Zuge des „Marschs durch die Institutionen“ bestimmt viele Debatten in Lehrer- und Klassenzimmern zwischen konservativen alten Haudegen, forschen linken Lehrkräften und Schülern. Schulen sollten wieder mehr Raum für eine nonkonformistische Debattenkultur lassen.
Beispiel 4: Corona-Debatte
Was damit nicht gemeint ist, kann in der Corona-Debatte beobachtet werden: Angesichts von Verschwörungsdenken, antimoderner Wissenschaftsfeindlichkeit, Öko-Esoterik und Debattenverweigerung bei sogenannten „Querdenkern“ tappen viele auf der anderen Seite wieder in die Moralisierungsfalle: Gerade zu Beginn verbarrikadierten sich viele Parlamentarier, teilweise auch Wissenschaftler und Journalisten, in ihren Schützengräben und sahen ihre Aufgabe nicht primär in der Kontrolle der Regierung, sondern in der Maßregelung ungezogener Bürger. Statt unterschiedliche Wege offen in Parlament und Öffentlichkeit zu debattieren, wurde der Austausch angesichts medial allgegenwärtiger Katastrophenszenarien moralisch verunmöglicht. Wer gezieltere Maßnahmen vorschlug, da das durchschnittliche Alter 31 der Corona-Opfer etwa der durchschnittlichen Lebenserwartung entspricht, wurde wie ein Wehrkraftzersetzer behandelt – selbst angesehene Experten wurden in die Ecke der „Covidioten“ gerückt. 32
Während der Staat sich so auf dem Durchhaltewillen der Bürger und der bis dahin recht erfolgreichen Lockdown-Strategie ausruhen konnte, versagt er auch nach über einem Jahr bei allen proaktiven Maßnahmen wie Testen, Tracken, Impfen. 33
Loyalität schlägt Rationalität
Generationen von Schülern sind damit aufgewachsen, dass in einer Demokratie zu leben auch heißt, kritisch zu sein – gerade gegenüber Autoritäten. Deshalb wäre es angebracht, den Blick nicht immer nur nach unten zu richten, um Schüler gegen gefährliches Verschwörungsdenken zu immunisieren. Notwendig ist auch der Blick nach oben zu den Autoritäten. Immerhin bietet die Krise genug Lehrmaterial dafür, wie unsere demokratischen Sicherungsmechanismen Grenzüberschreitungen der Exekutive aufdeckten: Von dubiosen Maskendeals 34, teilweise unverhältnismäßigen Eingriffen in wirtschaftliche und persönliche Freiheitsrechte 35, über Absprachen 36 des Gesundheitsministeriums mit Internetkonzernen zur Priorisierung von Regierungsmeldungen im Meinungsmarkt bis hin zu handfesten Skandalen um die Instrumentalisierung „der“ Wissenschaft zur Legitimation der eigenen Lockdown-Politik oder zur Verbreitung von Angstszenarien durch Mao-Verehrer 37.
„Notwendig ist auch der Blick nach oben zu den Autoritäten. Immerhin bietet die Krise genug Lehrmaterial dafür, wie unsere demokratischen Sicherungsmechanismen Grenzüberschreitungen der Exekutive aufdeckten.“
Man stelle sich vor, Trumps Regierung hätte „die“ Wissenschaft erfolgreich zu „maximaler Kollaboration“ 38 aufgerufen! Trump verharmlost das Virus? Gelächter und Kopfschütteln – zu Recht. Die USA haben bereits im Mai 2020 Operation Warp Speed verkündet, in Großbestellung von Impfdosen investiert? Peinliche Ruhe. Das zeigt: Politisches Loyalitätsdenken schlägt rationalen Austausch. Der schwedische Weg? „Vollkatastrophe!“, warnen die einen. „Vorbild!“, behaupten die anderen. Nein – schaut man sich die Sterblichkeit 39 im Jahresvergleich oder den Ländervergleich 40 an, muss man beiden Lagern widersprechen. Und warum hat das offene Florida 41 eine bessere Corona-Bilanz als Kalifornien mit mehreren harten Lockdowns? Fragen zulassen, Widersprüche aufdecken: Genau hier muss und kann Schule ansetzen.
Die aufgeführten Kritikpunkte bedeuten explizit nicht, dass Schüler einseitig indoktriniert würden. In den Grundsätzen des Beutelsbacher Konsenses 42 sind mit Kontroversitätsgebot und Überwältigungsverbot Grundsätze festgeschrieben, die ebendies verhindern sollten, und auch im Kerncurriculum des Fachs Politik-Wirtschaft sowie in den meisten Lehrwerken ist das Bemühen zu erkennen, mehrere Seiten zu einem Thema darzulegen. Allerdings begegnen wir nicht selten einem impliziten Lehrverständnis, das einer politischen Sozialisation im Medien- 43, Kultur- 44 und Bildungsbetrieb 45 entspringt und dazu führt, dass der Zugriff auf ein Thema eine moralistische Schlagseite bekommt.
Was politische Bildung leisten muss
Eine Antwort auf diese Moralisierungsfallen bedeutet nun nicht, dass sich Lehrkräfte auf die Rolle eines neutralen Unterrichtsorganisators zurückziehen sollten oder ihre Leidenschaft für die gute Sache aufgeben sollten. Im Gegenteil: Ein politischer Bildner, der selbst auch zeigt, dass er für sein Thema „brennt“ und bestimmte moralische Überzeugungen mitunter leidenschaftlich vertritt und im Unterricht diskutiert, kann ein guter „Sparringspartner“ für die Schüler sein, um die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen oder die eigenen Argumente zu schärfen. Dabei sollte aber der politische „Bias“ der Lehrkraft immer transparent gemacht und nicht hinter einem „Schleier“ vermeintlich moralischer Letztgültigkeit verborgen bleiben.
„Eine Antwort auf diese Moralisierungsfallen bedeutet nun nicht, dass sich Lehrkräfte auf die Rolle eines neutralen Unterrichtsorganisators zurückziehen sollten oder ihre Leidenschaft für die gute Sache aufgeben sollten.“
Das Bedürfnis, auf der „richtigen“ Seite zu stehen, darf die politische Urteilsfähigkeit nicht komplett überlagern. Hermann Lübbe analysierte diese Tendenz bereits 1987. 46 Schule sollte bei aller ausdrücklichen Unterstützung für einen Bildungsauftrag im Sinne des humanistischen Menschenbilds und moralischer Festigung nicht in die Moralisierungsfalle tappen, will sie junge Menschen zu den vielfach beschworenen mündigen Bürgern erziehen statt zu selbstgerechten Aktivisten hier, frustrierten Wutbürgern da – oder opportunistischen Mitläufern dazwischen. Schafft sie das nicht, richten sie sich in ihren jeweiligen Meinungsblasen ein – ob an der Uni, am Stammtisch oder im Internet – und entfernen sich immer weiter voneinander. Später canceln sie als Aktivisten dann alles vom Campus, was ihrem postmodernen Weltbild nicht entspricht oder grenzen als Reaktionäre im Alltag alle aus, die ihrem prämodernen Volksbegriff nicht genügen.
Sollte die Schule ein „Safe Space“ sein? Ja – und zwar für die offene, mitunter harte Debatte entlang fairer Spiel- und Argumentationsregeln, jedoch nicht im Sinne eines „Safe Spaces“, in dem die Schüler wie in einem Kokon davor geschützt werden, mit unliebsamen Meinungen konfrontiert zu werden. Dafür müssen wir aber ganz grundsätzlich das Politik- und Demokratieverständnis vom Kopf auf die Füße stellen: Weg vom Zerrbild einer zu betreuenden infantilen Masse, der man von oben mit therapeutischen Maßnahmen nur die Einsicht in die alternativlos feststehenden „richtigen Dinge“ vermitteln müsse. Hin zum aufklärerischen Leitbild des zur Eigenverantwortung, zu gruppenübergreifender Solidarität, zur Mündigkeit und Kritik fähigen und selbstbewussten Mitbürgers.
Wie dargelegt, sollte die politische Bildung argumentative Kohärenz, Evidenz und grundsätzliche Offenheit einfordern. Das ist ein hehres Ziel, aber erstens nicht alles und zweitens schwer, konsequent umzusetzen. Denn kein Mensch ist frei von politischen Voreinstellungen und Irrtümern – auch und gerade Lehrkräfte nicht. Was wir also zusätzlich brauchen, ist eine tolerante Fehlerkultur, in der das Revidieren bisheriger Meinungen oder das Einsehen von Irrtümern (vor)gelebt wird. Wenn Schulen ihren Bildungsauftrag wirklich ernstnehmen wollen, und das sollte insbesondere auf die politische Bildung zutreffen, muss konsequent das Ziel verfolgt werden, die Spirale aus moralistischer Empörung und populistischer Enthemmung zu durchbrechen.