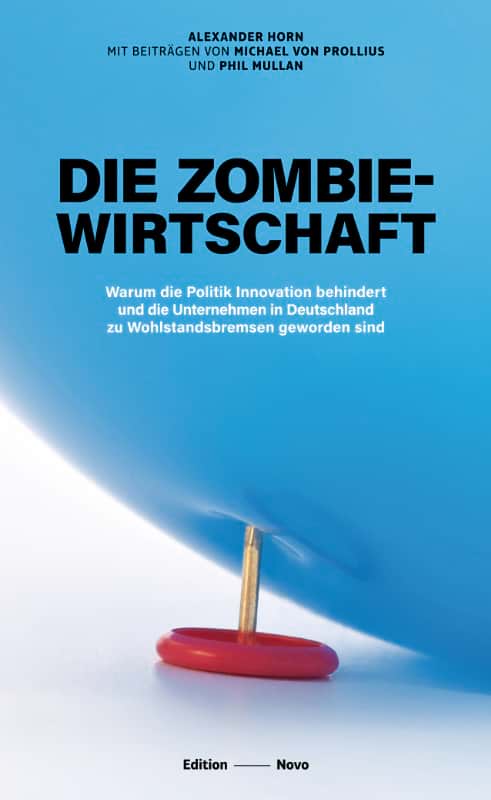10.10.2025
Großbritannien vor dem Kollaps?
Von Phil Mullan
Im Gegensatz zur Labour-Partei in den 1970er Jahren haben Premier Starmer und seine Finanzministerin keine Ahnung, wie sie Großbritannien aus der katastrophalen Wirtschaftslage herausführen können.
Finanzministerin Rachel Reeves wird den 26. November im Blick haben. An diesem Tag wird sie einen vorlegen, was manche als Krisenhaushalt bezeichnen. Kein Wunder, denn die finanzielle und wirtschaftliche Lage Großbritanniens ist katastrophal. Mehrere Regierungen in Folge haben sich auf eine Wirtschaftsfantasie verlassen, nach der ein Land auf ewig über seine Verhältnisse leben kann. Die Staatsverschuldung (2,8 Billionen Pfund im März 2025) nähert sich nun schnell dem Wert des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP), ohne dass es einen konkreten Plan gibt, die Verschuldung zu beenden. Versteckt unter dem inzwischen zerfledderten Deckmantel der von Reeves so geliebten Fiskalregeln haben sich die sich die Regierungen geweigert, die Ausgaben an die Steuereinnahmen einer stagnierenden Wirtschaft anzupassen.
In letzter Zeit werden jedoch kritische Stimmen laut. Kommentatoren und Wirtschaftswissenschaftler betonen, dass die ständig wachsende Verschuldung untragbar sei. Sie verweisen auf die steigenden Zinsen, die Großbritannien für langfristige Staatsanleihen zahlt und die unter den G7-Industrienationen am höchsten sind. In den Medien wird dies als sich anbahnende „Anleihemarktkrise” diskutiert.
Das bedeutet, dass die üblichen Finanzkreditgeber – Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds und Banken im In- und Ausland – immer höhere Zinsen für Kredite an den britischen Staat verlangen. Zum Teil ist dies gerechtfertigt, um die relativ höhere Inflationsrate Großbritanniens auszugleichen. Es ist aber auch ein Beweis für die wachsende Besorgnis der Investoren über die wirtschaftliche Zukunft Großbritanniens. Sie können nicht länger ignorieren, dass es keinen kohärenten Plan der Regierung gibt, um die Verschuldung unter Kontrolle zu bringen.
Abwärtsspirale
Liam Halligan, Kolumnist beim britischen Telegraph und Moderator des Podcasts „Planet Normal“, geht davon aus, dass Großbritannien in einer Abwärtsspirale aus hoher Verschuldung und geringem Wachstum feststeckt. Nicht nur, dass es den aufeinanderfolgenden Regierungen nicht gelungen ist, die öffentlichen Finanzen nach den enormen Ausgaben für die Corona-Lockdowns wieder ins Lot zu bringen, die derzeitige Labour-Regierung befindet sich nun auch in der gefährlichen Lage, Kredite aufnehmen zu müssen, um bestehende Schulden zu bedienen.
Warum spricht Halligan von einer Abwärtsspirale? Weil die Zahlung der Zinskosten für bestehende Schulden die heutigen Kreditaufnahmen zusätzlich erhöht. Dadurch steigt die Höhe der ausstehenden Schulden, was tendenziell zu einer weiteren Inflation der Kosten für den Schuldendienst führt, wodurch noch mehr Kredite aufgenommen werden müssen. Und so weiter und so fort. Halligan weist darauf hin, dass die Regierung im letzten Jahr 148 Milliarden Pfund aufgenommen hat, was etwa fünf Prozent des BIP entspricht. Das ist schon besorgniserregend genug. Aber mehr als zwei Drittel dieses Betrags – 105 Milliarden Pfund – wurden allein für den Schuldendienst aufgewendet. Das ist fast doppelt so viel wie die Regierung für Verteidigung ausgegeben hat.
„Besonnene Ökonomen warnen, dass Großbritannien auf eine Schuldenkrise wie in den 1970er Jahren zusteuert – das heißt, dass die Anleiheinvestoren bald keine Kredite mehr vergeben könnten.“
Daher warnen Halligan und andere besonnene Ökonomen, dass Großbritannien auf eine Schuldenkrise wie in den 1970er Jahren zusteuert – das heißt, dass die Anleiheinvestoren bald keine Kredite mehr vergeben könnten. Kritiker behaupten, dass wir vor einer ähnlichen Situation stehen könnten wie die Labour-Regierung unter James Callaghan im Jahr 1976, als sie auf ein Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückgreifen musste. Dass einige Kommentatoren nun diese Analogien zur Krise von 1976 ziehen, ist verständlich. Es zeigt, wie schlecht es um die öffentlichen Finanzen heute steht. Aber wie so oft können solche Analogien die historischen Besonderheiten beider Krisen, damals und heute, verschleiern.
1976 und heute
In den vergangenen 50 Jahren hat sich viel verändert. In den 1970er Jahren beispielsweise galt Großbritannien als „kranker Mann Europas“, was das Land besonders anfällig für einen Boykott durch Finanzinvestoren machte. Heute jedoch ist Großbritannien kein Einzelfall mehr. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe ähnlich schwer angeschlagener Länder mit nicht tragfähigen Schulden – nicht zuletzt Frankreich und die USA. Beide haben noch höhere Schuldenstände und erwartete Haushaltsdefizite als Großbritannien. Außerdem sind sie politisch gleichermaßen nicht in der Lage, ihre Probleme zu lösen.
Großbritannien befand sich 1976 in einer Währungskrise und einer Krise der öffentlichen Finanzen. Damals blieb dem Land kaum eine andere Wahl, als sich an den weltweit anerkannten Rettungsanker IWF zu wenden, eine der wenigen Institutionen, die Großbritannien retten konnten. Seitdem hat der IWF an Ansehen verloren. Gleichzeitig hat die enorme Finanzialisierung der Weltwirtschaft viel mehr Liquiditätsoptionen für Regierungen geschaffen, die unter finanziellem Druck stehen.
Tatsächlich sind die globalen Finanzmittel heute viel größer als in den 1970er Jahren. Sie werden durch die weltweit erwirtschafteten Profite gespeist, die jedoch nicht für produktive Investitionen genutzt werden. Wie Ruchir Sharma in „What Went Wrong With Capitalism“ (2024) zeigt, entsprach der Wert der globalen Finanzmittel in den 1970er Jahren in etwa dem Wert der jährlich in der Weltwirtschaft produzierten Güter und Dienstleistungen. Heute haben die Finanzmärkte fast die vierfache Größe der Weltwirtschaft.
Diese aufgeblähten Finanzmittel müssen irgendwo geparkt werden. In einer sprudelnden Welt riskanter Anlagen können selbst britische Staatsanleihen als relativ sicherer Hafen erscheinen. Auch wenn es höchst unwahrscheinlich ist, dass die britische Regierung den IWF um Mittel bittet, und ihre Kreditkosten sicherlich gestiegen sind, könnte sie dennoch auf Mittel von privaten Investoren zurückgreifen. Dies soll die Situation, in der sich Großbritannien befindet, nicht rosarot malen. In mehrfacher Hinsicht befindet sich Großbritannien wirtschaftlich und politisch in einer viel schlechteren Lage als in den 1970er Jahren.
„Das Ausbleiben der stetigen Produktivitätssteigerungen ist der Grund für den heute stagnierenden Lebensstandard der Bevölkerung.“
Bekanntermaßen befinden sich die öffentlichen Finanzen Großbritanniens in einem schlechten Zustand. Ein noch größeres Problem stellt jedoch die schwache Produktivitätsentwicklung dar, die auf jahrzehntelang unzureichende Investitionen in moderne Technologien zurückzuführen ist. Dieser Investitionsmangel führt dazu, dass das Wachstum der Arbeitsleistung pro Stunde seit den 1970er Jahren stetig rückläufig ist. In den 1960er Jahren erreichte der jährliche Produktivitätszuwachs vier Prozent und damit seinen Nachkriegs-Höchststand. Seitdem ist er gesunken und erreichte in 1980er Jahren nur noch die Hälfte dieses Wertes. Nach der Finanzkrise 2008 brach das Produktivitätswachstum ein und heute liegt es nur noch geringfügig über Null.
Dies spielt eine entscheidende Rolle für die Fähigkeit Großbritanniens, Kredite aufzunehmen. Solange die Produktivität und die Wirtschaftsleistung stetig steigen, sind potenzielle Finanzierungsinstitute eher bereit, Kredite zu vergeben – weil der Staat, an den sie Kredite vergeben, in der Lage sein wird, seine Kredite zu bedienen. Wenn nämlich die gesamte Schuld zur Rückzahlung fällig wird, ist der Kredit voraussichtlich eine überschaubare Summe, da der wirtschaftliche Kuchen bis dahin viel größer geworden sein wird.
Selbst in den von Rezessionen, hoher Inflation und Unruhen geprägten 1970er Jahren stieg die jährliche Pro-Kopf-Produktion der britischen Bevölkerung real um mehr als ein Fünftel. Das entsprach zwar nicht ganz dem Produktivitätsniveau der 1960er Jahre, stellte aber in den Augen der Kreditgeber dennoch eine angemessene Wachstumsrate dar.
Heute ist diese Dynamik in der britischen Wirtschaft längst verschwunden. In den zehn Jahren bis 2024 stieg die Pro-Kopf-Produktion kaum an. Sie stieg über das gesamte Jahrzehnt hinweg um etwas mehr als sechs Prozent, was weniger als einem Drittel der Produktivitätssteigerungen der krisengeschüttelten 1970er Jahre entspricht.
Problem der Produktivität
Das Ausbleiben dieser stetigen Produktivitätssteigerungen, die seit der industriellen Revolution im frühen 19. Jahrhundert zu verzeichnen waren, ist der Grund für den heute stagnierenden Lebensstandard der Bevölkerung. Darüber hinaus hat der Rückgang des Produktivitätswachstums in den letzten 50 Jahren dazu geführt, dass dem Staat die notwendigen Mittel für die Modernisierung und Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur, der Versorgungsunternehmen und Dienstleistungen fehlen.
Kurz gesagt: Der Produktivitätsrückgang ist die Ursache und Grundlage für die Unfähigkeit des Staates und den Verfall der öffentlichen Dienstleistungen und der Infrastruktur. Das Problem des Produktivitätswachstums hat die Regierung vor ihre größte wirtschaftliche Herausforderung gestellt: den Umgang mit der noch nie dagewesenen Ausweitung der Staatsverschuldung in Friedenszeiten. Während der Produktivitätsrückgang das Ergebnis wirtschaftlicher Zwänge ist, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut haben, ist die düstere Lage der öffentlichen Finanzen etwas anderes – sie ist in erster Linie ein politisches Problem.
„Was auch immer man von den einzelnen Politikern halten mag, die in den 1970er Jahren und davor eine herausragende Rolle spielten, sie waren stets bereit, politische Führungsstärke zu zeigen.“
Seit den 1980er Jahren sind die Regierungen aller politischen Couleur der Realität des Produktivitätsrückgangs ausgewichen. Ob aus Wunschdenken, Dummheit, Selbstgefälligkeit oder Feigheit – diese Pflichtverletzung, diese Weigerung, sich dem Problem zu stellen, wurde durch die Bemühungen der Regierungen, die öffentlichen Dienstleistungen und Sozialleistungen aufrechtzuerhalten und auszuweiten, noch verschlimmert. Sie haben wirklich so getan, als spiele Geld keine Rolle. Hier haben wir es mit politischen Fehlentscheidungen zu tun, nicht mit wirtschaftlichem Schicksal.
In dieser Hinsicht befinden sich Großbritannien wie auch die meisten anderen fortgeschrittenen Industrieländer heute in einer viel schlechteren Lage als noch vor 50 Jahren. Was auch immer man von den einzelnen Politikern halten mag, die in den 1970er Jahren und davor eine herausragende Rolle spielten, sie waren stets bereit, politische Führungsstärke zu zeigen. Sie ließen sich von konkreten strategischen Visionen leiten.
Im Gegensatz dazu sind die Politiker von heute nur noch dem Namen nach Staatslenker. Der Journalist Matthew Syed, selbst Mitglied der Labour Party, fasst die Regierung unter Keir Starmer in der Sunday Times treffend zusammen: „Dies ist eine Regierung ohne Steuerruder, ohne Landkarte, ohne Kompass, ohne Vision, ohne Steuermann, ohne Ahnung.“
Zupackende Politiker vor 50 Jahren
Im Jahr 1976 erkannten Callaghan, der neu ernannte Vorsitzende der Labour Party, und sein Finanzminister Denis Healey klar die Ernsthaftigkeit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage Großbritanniens. Sie brauchten nicht wie die heutige Regierung Fiskalregeln oder Anweisungen vom Amt für Haushaltsverantwortlichkeit, um zu diesem Urteil zu gelangen. Unter ihrer Führung setzte die Regierung die Kürzungen der öffentlichen Ausgaben zur Reduzierung des Defizits fort, lange bevor sie Mitte Dezember die berühmte Absichtserklärung Großbritanniens an den IWF unterzeichnete.
Der qualitative politische Unterschied besteht darin, dass die Regierung damals aus eigener Verantwortung handelte, ihr eigenes Urteilsvermögen einsetzte und ihre eigene Führungsstärke unter Beweis stellte. Der IWF hat die Labour-Partei nicht „gezwungen“, ihre Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben durchzuführen. Zwar übten die US-Regierung und andere sicherlich Druck auf Großbritannien aus, seine kostspieligen Illusionen von postimperialer Größe aufzugeben und nicht mehr über seine Verhältnisse zu leben. Auch die Versuche aufeinanderfolgender britischer Regierungen, den internationalen Status des britischen Pfund zu erhalten, erwiesen sich als zunehmend belastend. Dennoch handelte die Callaghan-Regierung nach ihren eigenen Vorstellungen, tat das, was sie für das nationale Interesse hielt, und versteckte sich nicht hinter Anweisungen der Technokraten des IWF in Washington.
Es war damals nicht einmal so, dass ein IWF-Kredit etwas Ungewöhnliches gewesen wäre. Viele andere Länder, darunter auch Großbritannien, hatten zuvor Kredite vom IWF aufgenommen, obwohl das Kreditabkommen von 1976 das bis dahin größte war. Darüber hinaus ist die Vorstellung, dass der Kredit Großbritannien vor dem Staatsbankrott bewahrt habe, übertrieben. Der Vertrag von 1976 diente in erster Linie dazu, internationalen Investoren zu versichern, dass es der Regierung mit ihren Zielen ernst war. Er war eine Art Gütesiegel für potenzielle Kreditgeber. Der Kredit selbst wurde nur zur Hälfte in Anspruch genommen und bis Mai 1979 vollständig zurückgezahlt.
„Während der Krise von 1976 zeigten Callaghan und Healey eine Entschlossenheit und Zielstrebigkeit, die heute offensichtlich fehlt.“
Während der Krise von 1976 zeigten Callaghan und Healey eine Entschlossenheit und Zielstrebigkeit, die heute offensichtlich fehlt. Sie hielten trotz des Widerstands ihrer eigenen Abgeordneten und einiger Minister an ihrer Verpflichtung zu Ausgabenkürzungen fest. Und das, obwohl Labour nicht einmal über eine Mehrheit im Unterhaus verfügte. Das steht in starkem Kontrast zu Starmer und Reeves. Trotz ihrer ‚erdrutschartigen‘ Mehrheit von über 170 Sitzen Abstand zur Opposition kapitulierten sie fast augenblicklich angesichts des Widerstands gegen ihre bescheidenen Vorschläge zur Reform der Sozialleistungen.
Im September 1976 zeigte Callaghan keine solche Zimperlichkeit. Er trug den Kampf vor der Unterzeichnung des IWF-Kreditvertrags auf den Parteitag der Labour Party. Dort hielt er seine wegweisende Rede, in der er die politische Orthodoxie der Nachkriegszeit, nämlich die „keynesianische“ Theorie, dass staatliche Eingriffe durch Fiskal- und Geldpolitik den Kapitalismus stützen könnten, effektiv ablehnte. Callaghan scheute sich nicht, die harten Umstände offen anzusprechen.
Er erklärte den Delegierten, dass es notwendig sei, sich der harten Realität zu stellen, und mahnte: „Zu lange, vielleicht sogar seit dem Krieg, haben wir es aufgeschoben, uns grundlegenden Entscheidungen und grundlegenden Veränderungen in unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft zu stellen.” Er fuhr fort:
„Früher dachten wir, man könne sich aus einer Rezession herauskaufen und die Beschäftigung durch Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben ankurbeln. Ich sage Ihnen ganz offen, dass diese Option nicht mehr besteht, und dass sie, sofern sie jemals bestanden hat, seit dem Krieg jedes Mal nur dadurch funktioniert hat, dass sie eine größere Dosis Inflation in die Wirtschaft gepumpt hat, woraufhin als nächster Schritt ein höheres Maß an Arbeitslosigkeit folgte.“
Peter Jay, Wirtschaftsjournalist und späterer britischer Botschafter in den USA, bezeichnete Callaghans Rede als „die atemberaubendste öffentliche Erklärung seit dem ersten Brief des Heiligen Paulus an die Korinther“. Das mag etwas übertrieben gewesen sein – Jay war Callaghans Schwiegersohn und soll auch die wichtigsten Teile der Rede seines Schwiegervaters verfasst haben. Aber Callaghans Rede war zweifellos ein erfrischender, politisch mutiger Auftritt.
„Wir brauchen eine neue Generation von Politikern, die ihre Verantwortung ernst nehmen.“
Healeys Auftritt auf der Konferenz war vielleicht sogar noch dramatischer. Er sollte eigentlich zu einer IWF-Sitzung nach Manila fliegen, entschied sich jedoch in letzter Minute, seine Reise zu verschieben. Stattdessen requirierte er ein Flugzeug der Royal Air Force und flog nach Blackpool, um die Argumente seines Chefs zu unterstützen. Als er auf der Bühne der Konferenz erschien, inmitten von Buhrufen und allgemeiner Unruhe, verschaffte er sich schnell Gehör: „Ich komme nicht aus dem Finanzministerium. Ich komme von der Front.“
Ian Aitken, politischer Redakteur des Guardian, beschrieb Healeys Auftritt damals so: Er „ging in sich […] und brachte den Labour-Parteitag mit brachialer Gewalt dazu, die Bemühungen der Regierung zur Rettung des Pfunds uneingeschränkt und mit überwältigender Mehrheit zu unterstützen“.
Fazit
Was auch immer man von der Politik und den Maßnahmen des Teams Callaghan-Healey Ende der 1970er Jahre halten mag, ihre robuste politische Führung macht die Zaghaftigkeit und Ineffektivität von Starmer und Reeves deutlich. Sollte sich der IWF heute jemals einschalten, dann nur, weil Starmer und Reeves schwierige Entscheidungen an eine andere technokratische Institution weiterreichen, die noch weniger rechenschaftspflichtig ist als das Amt für Haushaltsverantwortlichkeit.
Die Bewältigung der gravierenden finanziellen Schwierigkeiten Großbritanniens ist ebenso eine politische wie eine wirtschaftliche Herausforderung. Sie erfordert einen Führungsstil, wie man ihn seit den 1980er Jahren nicht mehr gesehen hat. Sie erfordert die Bereitschaft, sich mit den Wählern auseinanderzusetzen und ihnen die harte Wahrheit zu sagen. Und sie erfordert Politiker, die entschlossen sind, schwierige Entscheidungen zu treffen.
Von der heutigen oberflächlichen, managementorientierten politischen Klasse können wir solche Eigenschaften nicht erwarten. Daher müssen die Briten solche Führungskräfte selbst hervorbringen. Wir brauchen eine neue Generation von Politikern, die ihre Verantwortung ernst nehmen. Die aufhören, sich ihrer Verantwortung zu entziehen, in der trügerischen Annahme, dass sie auf Dauer einen verschwenderischen Staat führen können. Denn früher oder später wird die brutale Realität ihre Fantasie zerstören.