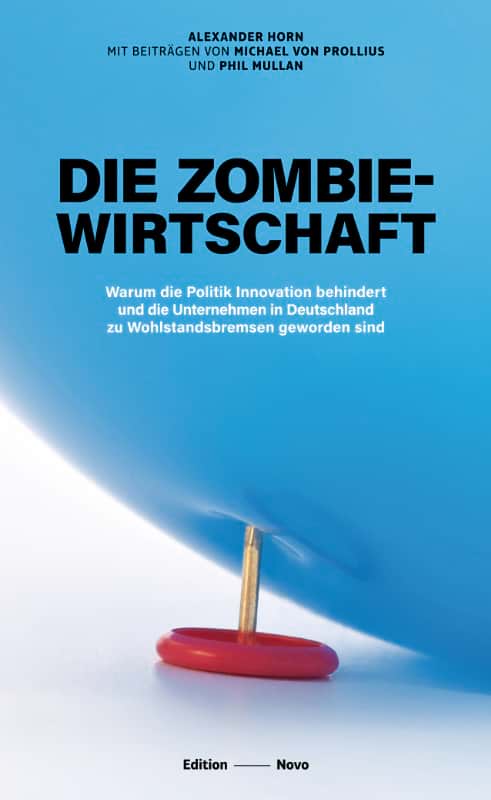24.03.2025
Geht der Westen unter?
Von Phil Mullan
Dass sowohl die Globalisierung als auch der Westen vor dem Ende stehen, diagnostizieren manche Beobachter. Dem liegen die Probleme der westlichen Eliten mit der Erosion ihrer Legitimität zugrunde.
Am 24. Februar schlossen sich die Vereinigten Staaten Russland an und stimmten gegen eine Resolution der UN-Generalversammlung, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilte. Dies war ein denkwürdiger Moment. Die USA hatten sich faktisch von ihren langjährigen transatlantischen und Nato-Partnern abgewandt, um sich dem Aggressor im Ukraine-Krieg anzuschließen.
Die UN-Abstimmung fand statt, kurz nachdem US-Präsident Donald Trump sich öffentlich gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewandt hatte. Er bezeichnete ihn als „Diktator“ und forderte die Ukrainer auf, den russischen Besatzern Gebiete abzutreten. Eine Woche später verübte die Trump-Regierung einen inzwischen berühmt-berüchtigten Angriff auf Selenskyj vor den Augen der Weltmedien. Dass sich Washington gegen die Ukraine wendet, legt den Schluss nahe, dass das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung, das lange Zeit ein Grundpfeiler der von den USA geführten Nachkriegsordnung war, für das Weiße Haus inzwischen von geringer Bedeutung ist.
Inmitten dieser weitreichenden diplomatischen Manöver hatte Trump Zeit, seine Drohungen zu verschärfen, 25-prozentige Zölle auf Importe aus der Europäischen Union zu erheben. Er geißelte Brüssel mit der nicht ganz zutreffenden Behauptung, dass „die Europäische Union gegründet wurde, um die Vereinigten Staaten abzuzocken“. Einige Tage später führte er angekündigte Zölle auf die beiden engsten Handelspartner Amerikas, Kanada und Mexiko, ein – die nun teilweise wieder ausgesetzt wurden – und erhöhte die Zölle auf China um weitere zehn Prozent.
„Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren“, wusste schon Wladimir Lenin. Doch dass die globalisierte Weltordnung innerhalb weniger Wochen zusammenbräche, wäre selbst für die Maßstäbe des bolschewistischen Führers ein Ereignis von großer Tragweite.
„Die geopolitischen und wirtschaftlichen Verschiebungen und Brüche, die Trump in den letzten Wochen in den Vordergrund gerückt hat, finden schon seit Jahren statt.“
Genau davon gehen zweifellos viele Beobachter der internationalen Politik aus. Die Direktorin des Think-Tanks Chatham House, Bronwen Maddox, erklärte, dass das Konzept des Westens als Bündnis liberaler Demokratien „wahrscheinlich“ vorbei sei. Michael Clarke, ehemaliger Generaldirektor des Royal United Services Institute, wurde noch deutlicher. „Der Westen ist tot“, sagte er. Unterdessen äußerte Marc Chandler, Chefstratege bei Bannockburn Global Forex, dass Trumps Politik „die Globalisierung beenden“ werde.
Scheideweg der Geschichte?
Westliche Politiker haben sich dieser Meinung angeschlossen. Der britische Premierminister Keir Starmer behauptet, wir befänden uns jetzt am „Scheideweg der Geschichte“. Der designierte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, Europa müsse „Unabhängigkeit“ von den USA erlangen. Problematisch an diesen Nachrufen auf den Westen, diesen Abschiedsreden auf die Weltordnung und die Globalisierung ist, dass sie davon ausgehen, in den letzten Wochen hätte ein entscheidender Wandel stattgefunden und wir stünden kurz vor dem Eintritt in eine neue Welt.
Das ist jedoch nicht der Fall. In Wahrheit finden die geopolitischen und wirtschaftlichen Verschiebungen und Brüche, die Trump in den letzten Wochen in den Vordergrund gerückt hat, schon seit Jahren statt. Und welche Form sich auch immer herausbilden mag, sie wird keinen vollständigen Bruch mit der Vergangenheit darstellen. Die Gegenwart und die Zukunft beinhalten immer Elemente der Kontinuität. Frühere Ursachen für Spannungen und Zwietracht lösen sich nicht einfach in Luft auf. Sie werden auch in Zukunft eine Rolle spielen.
Darüber hinaus spiegeln die aufkommenden untergangssüchtigen Ansichten und Vorhersagen des „Endes“ seitens unserer Eliten nicht einfach nur die objektive Realität wider. Vielmehr spiegeln sie in erster Linie die Ängste, Unsicherheiten und Zweifel wider, die in den Elitenzirkeln um sich greifen.
„Die verheerenden Auswirkungen des Ersten Weltkriegs lösten eine Krise des Selbstbewusstseins der Elite aus, die seitdem immer und immer wieder aufflammt.“
Vielmehr zeigt der Soziologe Frank Furedi in seinem Buch „First World War. Still No End in Sight“, dass die herrschenden Eliten des Westens seit weit über einem Jahrhundert eine existenzielle Krise durchleben. Die verheerenden Auswirkungen des Ersten Weltkriegs lösten eine Krise des Selbstbewusstseins der Elite aus, die seitdem immer und immer wieder aufflammt. Dies hat einen endlosen Kreislauf geopolitischer Nachrufe ausgelöst, von Oswald Spenglers „Der Untergang des Abendlandes“ aus dem Jahr 1917 bis zu Patrick Buchanans „Der Tod des Abendlandes“ aus dem Jahr 2001.
In ähnlicher Weise wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder der Tod der Globalisierung verkündet. Bereits im Jahr 2000 verfasste Alan Rugman ein inzwischen verstorbener Ökonom aus dem Bereich der Weltwirtschaft, „Das Ende der Globalisierung“. Es folgten in jüngerer Zeit das 2017 erschienene Buch „From Global to Local: The Making of Things and the End of Globalisation“ des mittlerweile ebenfalls verstorbenen Finbarr Livesey, das 2022 erschienene „Mapping the Collapse of Globalisation“ aus der Feder des geopolitischen Strategen Peter Zeihan und das Anfang letzten Jahres veröffentlichte Werk „Goodbye Globalisation: The Return of a Divided World“ von Elisabeth Braw.
Leere nach dem Ende des Kalten Kriegs
Tatsache ist jedoch, dass die Anerkennung der gefährlichen moralischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Lage des Westens lange auf sich warten ließ. Wenn wir einen wirklich entscheidenden Moment in dieser Geschichte benennen wollen, dann ist es der Fall der Berliner Mauer im November 1989. Solange der Kalte Krieg andauerte, hatten die politischen Führer des Westens noch eine große Stütze, die ihr Gefühl der Legitimität stützte. Sie konnten sich auf die negative Annahme verlassen, dass zumindest „ihr“ Kapitalismus moralisch und wirtschaftlich besser war als seine autoritäre und ineffiziente sowjetische „sozialistische“ Alternative.
Die Ereignisse von 1989 und der darauffolgende Zusammenbruch der Sowjetunion beseitigten diese Legitimationsquelle. Anstatt die Überlegenheit des westlichen Kapitalismus zu bestätigen, löste das sogenannte „Ende der Geschichte“ eine tiefgreifende Krise des eigenen Selbstverständnisses aus. Den westlichen Staats- und Regierungschefs war bewusst, dass das Ende des Kalten Krieges ihnen den Sinn ihres Handelns genommen hatte, aber den meisten fehlten die Fähigkeit und der Mut, sich dem zu stellen.
„Mit dem Verschwinden der Sowjetunion fehlte den Staaten des Westens ein klarer Feind.“
Außenpolitik-Experten gehörten zu den ersten, die auf einen Verlust an strategischer Klarheit hinwiesen. Mit dem Verschwinden der Sowjetunion fehlte den Staaten des Westens ein klarer Feind. Dies erschwerte die Definition und Verfolgung kohärenter außenpolitischer Ziele. Die bipolare Struktur des Kalten Krieges hatte eine einheitliche Zusammenarbeit zwischen den westlichen Verbündeten erzwungen, um der Sowjetunion entgegenzuwirken. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es weniger, was die vom Westen angeführte Ordnung zusammenhalten konnte. Seitdem die westlichen Staats- und Regierungschefs in der Schwebe sind, ist die Welt sowohl geopolitisch als auch wirtschaftlich zersplittert.
Populismus und andere Herausforderungen
Die Angst der Elite wurde durch den populistischen Aufstand der letzten Jahre weiter angefacht. Die Unterstützung für Anti-Establishment-Parteien und -Bewegungen aus der Bevölkerung hat das latente Bewusstsein der Eliten für ihren Mangel an Legitimität und politischem Auftrag weiter geschürt.
Trumps Wiederwahl mit einem noch deutlicheren Mandat als beim ersten Mal hat den westlichen Eliten tatsächlich das Gefühl verliehen, dass ihre Welt untergeht. Sie sind sich inzwischen im Klaren darüber, dass große Teile der Bevölkerung nicht wollen, dass sie so weitermachen wie bisher. Die Menschen haben genug vom derzeitigen Status quo. Sie haben genug davon, von einem realitätsfremden politischen Establishment ignoriert oder bevormundet zu werden.
Eine Reihe weiterer Ereignisse versetzten dem schwindenden Selbstbewusstsein des Establishments einen schweren Schlag. Vor dem Finanzcrash von 2008 hatten sich einige westliche Staats- und Regierungschefs der Illusion hingegeben, sie hätten die Zeiten von Wirtschaftskrisen hinter sich gelassen. Der Crash erschütterte dann ihr Vertrauen in ihre Fähigkeit, die Wirtschaft zu lenken. Es folgten eine Rezession und eine ungewöhnlich schwache Erholung. In Europa setzten sich die Turbulenzen mit der Schuldenkrise in der Eurozone fort.
„Geopolitisch gesehen ist die kurze Phase der Unipolarität der USA nach dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorbei.“
Nach den turbulenten 2010er Jahren hatten die angeschlagenen globalen Eliten von 2020 bis weit ins Jahr 2022 hinein mit einer globalen Pandemie zu kämpfen. Während der Pandemie verhängten sie Ausgangssperren, die die globalen Lieferketten empfindlich störten. Von diesem Zeitpunkt an galt die gegenseitige Abhängigkeit der Länder – als wesentlicher Bestandteil der Globalisierung – plötzlich als Risiko für alles Mögliche, von Medikamenten über Lebensmittel bis hin zu Teilen für ihre Industrien. Die westlichen Eliten begannen, über die Bedeutung von nationaler Widerstandsfähigkeit zu sprechen, was einer impliziten Ablehnung des Globalismus gleichkam, die sie einst begrüßt hatten. Nach dem Absturz und den Pandemie-Lockdowns startete Russland seine groß angelegte Invasion der Ukraine, was die bereits bestehende Energiekrise verschärfte.
Die Auflösung der elitären Selbsttäuschungen über dauerhaften Frieden und Wohlstand in Verbindung mit dem Aufkommen einer Masse rebellischer Wähler hat das Bewusstsein der Eliten tiefgreifend erschüttert. Ihre Schutzmauer der Selbstgefälligkeit wurde eingerissen. Und so sind wir nun wieder beim Endzeitgerede vom „Ende des Westens“ und dem „Tod der Globalisierung“ angelangt.
Geopolitik
Aber es gibt etwas, das wirklich zu Ende gegangen ist. Geopolitisch gesehen ist die kurze Phase der Unipolarität der USA nach dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorbei. Und trotz der Propheten des wirtschaftlichen Exzeptionalismus der USA ist es unwahrscheinlich, dass sie zurückkehrt. So ist der US-Anteil am weltweiten BIP (nach Kaufkraftparität) von 22 Prozent im Jahr 1990 auf den zweiten Platz im Jahr 2016 gesunken. Der Anteil der USA liegt nun unter 15 Prozent, während China auf 19 Prozent vorrückt.
Die USA sind mit ihrer großen Militärmaschinerie und dem Dollar, der immer noch als Weltreservewährung gilt, nach wie vor der größte Akteur der Welt. Aber sie sind jetzt ein Akteur neben vielen anderen. Diese Liste geht weit über China hinaus, obwohl es der wichtigste wirtschaftliche und technologische Herausforderer der USA ist. Zu nennen sind auch die in die Jahre gekommenen Mächte Europas. Die EU mag in allen Bereichen, von der Migration über die Klimaneutralität bis hin zum Ukraine-Krieg, gespalten und uneins sein. Aber einzelne europäische Länder erheben nach wie vor den Anspruch, als Weltakteure aufzutreten, insbesondere Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Auch Japan, ein Industriegigant des späten 20. Jahrhunderts, ist nach wie vor eine Nation mit einiger Schlagkraft. Und zu diesen können wir ein revanchistisches Russland hinzufügen.
Dann gibt es noch den ‚Aufstieg der anderen‘, eine Gruppe von Ländern der mittleren Ebene mit unterschiedlichem geopolitischem Einfluss, insbesondere innerhalb ihrer Regionen. Zu den aktivsten und wirtschaftlich stärksten Ländern mit Interessen über ihre nationalen Grenzen hinaus gehören Indien, Südkorea, Taiwan, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Südafrika, Israel, die Türkei, der Iran und Saudi-Arabien. Das ist eine ganz bunte Mischung von Interessen.
„Die heutige Welt der Nationen ist eine unbeständige, fließende und sich häufig verändernde Ansammlung internationaler Kombinationen und Gruppierungen.“
Wenn wir von einer „bipolaren“ oder sogar einer „multipolaren“ Welt sprechen, hat das den Pferdefuß, dass es der heutigen Unordnung etwas zu viel Beständigkeit und Dauerhaftigkeit verleiht. Die heutige Welt der Nationen ist eine unbeständige, fließende und sich häufig verändernde Ansammlung internationaler Kombinationen und Gruppierungen. Diese Unbeständigkeit wäre auch ohne ein launisches Weißes Haus vorhanden.
Wir können ein unterschiedliches Muster von meist informellen und manchmal formellen Bündnissen zwischen Nationen zu verschiedenen Themen erwarten. Wir haben dies bereits bei verschiedenen Gruppenbildungen gesehen, die sich im Kampf um die nationale Souveränität und das Überleben in Israel und der Ukraine gebildet haben. Wir sehen dies auch in der ungleichen Beteiligung, den Meinungsverschiedenheiten und den unklaren Zielen vieler bestehender multinationaler Gremien, von der G7 bis zu den Brics. Die Abwesenheit wichtiger Teilnehmer und der fehlende Konsens beim jüngsten G20-Finanztreffen im Februar in Südafrika zeigen, wie instabil die bestehenden internationalen Ordnungen tendenziell sind.
Eingriffe in den Welthandel
Darüber hinaus ist die Weltwirtschaft bereits stark angeschlagen. Der Global Trade Alert (GTA) ist die am häufigsten zitierte unabhängige Organisation zur Beobachtung der Handelspolitik. Sie wurde im Juni 2009 ins Leben gerufen, nachdem Bedenken laut wurden, dass nationale Regierungen im Zuge der Finanzkrise eine protektionistische Politik verfolgen, die auf Kosten ihrer Nachbarn geht.
Die GTA hat gezeigt, dass sich die durchschnittliche jährliche Zahl schädlicher Interventionen, die sich auf den Handel auswirken, zwischen dem Zeitraum von 2009 bis ‘11 (252 pro Jahr) und von 2017 bis ‘19 (724 pro Jahr) verdreifacht hat. Im letzten Dreijahreszeitraum (2022 bis 24) ist die Zahl der protektionistischen Aktivitäten erneut in die Höhe geschossen, auf durchschnittlich 2260 Interventionen pro Jahr. Das bedeutet fast eine Verzehnfachung seit der globalen Finanzkrise. Diese internationalen Spannungen werden zwangsläufig zunehmen, da westliche Regierungen versuchen, ihre angeschlagenen Volkswirtschaften wiederzubeleben.
„Handels-, Kapital- und Finanzströme werden sich einfach weiterhin an diese unbeständigere Welt anpassen.“
Die Globalisierung ist zweifelsohne holpriger und fragmentierter geworden. Die Differenzen in der Wirtschaftspolitik und die Spannungen zwischen den Ländern, nicht zuletzt innerhalb des alten Westblocks, haben sich verschärft. Gleichwohl ist das Szenario vom Ende der Globalisierung sicherlich übertrieben. Es gab keinen Zusammenbruch des internationalen Handels oder der Investitionen, der die Behauptung einer „Deglobalisierung“ stützen würde. Sowohl die Handelsströme als auch die ausländischen Investitionsbestände wachsen weiter, wenn auch nicht mehr so schnell wie in früheren Phasen. Der Anteil der ausländischen Direktinvestitionen an der Weltproduktion ist in den letzten drei Jahrzehnten trotz aller wirtschaftlichen Schocks ziemlich konstant gestiegen: von 10 Prozent im Jahr 1990 auf 32 Prozent am Vorabend der Finanzkrise, auf 40 Prozent im Jahr vor der Pandemie und auf 43 Prozent im Jahr 2023.
Es hat lange gedauert, bis sich grenzüberschreitende Verbindungen etabliert und verfestigt haben. Es wird auch einige Zeit dauern, bis sie sich ändern, sei es durch wirtschaftlichen Druck oder politische Entscheidungen. Globale, regionale und nationale Lieferketten werden nicht innerhalb weniger Monate aufgebaut. Sie sind komplex und wurden über Jahre, oft sogar Jahrzehnte hinweg errichtet. Selbst wenn politischer Druck ausgeübt wird, um Produktions- und Lieferketten wieder ins Inland oder in die Nähe des Inlands zu verlagern, wie wir es bei aufeinanderfolgenden US-Regierungen gesehen haben, ist das nicht so einfach. So erklärt der US-amerikanische Council on Foreign Relations: „Weitreichende staatliche Ambitionen – wie die Entwicklung strategischer Industrien und die Verlagerung von Lieferketten – werden Jahre in Anspruch nehmen, selbst wenn sich die Interventionen als äußerst erfolgreich erweisen.“
Ein bestimmtes Unternehmen kann die teure Entscheidung treffen, einen Teil seiner Produktionsabläufe in den USA wiederherzustellen, so wie es Apple oder Caterpillar getan haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen seine umfangreichen Investitionen im Ausland aufgegeben hätte oder dass es immun gegen Lieferketten im Ausland wäre. Dies zeigt, dass eine vollständige nationale Selbstversorgung in der Produktion und bei allen erforderlichen Komponenten eine Schimäre ist. Seit der Entwicklung der Weltmärkte ist kein Land vollständig autark. Handels-, Kapital- und Finanzströme werden sich einfach weiterhin an diese unbeständigere Welt anpassen.
Wandel im Handel
Die bestehenden wirtschaftlichen Trends zur Regionalisierung werden sich fortsetzen, vielleicht sogar mit etwas höherer Geschwindigkeit. Protektionistische Maßnahmen – einschließlich Subventionen, regulatorischer Hindernisse und Zölle – können grenzüberschreitende wirtschaftliche Interaktionen verändern. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass der Handel insgesamt zurückgehen wird. Es kann einfach zu anderen Handelsmustern kommen.
„Das Trump Derangement Syndrome der Eliten ist nicht hilfreich.“
Wir sind also nicht in ein „neues Zeitalter“ eingetreten. Und steigende Zölle allein werden uns auch nicht auf einen unaufhaltsamen Weg in den nächsten Weltkrieg führen. Aber es ist eine gefährlichere Welt, nicht zuletzt, weil die westlichen Staats- und Regierungschefs über das, was geschieht, so ratlos sind und noch nicht wissen, wie sie ihre nationalen Interessen bewerten und verfolgen sollen.
Das Trump Derangement Syndrome der Eliten ist dabei nicht hilfreich. Die politischen Entscheidungsträger sehen deshalb den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kommentatoren, die vor der Gefahr warnen, dass Trump einen Handelskrieg auslöst, sollten einen Moment innehalten und sich die Daten ansehen. Sie würden erkennen, dass er einen Trend des eskalierenden Protektionismus fortsetzt, der unter Präsident Barack Obama begann. Tatsächlich haben die USA zwischen 2009 und 2024 mehr schädliche Handelsmaßnahmen ergriffen als jede andere Nation.
Es ist Zeitverschwendung, verzweifelt über Donald Trumps Präsidentschaft zu jammern. Es befreit die politischen Entscheidungsträger aber von der schwierigen Aufgabe, tiefer und kreativer zu denken – sowohl darüber, wie man diese sich ständig verändernde Welt verstehen, und vor allem, wie man sie zum Besseren gestalten kann.