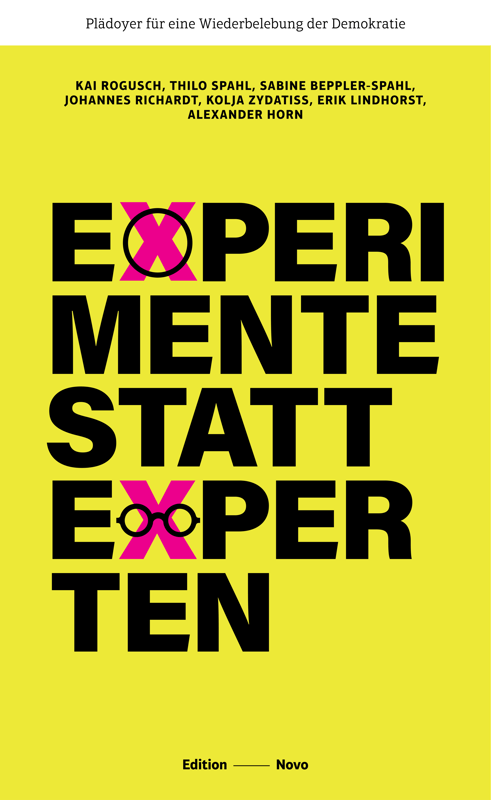02.10.2025
Ein schlechter Tag für die Demokratie
Von Alexander Horn
Mit Ann-Katrin Kaufhold hat der Bundestag eine Verfassungsrichterin gewählt, die politische Ziele mit Hilfe von Gerichten und Zentralbanken durchsetzen will.
Die Wahl von Verfassungsrichtern ist ein politischer Vorgang mit großer Tragweite. Im Grungesetz ist verankert, dass die insgesamt 16 Bundesverfassungsrichter von den gesetzgebenden Organen, also Bundestag beziehungsweise Bundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheiten zu wählen sind. Die Tragweite dieser Entscheidung erschließt sich daraus, dass die gewählten Verfassungsrichter dann Teil einer von der Politik unabhängigen Institution werden, deren Rechtsprechung für die anderen Verfassungsorgane – darunter Bundestag und Bundesrat – wiederum bindend ist.
Die Trennung zwischen Politik und Gerichten ist ein konstituierendes Prinzip liberaler Demokratien. Dementsprechend gibt es eine Gewaltenteilung zwischen den Gerichten und Rechtsprechung (Judikative) einerseits und der Politik mit gesetzgebender Funktion (Legislative) sowie ausführenden Organen, darunter die Bundesministerien, Bundesverfassungsschutz und Staatsanwaltschaften (Exekutive) andererseits. Die Gewaltenteilung soll Machtmissbrauch verhindern, indem sich die drei Gewalten gegenseitig kontrollieren und begrenzen.
Durch die nun vom Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken vollzogene Wahl von Ann-Kathrin Kaufhold zur Bundesverfassungsrichterin und deren anschließende Wahl zur Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts durch den Bundesrat, ist diese Gewaltenteilung jedoch in Frage gestellt. Denn, wie sich durch die öffentliche Diskussion um ihre Person im Vorfeld der Wahl gezeigt hatte, ist die von der SPD vorgeschlagene Bundesverfassungsrichterin hinsichtlich der Nutzung des Verfassungsgerichts zur Erreichung politischer Ziele nicht nur aufgeschlossen, vielmehr beansprucht sie sogar eine aktivistische Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Politikgestaltung.
„Durch die nun vom Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken vollzogene Wahl von Ann-Kathrin Kaufhold zur Bundesverfassungsrichterin ist die Gewaltenteilung in Frage gestellt."
Auf die Frage, wie die Klimazukunft aktiv zu gestalten sei, erklärte Kaufhold 2023 in einem Interview zu ihrem Forschungsprojekt „The Institutional Architecture for a 1.5 °C World“ an der LMU München: „Natürlich denkt man in solchen Fragen zunächst an Parlament und Regierung. Wir stellen aber leider fest, dass sie das Thema nicht schnell genug voranbringen. Deswegen muss man überlegen, wie man das Tableau der Institutionen erweitert.“ In den letzten Jahren seien die Gerichte auf den Plan getreten, „die deutlich machen, dass Klimaschutz auch eine menschenrechtliche Dimension hat“, und zum anderen die Zentralbanken. Hinzu komme eine Reihe anderer Institutionen, die man in Deutschland und auf europäischer Ebene für den Klimaschutz geschaffen habe. Explizit erwähnt sie den Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung, auf europäischer Ebene die Platform on Sustainable Finance und international das Network for Greening the Financial System, allesamt Institutionen ernannter und selbsternannter Experten, die über keine demokratische Legitimation verfügen und gegenüber dem Wahlvolk nicht rechenschaftspflichtig sind. Bei so vielen Akteuren könne man sich fragen, so Kaufhold weiter: „Wer macht es am besten, am effizientesten, am effektivsten? Und wie sollte das Zusammenspiel der Institutionen aussehen, damit sie sich möglichst gegenseitig stärken und nicht behindern?“
Kaufhold hegt offenbar nicht nur erhebliche Zweifel am politischen Prozess in einer Demokratie, vielmehr sieht sie dessen Dysfunktionalität sogar als erwiesen an, was sie dazu bewegt, Gerichte, Zentralbanken und nicht gewählten Expertengremien unter Umgehung der Demokratie zur Durchsetzung politischer Ziele in Anspruch nehmen zu wollen. Unumwunden erklärt sie, dass sie mit ihrem Forschungsprojekt die Frage beantworten wolle, wie man Institutionen schaffen könne, „die einerseits gesellschaftlichen Rückhalt haben und andererseits effektiven Klimaschutz ermöglichen“. Zwar könnten weder Parlamente, Gerichte, Zentralbanken oder andere Institution „auf Dauer gegen eine Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung agieren“ und Parlamente hätten den Vorteil, dass sie „politisch stark legitimiert“ seien, wohl aber sei es ein „Defizit von Parlamenten mit Blick auf den Klimaschutz […], dass sie auf Wiederwahl angewiesen sind.“ In der Folge tendierten sie wohl dazu, so Kaufhold weiter, „unpopuläre Maßnahmen nicht zu unterstützen“, während Gerichte und Zentralbanken unabhängig seien und sich daher „besser [eignen], unpopuläre Maßnahmen anzuordnen“.
EZB macht Politik
Die von Kaufhold propagierte Übertragung politischer Verantwortung an demokratieferne Institutionen, deren Personal nicht von Volk gewählt wird und somit den Bürgern gegenüber daher nicht rechenschaftspflichtig und abwählbar ist, ist keine Fiktion, sondern wird immer mehr zur gängigen Praxis. Sehr deutlich zeigt sich dies anhand der von ihr angesprochen Zentralbanken.
Um Wähler und Politik aus der Geldpolitik herauszuhalten, wurden die institutionellen Strukturen der Deutschen Bundesbank mit der Gründung der EZB auf diese übertragen. Dabei hat man – um die Macht nichtgewählter Zentralbanker zumindest einzuschränken – dieses Mandat strikt auf die Gewährung der Geldwertstabilität beschränkt. Gemäß Artikel 127 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU ist die Preisstabilität daher als das „vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken“ festgelegt. „Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist“, darf die EZB die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützen.
Mit dem Amtsantritt von Christine Lagarde als EZB-Präsidentin änderte sich dies. Sie kündigte sofort an, dass sie den Klimaschutz zur Aufgabe der EZB machen werde. Diese Ausweitung des EZB-Mandats begründete sie damit, dass der Klimawandel ihrer Auffassung nach die Stabilität des Finanzsystems bedrohe. Bei einer Anhörung im EU-Parlament im September 2019 hatte sie als oberstes Ziel der EZB die Preisstabilität genannt. Es sei aber dennoch legitim, weitere Ziele zu verfolgen. Und sie ließ nicht den geringsten Zweifel an ihrer Überzeugung, dass es ihr als EZB-Chefin obliegt, ihr Mandat selbst zu definieren: „Es gibt sekundäre Ziele, die nach meiner Überzeugung nicht sekundär sind. Und wenn Preisstabilität vorliegt, dann kann man sich auch weitere Ziele […] anschauen. Zum Beispiel kann die EZB gewiss das Ziel Umweltschutz mit aufgreifen.“ Mit dieser Selbstermächtigung zog die EZB ein politisches Mandat an sich, was ihr seitdem erlaubt, unbehelligt vom Wählerwillen Klimapolitik zu betreiben.
„Diese sowohl von der Politik als auch von Gerichten und der EZB gleichermaßen vorangetriebene Politisierung führt zu einer Aushöhlung der Demokratie und im Fall der Gerichte zudem zur Demontage der Gewaltenteilung. "
Die Instrumentalisierung der EZB für politische Zwecke ist jedoch keineswegs die Erfindung von Lagarde. Als es den Regierungen der Euroländer Anfang der 2010er Jahre nicht gelungen war, das aufgrund steigender Schulden zunehmende Risiko eines Zusammenbruchs der Eurozone zu verhindern, sprang die EZB in die Presche. Auf dem Höhepunkt der Eurokrise 2012 erklärte der damalige EZB-Präsident Mario Draghi die Vergemeinschaftung der Schulden der Euroländer, indem er sagte, die EZB werde „alles tun“, um die Eurozone zu retten. Da nun klar war, dass die „Länder zusammen [einstehen] für die Schulden der Angeschlagenen“, wie seinerzeit der Präsident der Schweizerischen Nationalbank kommentierte, beendete dies schlagartig die eskalierende Eurokrise.1 Gegen die Interpretation von Draghis Handeln setzte sich keine Regierung der Eurozone zur Wehr.
Die EZB lässt sich jedoch auch durch die Übernahme einer immer wichtigeren wirtschaftspolitischen Rolle instrumentalisieren. Seit langem beflügeln die Zentralbanken die Finanzmärkte und halten die wertschöpfende Wirtschaft durch das viele billige Geld zumindest am Ticken. Zudem verschaffen sie den Staaten durch niedrige Zinsen und den Kauf ihrer Staatsanleihen zusätzliche fiskalische Spielräume. Im Gegenzug halten die Regierungen der Euroländer und die Gerichte der EZB den Rücken frei, indem sie die politische Unabhängigkeit der EZB verteidigen und den Vorwurf von Mandatsüberschreitungen unter anderem durch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs kontinuierlich zurückweisen. Jürgen Stark, ehemaliger EZB-Chefökonom, kritisierte bereits vor vielen Jahren, dass die EZB unter Draghi „zu einer mächtigen, hochpolitisierten und damit auch angreifbaren Institution“ geworden sei.
Politische Inanspruchnahme der Gerichte
Die politische Inanspruchnahme von Institutionen, die im demokratischen Gefüge keinen politischen Auftrag haben, da sie nicht dem Votum der Wähler als Souverän der Demokratie unterliegen, lässt sich inzwischen auch bei den Gerichten und speziell beim Bundesverfassungsgericht erkennen.
Dass das Bundesverfassungsgericht mittlerweile zu tiefen Eingriffen in politische Zuständigkeiten bereit ist, zeigte sich am Klimaurteils des Bundesverfassungsgerichts von 2021, in dem die Richter die politische Verantwortung zur Klimaneutralität allein aus dem Grundgesetz ableiteten. Damit engen sie den zukünftigen Gestaltungsspielraum der Politik massiv ein, denn mit ihrem Urteil hoben sie die mit einfacher Mehrheit im Bundestag getroffene Verpflichtung zur Klimaneutralität Deutschlands in den Verfassungsrang, so dass sie ohne verfassungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit schwerlich korrigierbar ist.
Dieser richterliche politische Aktivismus wird dadurch verstärkt, dass das Grundgesetz und die Verfassungen der Bundesländer politisch aufgeladen werden. Dies geschieht auf Grundlage der seit 1949 sukzessiv hinzugefügten politischen Staatsziele, die den Staat verpflichten, diese nach seinen Kräften anzustreben und sein Handeln danach auszurichten. Hierzu gehören zum Beispiel die Verwirklichung eines vereinten Europas (Art. 23 Abs. 1 GG) oder der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Tierschutz in Verantwortung für die künftigen Generationen (Art. 20a GG).
Staatsziele beinhalten politische Zielsetzungen, die über die reinen Strukturprinzipien des Grundgesetzes, also die Festlegung auf eine Republik sowie das Demokratie-, Sozialstaats- Bundesstaats- und Rechtsstaatsprinzip hinausgehen. Sie sind handlungsleitend und können über die Rechtsprechung der Verfassungsgerichte ausgedehnt werden, was mit dem eben erwähnten Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021 geschah. In der vergangenen Legislaturperiode wollten SPD, Grüne und FDP gemäß ihrem Koalitionsvertrag „Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel“ im Grundgesetz verankern, wozu es nicht mehr kam. Nun hat der Bundesrat – als Versuch der Politisierung abseits der Staatsziele – eine Grundgesetzänderung initiiert, um die „sexuelle Identität“ in den Katalog der Diskriminierungsverbote des Artikels 3 des Grundgesetzes aufzunehmen.
Gerichte als politische Waffe
Diese sowohl von der Politik als auch von Gerichten und der EZB gleichermaßen vorangetriebene Politisierung führt zu einer Aushöhlung der Demokratie und im Fall der Gerichte zudem zur Demontage der Gewaltenteilung. Denn die Politisierung der Gerichte bedeutet, dass gegenüber den Wählern nicht rechenschaftspflichtige Zirkel politische Entscheidungen treffen und politisch agieren, obwohl sie kein politisches Mandat haben, während die Möglichkeiten der Bürger zur politischen Einflussnahme im gleichen Umfang beschnitten werden. Die Kehrseite der Politisierung der Gerichte ist die Verrechtlichung der Politik, da der dem Wahlvolk und den Parlamenten überlassene Entscheidungsraum durch Vorgaben von Richtern immer weiter eingeengt wird.
Kaufhold hat mit ihren öffentlichen Stellungnahmen sehr deutlich gemacht, dass sie der Politisierung des Bundesverfassungsgerichts keineswegs ablehnend gegenübersteht, sondern dass sie vielmehr eine Umgehung der politischen Prozesse sogar fordert. Es sei – wie oben zur Klimapolitik zitiert – ein „Defizit von Parlamenten […], dass sie auf Wiederwahl angewiesen sind“, weswegen sie überzeugt sei, dass „Parlament und Regierung […] das Thema nicht schnell genug voranbringen“ und man deshalb überlegen müsse „wie man das Tableau der Institutionen erweitert“. Es ist ihr ein Dorn im Auge, dass demokratisch fundierte politische Prozesse unterschiedliche Interessen berücksichtigen müssen und dass die ihrer Auffassung nach zu geringe Umsetzungsgeschwindigkeit der Klimapolitik nicht zuletzt politische Widerstände bei den Wählern zurückzuführen ist, die wegen der immer erkennbareren und einschneidenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieses Elitenprojekts entstehen.
„Kaufhold personifiziert richterlichen politischen Aktivismus und macht keinen Hehl daraus, dass sie die Instrumentalisierung des Bundesverfassungsgerichts für politische Zwecke sogar für notwendig hält."
Kaufhold personifiziert richterlichen politischen Aktivismus und macht keinen Hehl daraus, dass sie die Instrumentalisierung des Bundesverfassungsgerichts für politische Zwecke sogar für notwendig hält. Nicht etwa trotz, sondern offenbar wegen dieser exponierten Auffassungen hält die übergroße Mehrheit der Bundestagsabgeordneten von CDU/CSU bis zur Linken und derer Parteiführungen sie für eine Idealbesetzung als Bundesverfassungsrichterin, wie die innerhalb dieser Fraktionen völlig unumstrittene Richterwahl gezeigt hat. Die Unterhöhlung der Gewaltenteilung hat durch diese Entscheidung eine neue Qualität erreicht, denn was bisher eher schleichend und hinter vorgehaltener Hand geschah, erfolgt nun im grellen Licht der Öffentlichkeit.
Dass die Instrumentalisierung der Gerichte für politische Ziele inzwischen offenbar legitim erscheint und dass Bundesverfassungsrichter danach streben, politische Verantwortung zu übernehmen, öffnet der Nutzung der Gerichte als politische Waffe Tür und Tor. Um dem aufkommenden Populismus Paroli zu bieten, wurden kurz vor der diesjährigen Bundestagswahl institutionelle Vorkehrungen beim Bundesverfassungsgericht getroffen. Bisher einfachgesetzlich Geregeltes hat durch eine Grundgesetznovellierung nun Verfassungsrang und kann nur per Zwei-Drittel-Mehrheit geändert werden, was den Spielraum einfacher Mehrheiten weiter begrenzt. Umgekehrt wurde zugleich ermöglicht, politische Minderheiten, die mehr als ein Drittel der Wählerstimmen auf sich vereinigen, bei der Wahl der Bundesverfassungsrichter zu übergehen. Dies zeigt sich aber auch daran, dass Gerichte zur Bekämpfung politischer Gegner in Stellung gebracht werden und sich dafür instrumentalisieren lassen.
Mit dem in diesem Jahr von der SPD gefassten Parteitagsbeschluss sowie der Bundestagsinitiative der Grünen, ein Verbot der AfD durch das Bundesverfassungsgericht zu erwirken, setzen diese Parteien explizit auf die Roten Roben, um es als Waffe gegen den politischen Gegner einzusetzen. Anstatt den politischen Weg zu beschreiten, indem sie dem Wahlvolk – dem Souverän der Demokratie – höchstselbst die vermeintlich gegen das Grundgesetz und die Demokratie gerichteten Ziele der AfD im politischen Diskurs vermitteln um es für sich zu gewinnen, wollen sie den politischen Gegner unter Nutzung der Gerichte behindern oder sogar ganz ausschalten. Sie wollen politische Verantwortung an die Gerichte abgeben, in der Erwartung, dass sie sich dafür instrumentalisieren lassen entsprechend den politischen Zielvorgaben der Parteien zu entscheiden.
Indem jedoch Verbote eingesetzt werden sollen, um der politischen Auseinandersetzung und dem öffentlichen Meinungsstreit aus dem Weg gehen zu können, erhalten die Gerichte ein immer größeres Gewicht im Verhältnis zu dem, was politisch ausgefochten wird. Es ist also kein Zufall, dass die SPD mit Kaufhold eine aktivistische Richterin als Bundesverfassungsrichterin ausgerechnet für die Kammer vorgeschlagen hat, die für ein potenzielles AfD-Verbotsverfahren zuständig wäre – und dass sie nun mit breiter Mehrheit der Bundestagsabgeordneten von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken gewählt wurde.