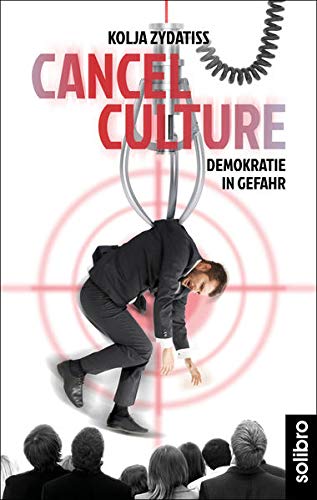03.12.2021
Die letzte demokratische Generation?
Von Kolja Zydatiss
Wie die religiöse Toleranz aus dem Alten Rom verschwand, droht heute die westliche Freiheit durch die Identitätspolitik unterzugehen. Dankesrede zur Verleihung des Ferdinand Friedensburg Preises.
Karl Marx, für mich einer der größten Geschichtstheoretiker und Sozialwissenschaftler, auch wenn ich seinen Schlüssen und politischen Zielen nicht immer folgen mag, schrieb 1846 in „Die Deutsche Ideologie“: „Jede herrschende Klasse ist genötigt, […] ihr Interesse als das gemeinschaftliche Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen, d. h. ideell ausgedrückt: ihren Gedanken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig vernünftigen, allgemein gültigen darzustellen.“1
Marx hatte Recht. Menschliche Gesellschaften können auch als Ideensysteme, Ideenkosmen betrachtet werden, deren herrschende Ideen ihren Mitgliedern oft grundvernünftig, allgemeingültig, universell erscheinen. Diese herrschenden Ideen oder Annahmen sind in fast alles, was die Menschen kulturell umgibt, „eingebacken“, wie Hefe in einen Brotteig, unter anderem in Schullehrpläne, Universitätsvorlesungen, Gesetzestexte, Zeitungsartikel, religiöse Predigten, sodass sie unveränderbar und unumstößlich erscheinen – „verdinglicht“, um eine weitere Formulierung von Marx zu verwenden.
Groß kann dann die Überraschung, der Schock sein, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse sich radikal verändern, die bestehende Ordnung kollabiert und durch eine neue gesellschaftspolitische Ordnung mit ganz anderen Annahmen und neuen herrschenden Ideen ersetzt wird. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass das kaum jemand in westlichen Geheimdienstsphären den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhergesehen hat, bis es tatsächlich so weit war. Aber auch die Bewohner dieses untergegangen Reiches sahen das nahende Ende nicht kommen. Der Russe Alexei Yurchak, Autor eines Buches über „die letzte sowjetische Generation“ drückte es in seinem Buchtitel prägnant aus: „Everything Was Forever, Until It Was No More“.
„Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass das kaum jemand in westlichen Geheimdienstsphären den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhergesehen hat, bis es tatsächlich so weit war.“
Ich möchte mich hier aber nicht der letzten sowjetischen Generation widmen, sondern einer anderen letzten Generation, aus deren Schicksal wir in der heutigen Zeit meines Erachtens mehr lernen können. Ich meine die „final pagan generation“, die letzte heidnisch sozialisierte Generation im Römischen Reich, über die der amerikanische Althistoriker Edward J. Watts ein faszinierendes Buch gleichen Namens geschrieben hat.
Im alten Rom, schreibt Watts, waren die Götter überall. Von Kindesbeinen an begegnete man ihnen, u.a. in Form von riesigen Tempelanlagen, Hundertausenden kleinen Schreinen, die die Straßen säumten, Hausschreinen, täglichen privaten Zeremonien, Bittgebeten und Opfergaben, Hunderten Festtagen und damit verbundenen Prozessionen, die selbst die ärmsten Viertel der Metropolen regelmäßig mit Musik, Tanz und dem Geruch von Räucherwerk erfüllten. Der Autor beschreibt den Polytheismus der römischen Antike als eine bunte Welt, die an das heutige Indien erinnert, tiefreligiös und doch undogmatisch, wo jeder die Götter seiner Wahl verehren oder um Rat und Hilfe bitten konnte, so oft es ihm beliebte, oder auch, was seltener vorkam, ein gänzlich unreligiöses Leben, quasi nur als Zuschauer dieses bunten Treibens, führen konnte.
Die letzte heidnisch sozialisierte Generation definiert Watts als Personen, die in den Jahren zwischen 310 und 325 geboren wurden, also vor der Alleinherrschaft des Kaisers Konstantin, aber zu der Zeit, als sich Konstantin bereits zur Religion der christlichen Minderheit im Römischen Reich bekannte, ohne dass man sich damals bereits vorstellen konnte, wie sich das Christentum und zugleich auch die römische Politik und Gesellschaft im Laufe des vierten Jahrhunderts entwickeln würden. Diese Generation ist nicht zu verwechseln mit den letzten römischen Heiden, einer kleinen Minderheit, die noch viele Jahrhunderte nach der Christianisierung des Römischen Reiches in zurückgezogenen Räumen ihren Glauben privat praktizierte. Diese „letzten Heiden“ spielen in Watts Buch keine Rolle.
„Die langlebigsten Angehörigen der letzten heidnisch sozialisierten Generation verbrachten ihre letzten Lebensjahre in einer Welt, in der ihre Tempel überall im Reich in Flammen standen.“
Die letzte heidnisch sozialisierte Generation, die „final pagan generation“, von der Watts Buch handelt, wurde in eine Welt geboren, in der, wie erwähnt, die alten Götter überall waren. Die langlebigsten Angehörigen dieser Generation, schreibt Watts, starben allerdings in einer Welt, in der es nicht nur eine neue Staatsreligion gab, was seinen Ausdruck etwa in der hochsymbolischen Entfernung des heidnischen Schreines im Senatsgebäude fand. Sie verbrachten ihre letzten Lebensjahre in einer Welt, in der ihre Tempel überall im Reich in Flammen standen, ihre Schreine bis in die hintersten Winkel des Imperiums abgerissen und entweiht wurden, zerstört von selbstbewussten Anhängern des aufstrebenden frühen Christentums, das Watts als eine identitätspolitische Bewegung radikalisierter junger Männer beschreibt.
Wie konnte es zu dieser tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzung kommen? Watts vertritt die Ansicht, dass die letzte heidnisch sozialisierte Generation das Christentum noch lange, nachdem der Kaiser zu diesem neuen Glauben konvertiert war, nicht wirklich auf dem Schirm hatte und sein Potential, die Gesellschaft radikal umzugestalten, gravierend unterschätzte. Die heidnisch sozialisierten Römer, bis hoch in elitäre Kreise, waren nach Watts schlicht und einfach in ihre täglichen Angelegenheiten vertieft. Sie kümmerten sich um ihre Geschäfte, ihre Ländereien, um die Erziehung ihrer Kinder. Als junger Mann der Oberschicht verbrachte man viele Jahre mit der Aneignung eines traditionellen, seit Jahrhunderten nahezu unveränderten Bildungskanons, der vor allem grammatikalische Regeln, eloquente Rhetorik und das Studium klassischer Autoren umfasste. Wer politische Ambitionen hatte, widmete sich weltlichen Machtkämpfen und Intrigen, in der eigenen Region oder darüber hinaus. Ihre polytheistische, recht tolerante Religion war für diese klassisch sozialisierten Römer so selbstverständlich, so stark verwoben mit ihrem Alltag, dass sie sich eine Welt, in der die traditionellen religiösen Praktiken keine Rolle mehr im öffentlichen Leben spielten, schlicht und einfach nicht vorstellen konnten. Im frühen vierten Jahrhundert war ein christliches Römisches Reich so unvorstellbar wie ein römisches Eisenbahnnetz, schreibt Watts in einer einprägsamen Passage.
„Watts vertritt die Ansicht, dass die letzte heidnisch sozialisierte Generation das Christentum noch lange, nachdem der Kaiser zu diesem neuen Glauben konvertiert war, nicht wirklich auf dem Schirm hatte.“
Wer Karriere im Staatdienst machen wollte, merkte natürlich schnell, dass er mit den Anhängern der neuen Religion kooperieren musste, auch wenn ihm die Richtung, die der Kaiser in der Religionspolitik einschlug, persönlich nicht behagte. Doch der wachsende Einfluss der vom Kaiser protegierten Christen, damals vielleicht 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, war nur eine von vielen wichtigen Angelegenheiten, die die Angehörigen der römischen Elite umtrieben. „Tatsächlich“, schreibt Watts, „traten die meisten Angehörigen dieser Generation für ihre persönlichen und beruflichen Interessen, und die ihrer Freunde viel häufiger und mit viel größerem Elan ein, als sie für ihren Gott oder ihre Götter kämpften.“
Aber es dauerte nicht allzu lang, bis man sich nicht nur mit den Christen arrangieren musste, sondern selbst Christ sein musste, sich also qua Bekenntnis den immer einflussreicheren, weltanschaulich gefestigten christlichen Netzwerken anschließen musste, um im Römischen Reich überhaupt etwas zu sagen zu haben. Zunächst halbherzig, dann mit immer größerer Entschlossenheit wurde die neue religiöse Ordnung rechtlich institutionalisiert, etwa durch ein Verbot für Provinzgouverneure und andere hohe Funktionsträger, den alten Göttern Opfer darzubringen, durch staatliche Kampagnen gegen Magie, Hellseherei und die Aufstellung von Götzenbildern, Konfiszierung von Tempeleigentum und Anordnungen für den Abriss von Tempeln und den Bau von Kirchen. Die Kinder der „final pagan Generation“ wurden bereits in einer Gesellschaft sozialisiert, in der das Christentum einen viel bedeutenderen Stellenwert hatte. Viele waren bereit, an der Umwälzung der religiösen Ordnung aktiv mitzuwirken und sich von der religiösen Lebenswelt ihrer Eltern radikal abzuwenden. Die Christianisierung des Römischen Reiches war, glaubt man Watts, ein sehr ungleicher Generationenkampf, in dem die Alten, gerade weil ihre jahrtausendealten religiösen Vorstellungen für sie so selbstverständlich waren, einfach überrumpelt wurden.
Sie ahnen vielleicht bereits, worauf ich hier abziele. In seiner Begründung, warum ich in diesem Jahr Träger des Ferdinand Friedensburg Preises sein soll, schreibt der Vorstand der Ferdinand Friedensburg Stiftung:
„Kolja Zydatiss bekennt sich – innerhalb des demokratischen Spektrums – zur Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, zum gesellschaftlichen Pluralismus, zur Nichtdiskriminierung politischer Anschauungen und zur Rechtsstaatlichkeit. Das sind Werte, die von der Ferdinand-Friedensburg-Stiftung seit über 50 Jahren geteilt und durch Projektförderungen unterstützt werden. Der Preisträger zeigt auf, dass eine immer stärker werdende identitätspolitische Bewegung, die sich als postmodern und postkolonial definiert, diese Freiheitswerte relativieren und neu definieren will – mit dem Ziel einer anderen Gesellschaft und einer anderen Politik.“
„Im frühen vierten Jahrhundert war ein christliches Römisches Reich so unvorstellbar wie ein römisches Eisenbahnnetz.“
Ich finde, diese Zeilen fassen mein politisches Anliegen sehr treffend zusammen. Aus diesem Anlass will ich allerdings nicht aus meinem eigenen Buch „Cancel Culture: Demokratie in Gefahr“ zitieren, sondern aus einem Essay der US-amerikanischen Journalistin Bari Weiss. Auch Weiss sieht die Freiheitswerte, oder wie sie es nennt, den „Liberalismus“ in Gefahr. Damit meint sie ausdrücklich nicht den Liberalismus im parteipolitischen Sinne, sondern denselben breiten moralischen Konsens, für den auch die Ferdinand Friedensburg Stiftung eintritt. Ihre ausführliche Definition dieses Konsenses verdient es, vollständig zitiert zu werden:
„Die Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind, da alle nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Der Glaube an die Heiligkeit des Individuums, die über der Gruppe oder dem Stamm steht. Die Überzeugung, dass Rechtsstaatlichkeit – und Gleichheit vor dem Gesetz – das Fundament einer freien Gesellschaft sind. Die Überzeugung, dass ordnungsgemäße Gerichtsverfahren und die Unschuldsvermutung gut sind, und wütende Mobs schlecht. Der Glaube, dass Pluralismus eine Quelle unserer Stärke ist; dass Toleranz ein Grund zum Stolz ist; und dass Gewissens-, Glaubens- und Meinungsfreiheit die Grundlagen der Demokratie sind.“
Die liberale Weltsicht, schreibt Weiss weiter, erkenne an, dass es viele Dinge gibt, die außerhalb des Reichs der Politik liegen: „Freundschaft, Kunst, Musik, Familie, Liebe.“ Doch diese tolerante und pluralistische Weltsicht ist, wie gesagt, in Gefahr, denn sie wird bekämpft von den Anhängern einer radikal anderen Weltsicht, die der Vorstand der Ferdinand Friedensburg Stiftung treffend „identitätspolitische Bewegung“ nennt. Die Grundprämissen dieser Bewegung umreißt Bari Weiss wie folgt:
„Wir befinden uns in einem Krieg, in dem die Kräfte der Gerechtigkeit und des Fortschritts und die Kräfte der Rückständigkeit und der Unterdrückung einander gegenüberstehen. Und in einem Krieg müssen die normalen Spielregeln – ordnungsgemäße Verfahren, politische Kompromisse, die Unschuldsvermutung, Meinungsfreiheit, sogar die Vernunft selbst – aufgehoben werden. Tatsächlich waren diese Regeln selbst von Anfang an korrumpiert, da sie von toten, weißen Männern entworfen wurden, um ihre eigene Macht aufrechtzuerhalten.“
„Tatsächlich könnte, ähnlich wie schon beim toleranten Polytheismus der alten Römer, gerade die Tatsache, dass der liberale Konsens vielen Menschen in westlichen Gesellschaften so selbstverständlich vorkommt, seine größte Schwäche sein.“
Welche dieser gegensätzlichen Weltanschauungen gewinnt gegenwärtig die Oberhand? Bari Weiss bemerkt, dass der Liberalismus in den USA lange nahezu alle wichtigen gesellschaftlichen Institutionen prägte. Er wurde hochgehalten u.a. von Universitäten, Zeitungen, Zeitschriften, Plattenfirmen, Berufsverbänden, Gewerkschaften, kulturellen Einrichtungen, Verlagen, Filmstudios, Denkfabriken und Museen. So selbstverständlich war die im weitesten Sinne des Wortes liberale Weltsicht, so stark verwoben mit den Werten und Ansichten ihrer Eltern, den Schulen, in die sie sie schickten, den Gotteshäusern, die sie besuchten, und den Publikationen, die sie lasen, dass Weiss nach eigener Aussage lange noch nicht einmal wusste, dass dieses Weltbild überhaupt einen Namen hat.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Tatsächlich könnte, ähnlich wie schon beim toleranten Polytheismus der alten Römer, gerade die Tatsache, dass der liberale Konsens vielen Menschen in westlichen Gesellschaften so selbstverständlich vorkommt, seine größte Schwäche sein.
In den USA, der Hochburg der identitätspolitischen Bewegung, scheint bereits eine neue, post-liberale Gesellschaftsordnung im Entstehen begriffen zu sein. „Im ganzen Land schwelen eine Reihe von Kämpfen auf niedriger Stufe – auf dem Campus, im Klassenzimmer, im Gerichtssaal, in der Vorstandsetage und im Stadtrat“, schreibt in diesem Zusammenhang der amerikanische Autor Leighton Woodhouse. „Aber auch auf Bauernhöfen im oberen Mittleren Westen und Süden, in Bars und Restaurants, bei unseren städtischen Polizeikräften.“
„In den USA, der Hochburg der identitätspolitischen Bewegung, scheint bereits eine neue, post-liberale Gesellschaftsordnung im Entstehen begriffen zu sein.“
Im März dieses Jahres, erklärt Woodhouse, unterzeichnete etwa Präsident Joe Biden den Rescue Plan Act, ein Gesetz, welches vier Milliarden Dollar an Hilfszahlungen nur für farbige Farmer auswies. Ein ähnliches Gesetz sah Fördergelder ausschließlich für Bars und Restaurants in farbigem Besitz vor. Beide Gesetze wurden von Gerichten als rechtswidrig verworfen. Im vergangenen Frühjahr führte die kalifornische Stadt Oakland eine Art ergänzendes Sozialhilfeprogramm nur für Nicht-Weiße ein. Erst nach einer Reihe negativer Medienberichte entschied die Stadt, das Rassenkriterium zu streichen. Im Oktober kündigte Oakland allerdings ein weiteres rassenbasiertes Sozialprogramm an, das nicht-weißen Lehrern Stipendien und subventionierte Wohnungen bietet. Auf der anderen Seite der Bucht, in San Francisco, wurde letztes Jahr ein ähnliches Programm nur für „schwarze und pazifische Insulaner, die ein Kind zur Welt bringen“ eingeführt.
Letztes Jahr, als der linke Stadtrat von Seattle eine Kürzung des Polizeibudgets um 50 Prozent durchsetzte, forderte ein Mitglied des Stadtrats die Polizeichefin Carmen Best ausdrücklich auf, eine Gesetzeslücke zu nutzen, um ihre weißen Beamten anstelle der nicht-weißen zu entlassen. Die Polizeichefin wies den Vorschlag als kontraproduktiv und rechtswidrig zurück. Der Stadtrat reagierte darauf mit der Androhung von Gehaltskürzungen bei ihr und anderen Führungskräften. Best, die erste schwarze Polizeichefin Seattles, trat wegen dieses Streits schließlich zurück.
Im September, so Woodhouse weiter, entließ das altehrwürdige Kunstmuseum Art Institute of Chicago abrupt seine 150 ehrenamtlichen Dozenten. Viele hatten seit Jahren ohne Bezahlung als fachkundige Museumsführer gearbeitet, doch die Museumsleitung war zu dem Schluss gekommen, dass das Corps der Ehrenamtlichen „zu weiß“ und „zu wohlhabend“ war. „In progressiven Kreisen sind Ehrenamtliche aus der Mode gekommen und werden als reiche Weiße mit viel Zeit, überholten Denkweisen und als wandelnde Hindernisse für Gleichberechtigung und Integration abgetan“, erklärt der konservative Chicago Tribune in einem Editorial zur Causa. Ein Beschwerdebrief der aussortierten Dozenten, bemerkt Woodhouse, „liest sich wie ein Brief, der von liberalen, bürgerlich gesinnten Menschen geschrieben wurde, die nicht ganz begreifen, wie grundlegend sich die Welt verändert hat.“
„Auch in Deutschland gewinnen radikale identitätspolitische Aktivisten, die das bestehende liberale Gesellschaftsmodell abwickeln wollen, an Boden.“
Der wohl wichtigste Unterschied zwischen der liberalen und der postliberalen, identitätspolitischen Ordnung ist, dass letztere Menschen nicht als Individuen betrachtet, sondern sie auf Merkmale wie Geschlecht, Herkunft, Alter und vor allem Rasse reduziert. Das ist ein Bruch mit Werten und Grundannahmen, die westliche Gesellschaften jahrzehntelang ausgezeichnet haben. Die neue Ideologie (manche sprechen sogar von einer Ersatz- oder Quasi-Religion) sortiert die gesamte Menschheit auf Grundlage besagter Merkmale in „unterdrückende“ und „unterdrückte“ Gruppen. Wie ich in meinem Buch „Cancel Culture“ darlege, wird auf eine vermeintlich fortschrittliche Neo-Apartheid oder Ständegesellschaft hingearbeitet, in der diese Identitätskategorien in immer mehr Bereichen maßgeblich sind und u.a. den Zugang zu Jobs, Bildung, politischen Ämtern und staatlichen Ressourcen (mit)bestimmen.
Das erinnert an das seltsame politische System im Libanon, manchmal Konkordanzdemokratie oder paritätischer Staat genannt. Im Libanon sollen u.a. religiöser Proporz im Parlament und die Reservierung verschiedener hoher Staatsämter für bestimmte religiöse Gruppen alle bei Laune halten. Trotzdem ist das Land tief gespalten und balanciert stets am Rande des Bürgerkriegs – beinahe sicher wirkt die politische Institutionalisierung des Sektierertums dabei eher als Brandbeschleuniger denn als mäßigender Faktor. Mit dem herkömmlichen westlichen Demokratiemodell sind die Ziele der identitätspolitischen Bewegung offenkundig nicht vereinbar.
Gewiss, im englischsprachigen Raum ist die identitätspolitische Übernahme der Gesellschaft schon deutlich weiter fortgeschritten als in Deutschland. Einige der Entwicklungen, die ich in diesem Vortrag vor allem mit Blick auf die USA geschildert habe, sind hierzulande noch nicht vorstellbar. Doch auch in Deutschland gewinnen radikale identitätspolitische Aktivisten, die das bestehende liberale Gesellschaftsmodell abwickeln wollen, an Boden. Die Cancel Culture ist dabei eine starke, vielleicht die stärkste Waffe in ihrem taktischen Arsenal.
Werden wir die „final democratic generation“ sein? Das hängt davon ab, ob wir – anders als die römischen Heiden – bereit sind, für die Dinge, die uns wichtig sind, zu kämpfen, anstatt sie als selbstverständlich zu betrachten.