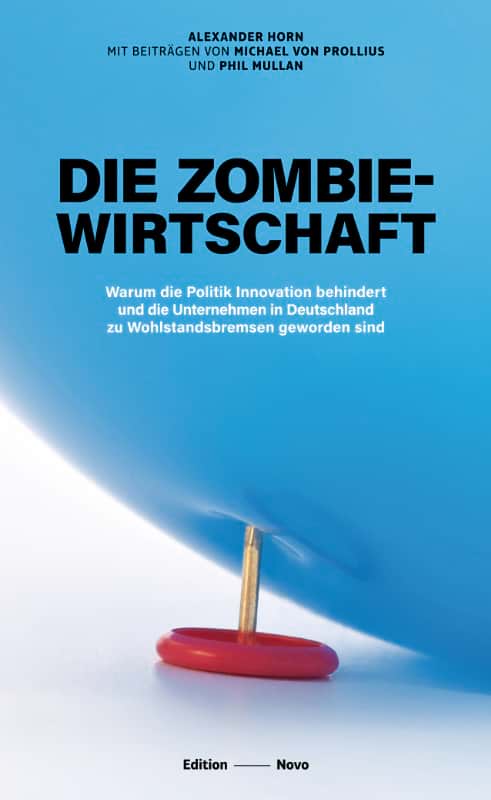03.11.2025
Die Hütte brennt
Von Alexander Horn
Wegen immer teurerer erneuerbarer Energie hat die deutsche Stahlindustrie ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren. Als Gegengift wird die Wirtschaft nun zombifiziert – mit Subventionen und Protektionismus.
Die energieintensiven Industriebranchen, darunter die Chemie-, Papier-, Pappe- und Glasindustrie sowie Metallerzeugung und -bearbeitung, waren im Jahr 2021 für knapp 17 Prozent der gesamten industriellen Wertschöpfung in Deutschland verantwortlich. Fast eine Million direkte Beschäftigte arbeiten in diesen Branchen. Da die Strompreise – im völligen Gegensatz zu allen Versprechen der vergangenen mehr als 20 Jahre – immer weiter steigen und sich wegen steigender CO2-Abgaben nun auch fossile Energieträger verteuern, stehen die meisten energieintensiven Unternehmen wirtschaftlich unter enormem Druck. Sie desinvestieren und fahren auf Verschleiß, während sich junge Unternehmen kaum für Investitionen in Deutschland entscheiden.
Zu diesen energieintensiven Unternehmen gehören keinesfalls nur Industriebetriebe, sie finden sich in großer Zahl auch in Wirtschaftsbereichen, die nicht als energieintensiv gelten – wie etwa in der Nahrungsmitteproduktion, der Batterie- sowie Chipherstellung oder unter Dienstleistungsunternehmen wie beispielsweise den Betreibern von Rechenzentren und Anbietern von Cloud Computing. Von steigenden Energiekosten ganz besonders betroffen sind jedoch die aktuell etwa 70 eisen- und stahlerzeugenden Betriebe in Deutschland mit ihren insgesamt 70.000 Beschäftigten (WZ08-241), auf die knapp ein Viertel des gesamten industriellen Energieverbrauchs in Deutschland entfällt. Mit dem Rücken an der Wand stehen sowohl die vier Primärstahlerzeuger, die einen Anteil von etwa 70 Prozent an der deutschen Stahlproduktion auf sich vereinen – und hauptsächlich Kohle als Energieträger einsetzen –, als auch die strombasierten Sekundärstahlerzeuger, die etwa 30 Prozent des in Deutschland produzierten Stahls aus Stahlschrott herstellen.
Wie sehr diese energieintensiven Unternehmen wirtschaftlich unter Druck geraten sind, zeigt sich am Beispiel des Primärstahlherstellers ArcelorMittal. Im Juni hatte sich der global aufgestellte Stahlkonzern gegen die Umrüstung seiner deutschen Stahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt auf Wasserstoff entschieden und somit längst bewilligte Fördermittel des Bundes in Höhe von 1,3 Milliarden Euro und weitere knapp 0,3 Milliarden Euro des Bremer Senats ausgeschlagen. Das Aus für die Umstellung auf Grünstahl, für die der Konzern selbst Milliarden hätte investieren müssen, begründete Reiner Blaschek, Chef der europäischen Flachstahlsparte von ArcelorMittal damit, dass die Wirtschaftlichkeit nicht geben sei: „Die Rahmenbedingungen ermöglichen aus unserer Sicht kein belastbares und überlebensfähiges Geschäftsmodell." Im Übrigen sei Wasserstoff viel zu teuer und derzeit noch nicht ausreichend verfügbar.
Rahmenbedingungen passen nicht
Die neben ArcelorMittal verbliebenen weiteren drei Primärstahlhersteller in Deutschland, die zwecks Dekarbonisierung ebenfalls gezwungen sind, ihre mit Koks und Kokskohle betriebenen Hochöfen auf erneuerbaren Strom oder Wasserstoff umzustellen, hadern mit der Transformation. Auch sie beklagen schlechte und sogar immer schlechter werdende wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die die technische Umstellung trotz gigantischer Subventionen unwirtschaftlich machen. ThyssenKrupp, Deutschlands größter Stahlhersteller, hält bisher zwar an der Ersetzung des ersten von insgesamt vier mit Koks und Kokskohle befeuerte Hochöfen durch eine mit Wasserstoff betriebene Direktreduktionsanlage fest, obwohl sich diese Investition „an der Grenze der Wirtschaftlichkeit“ bewege, wie der Konzern im Juni mitteilte. Wiederholt hat ThyssenKrupp das von Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen mit 2,1 Milliarden Euro subventionierte Projekt auf den Prüfstand gestellt und inzwischen um eineinhalb Jahre auf Ende 2027 verschoben.
„Da die Strompreise immer weiter steigen und sich wegen steigender CO2-Abgaben nun auch fossile Energieträger verteuern, stehen die meisten energieintensiven Unternehmen wirtschaftlich unter enormem Druck."
Im September zog dann die Salzgitter AG, Deutschlands zweitgrößter Stahlhersteller und selbsternannter „Pionier […] der industriellen Dekarbonisierung in Europa“ die Reißleine. Das dreistufige Programm zur Dekarbonisierung der Rohstahlerzeugung sei wegen inzwischen „erheblich verschlechterten“ Rahmenbedingungen auf Eis gelegt, so der Vorstandsvorsitzende Gunnar Groebler. Auch warte der Konzern nach wie vor „auf die regulatorischen Veränderungen, die uns die Politik seit langem versprochen hat, die aber noch nicht gekommen sind.“ Nur die bereits im Bau befindliche und vom Bund und dem Land Niedersachsen hochsubventionierte erste Stufe soll bis 2027 fertiggestellt werden.
Dass die Rahmenbedingungen zur Grünstahl-Produktion nicht stimmen, beklagt auch der heutige Vorstandsvorsitzende der Stahl-Holding-Saar und frühere Verantwortliche für die Energie-, Industrie- und Dienstleistungspolitik im saarländischen Wirtschaftsministerium, Stefan Rauber. Als Chef des vierten der vier großen Stahlproduzenten in Deutschland fordert er, dass Berlin und Brüssel „in erster Linie Billigimporte aus Fernost stoppen und für wettbewerbsfähige Strompreise sorgen“ müssten.
Was ist schiefgelaufen?
Die Gründe für die reihenweisen Absagen der vom ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) initiierten und von Bund mit 7 Milliarden Euro sowie von den Ländern mit weiteren Milliarden Euro subventionierten „Leuchtturmprojekte“ der Primärstahlerzeuger, durch die zumindest Teile der deutschen Stahlindustrie gerettet werden sollten, liegen nicht primär in dem erheblichen Investitionsaufwand, den die Unternehmen trotz der hohen Subventionen dennoch etwa zur Hälfte selbst aufbringen müssen. Viel schwerer wiegt, dass die Dekarbonisierung der besonders energieintensiven Stahlherstellung unwirtschaftlich ist, da sie zu sehr viel höheren Betriebskosten führt.
Denn zur Dekarbonisierung müssen die neuen Anlagen mit dem in Deutschland inzwischen zu etwa 60 Prozent erneuerbaren Strom oder mit Wasserstoff aus Erneuerbaren betrieben werden. Dieser Strom ist jedoch um ein Vielfaches teurer als die bisher genutzte Kohle und gleiches gilt für Wasserstoff aus Erneuerbaren, der sogar so teuer ist, dass es bisher keinen Markt dafür gibt. Gäbe es ihn, wäre grüner Wasserstoff mehr als dreimal so teuer wie konventionelles Erdgas. Da dessen Einsatz unter diesen Rahmenbedingungen völlig unwirtschaftlich wäre, gibt es auch von den Stahlherstellern keine Nachfrage, so dass die Wasserstofferzeugung in ganz Europa trotz Milliardensubventionen noch nicht über Versuchsanlagen hinausgekommen ist. Es entstehe eine „immer größere Lücke zwischen dem politisch definierten Ambitionsniveau […] und dessen praktischer Umsetzung bzw. Umsetzbarkeit“, konstatierte der Nationale Wasserstoffrat unter Vorsitz der heutigen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bereits im letzten Jahr.
„Obwohl die Preise fossile Energieträger mit steigenden CO2-Abgaben in die Höhe getrieben werden, öffnet sich die Preisschere zwischen den dennoch vergleichsweise billigen fossilen Energien und dem sehr viel teureren Strom immer weiter."
Die Stahlkonzerne beklagen nun unisono verschlechterte Rahmenbedingungen, obwohl der Anstieg der Strompreise auch für sie kein neues oder gar überraschendes Phänomen ist. Vielmehr ist bereits seit dem massiv vorangetriebenen Ausbau der Erneuerbaren ab Anfang der 2000er Jahre ein stetiger Strompreisanstieg erkennbar, wodurch sich die realen Strompreise, also im Vergleich zum Verbraucherpreisanstieg, sowohl der privaten Haushalte wie auch der Unternehmen seitdem verdoppelt oder sogar verdreifacht haben. Obwohl die Strompreise seit 2022 durch die Übernahme der EEG-Umlage in den Staatshaushalt mit jährlich knapp 20 Milliarden Euro subventioniert werden, liegen sie seit einigen Jahren auf einem weltweiten Spitzenniveau.
Die Ursache steigender Strompreise ist der steigende Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch. Im Unterschied zu fossilen Energieträgern oder Kernenergie bewirken Wind- und Solarenergie sehr hohe Systemkosten, die sich als Summe der Kosten für Erzeugung, Netze, Speicher und jederzeitiger bedarfsgerechter Verfügbarkeit ergeben. Zwar reichen die günstigsten Erneuerbaren an sehr guten Standorten, mit ihren Produktionskosten an Kohle- und Kernkraftwerke heran, aber die Systemkosten zur bedarfsgerechten Bereitstellung dieser Energie betragen im Unterschied zu den konventionellen Kraftwerken, die Strom flexibel und bedarfsgerecht erzeugen, ein Vielfaches der sogenannten Stromgestehungskosten. Denn aufgrund des auf durchschnittlich etwa 60 Prozent am Bruttostromverbrauch angestiegenen Anteils der Erneuerbaren muss inzwischen fast ein vollständiges komplementäres Energiesystem aufrechterhalten werden, um die Volatilität der Erneuerbaren bis hin zu tagelangen Dunkelflauten zu kompensieren.
Erodierende Wettbewerbsfähigkeit
Obwohl die Preise fossile Energieträger mit steigenden CO2-Abgaben in die Höhe getrieben werden, öffnet sich die Preisschere zwischen den dennoch vergleichsweise billigen fossilen Energien und dem sehr viel teureren Strom immer weiter. Mittlerweile liegt der Strompreis für private Haushalte in Deutschland bei etwa 40 Cent/kWh und damit bei dem dreieinhalbfachen des Erdgaspreises von etwa 11,5 Cent/kWh. Nicht anders ist das Preisgefälle für Unternehmen – bei einem in aller Regel sehr viel niedrigerem Preisniveau. Daher haben die Stahlkonzerne, bei denen der Anteil der Energiekosten an der Bruttowertschöpfung sogar bei Verwendung billiger Kohle im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich liegt, bei der Umstellung auf Strom oder Wasserstoff keine Chance, diesen Preisschub durch eigene Anstrengungen zur Kostensenkung zu kompensieren. Unter diesen Rahmenbedingungen sind sie bei einer Umstellung unmittelbar mit dem Verlust ihrer Wettbewerbsfähigkeit konfrontiert. Die strombasierten Sekundärstahlerzeuger hingegen sind bereits seit vielen Jahren einem stetigen Verfall ihrer Wettbewerbsfähigkeit ausgesetzt.
„Die Stahlkonzerne, bei denen der Anteil der Energiekosten an der Bruttowertschöpfung sogar bei Verwendung billiger Kohle im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich liegt, haben bei der Umstellung auf Strom oder Wasserstoff keine Chance, diesen Preisschub durch eigene Anstrengungen zur Kostensenkung zu kompensieren."
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kann und will jedoch nichts daran ändern, dass steigende Energiekosten die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlunternehmen unterhöhlen. Anlässlich des im September vorgestellten Monitoringberichts zur Energiewende hat sie zwar eine Dämpfung des Strom- und Energiekostenanstiegs versprochen. Im Unterschied zur bisherigen Energie- und Klimapolitik wolle sie „Verlässlichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Kostentragfähigkeit des Energiesystems“ ins Zentrum rücken. Strom- und Energiekostensenkungen seien jedoch wegen der enormen Kosten den der Umbau der Energieversorgung verursache auch auf sehr, sehr lange Sicht ausgeschlossen. Sollte der Umbau der Energieversorgung jedoch nicht kosteneffizienter gelingen und zumindest eine Dämpfung des Kostenanstiegs erreicht werden, so Reiche in den ARD-Tagesthemen, „steigen die Kosten so hoch, dass wir Unternehmen verlieren und der soziale Zusammenhalt gefährdet ist“. Da Reiche aber nicht bereit ist, an den Prämissen der deutschen Klimapolitik zu rütteln und stattdessen sogar explizit am Ziel festhält, den Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf dann sogar 80 Prozent zu steigern, bleibt die Ursache steigender Strom- und Energiepreise völlig unangetastet.
Subventionstsunami und Protektionismus
Um trotz weiter steigender Energiekosten die von den energieintensiven Unternehmen ausgehende Deindustrialisierung zumindest abzubremsen, muss Reiche nun in weit stärkerem Ausmaß als ihr Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) auf Subventionen sowie wirtschaftspolitische Regulierung setzen. Da die Unternehmen – wie auch die Bundeswirtschaftsministerin – sehr wohl erkennen, dass die Energiekosten in Deutschland aufgrund der klimapolitischen Prämissen, Klimaneutralität mit praktisch ausschließlich erneuerbarer Wind- und Solarenergie erreichen zu wollen, auch zukünftig auf einem weltweiten Spitzenniveau liegen und sich aufgrund der immensen Kosten schwerlich auf Dauer heruntersubventionieren lassen, lässt sich die in Gang gekommene Deindustrialisierung nicht verhindern. Vielmehr drängen die Unternehmen als Gegenleistung für ihr d´accord zur Klimapolitik darauf, dass es ihnen aufgrund von Subventionen sowie herbeiregulierter förderlicher Rahmenbedingungen möglich wird, ihre Profitabilität vorläufig zu erhalten und ihnen ein möglichst langsames und von Desinvestition begleitetes und dadurch verlustfreies Ausphasen ihrer Produktion ermöglicht wird.
„Um trotz weiter steigender Energiekosten die von den energieintensiven Unternehmen ausgehende Deindustrialisierung zumindest abzubremsen, muss Reiche nun in weit stärkerem Ausmaß als ihr Amtsvorgänger Habeck auf Subventionen sowie wirtschaftspolitische Regulierung setzen."
Um den klimapolitischen Elitenkonsens nicht zu gefährden, setzt die neue Bundesregierung den von der Ampelkoalition initiierten Subventionstsunami mit noch größerem Schwung fort. So hat die amtierende Bundesregierung ab 2026 die dauerhafte Gewährung der von der Ampelkoalition auf die Jahre 2024 und 2025 befristet um knapp 2 Cent/kWh reduzierten Stromsteuer für das produzierende Gewerbe beschlossen und gleichzeitig den Kreis der Begünstigten um die Land- und Forstwirtschaft sowie produzierende Handwerksbetriebe erweitert. Hinzu kommen Subventionen zur Reduzierung der Netzentgelte von zunächst 6,5 Milliarden Euro ab nächstem Jahr, die sich bis 2029 auf insgesamt 26 Milliarden Euro belaufen sollen. Fortgesetzt werden die Subventionen zum Ausbau der Erneuerbaren im Rahmen der früheren EEG-Umlage, die seit Mitte 2022 vollständig aus dem Staatshaushalt bestritten werden und sich 2024 auf 18,5 beliefen und in diesem Jahr bei 17 Milliarden Euro liegen.
Darüber hinaus plant Reiche – wie bereits die Ampelkoalition, die jedoch wegen des dafür fehlenden Geldes zerbrochen war – die Einführung eines Industriestrompreises von 5 Cent/kWh, von dem mittelgroße und große Stromverbraucher ab einem Jahresverbrauch von 20 GWh profitieren sollen. Trotz diverser beihilferechtlicher Restriktionen, die die EU-Kommission zur Auflage macht, dürfte die Einführung eines derartigen Industriestrompreises aus dem Stand heraus einen zweistelligen Milliardenbetrag jährlich verschlingen. Das ergibt sich daraus, dass der Löwenanteil des aktuellen Jahresstromverbrauchs des verarbeiten Gewerbes sowie Handel- und Dienstleistungsunternehmen (ohne Straßenverkehrslogistik) von insgesamt 310 TWh auf energieintensive und große Industriebetriebe entfällt, deren Strompreise bei bis zu 15 Cent/kWh liegen. Diese Subventionen dürften in den nächsten Jahren wegen den anstehenden Umstiegs von fossilen Brennstoffen auf Strom um ein Vielfaches steigen, denn bisher werden in Deutschland erst 30 Prozent des industriellen Energieverbrauchs durch Strom gedeckt.
„In der Stahlindustrie stößt diese industrie- und handelspolitische Ausrichtung, mit der EU und Bundesregierung auf die klimapolitisch verursachte Zerstörung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen reagieren – ohne jedoch die klimapolitischen Prämissen in Frage zu stellen –, auf einhellige Zustimmung."
Während die deutsche Politik auf Subventionen und industriepolitische Instrumente setzt, um die Desinvestitionsstrategien vor allem energieintensiver Unternehmen zu unterstützen und einem verbleibenden Alibi-Rest dieser Industrien ein dauerhaftes Überleben am staatlichen Tropf zu ermöglichen, leistet die EU-Kommission mit den ihr zur Verfügung stehenden handelspolitischen Instrumenten ergänzende Schützenhilfe. Ganz oben auf der EU-Prioritätenliste stehen aktuell die Unternehmen der Stahl- und Metallindustrie, deren Profitabilität durch die Herbeiregulierung besonders förderlicher Rahmenbedingungen erhalten bleiben soll. Nach der Initiierung erster handelspolitischen Verschärfungen im März plant die EU nun drastische Maßnahmen, die nach Einschätzung von Christian Vietmeyer, dem Geschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Stahl- und Metallverarbeitung (WSM), „fast einem Importverbot“ gleichkämen. Im Unterschied zu bisher zeitlich befristeten Zöllen will die EU einen dauerhaften Zollschutz etablieren, wodurch die zollfreie Einfuhr auf etwa 50 Prozent des heutigen Stahlimports beschränkt würde. Alle darüberhinausgehenden Einfuhren sollen mit 50 Prozent Zoll belegt werden. Ab 2026 ist zusätzlich die Einführung des EU-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) vorgesehen, wodurch Stahlimporte mit ähnlich hohen CO2-Abgaben belasten werden sollen wie die innereuropäische Produktion.
Die „Heilige Klimaallianz“ der Eliten
In der Stahlindustrie stößt diese industrie- und handelspolitische Ausrichtung, mit der EU und Bundesregierung auf die klimapolitisch verursachte Zerstörung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen reagieren – ohne jedoch die klimapolitischen Prämissen in Frage zu stellen –, auf einhellige Zustimmung. In einem gemeinsamen Papier, das die IG Metall, die Wirtschaftsvereinigung Stahl und elf Bundesländer als neugegründete „Stahlallianz“ anlässlich des letztjährigen Stahlgipfels verfasst hatten, werden die energiepreistreibenden Prämissen der deutschen Klimapolitik nicht etwa in Frage gestellt, sondern ausdrücklich begrüßt. „Die Unterzeichner begrüßen die Anstrengungen der Bundesregierung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien“ heißt es dort.
Zwar werden mit den nun von Bundesregierung und EU in Gang gesetzten Maßnahmen wesentliche Teile der im Papier erhobenen Forderungen erfüllt. Aber offenbar geraten die Stahlkonzerne wegen der dennoch drastisch steigenden Betriebskosten bei Umstellung auf Strom oder Wasserstoff so sehr in wirtschaftliche Bedrängnis, dass sie sich sogar gezwungen sehen, milliardenschwere Subventionen auszuschlagen. Die diesjährige Absage vieler Dekarbonisierungsprojekte erhöht den politischen Druck zur Gewährung weiterer Hilfen, die sowohl von den Konzernen, Unternehmensverbänden, Gewerkschaften als auch von Politikern schon seit langem unisono gefordert werden. So will die Stahlallianz einen staatlich geförderten Wasserstoffhochlauf mit wettbewerbsfähigen, also hochsubventionierten Wasserstoffpreisen, Klimaschutzverträge zur jahrzehntelangen Subventionierung der Betriebskosten bei Verwendung erneuerbarer Energie sowie die Einrichtung grüner Leitmärkte für Stahl, die durch regulatorischen Zwang zur Abnahme von Grünstahl entstehen sollen. Hinzu kommt nun die von der Stahlindustrie wie auch anderen betroffenen Branchen erhobene Forderung, auch zukünftig CO2-Zertifikate kostenfrei zu erhalten, was sich nun die Regierungsparteien ebenfalls zu eigen machen.
„Die Klimapolitik entzieht den energieintensiven Unternehmen die Geschäftsgrundlage und sie werden zu Zombieunternehmen gemacht, deren Profitabilität vollkommen von Subventionen und regulatorischen sowie handelspolitischen Maßnahmen abhängt."
In Anbetracht der seit 2018 wegen zu hoher Energiekosten offensichtlich voranschreitenden Deindustrialisierung, in deren Zuge die Industrieproduktion um inzwischen mehr als 20 Prozent geschrumpft ist und auch die wichtigen Ausrüstungsinvestitionen um knapp 20 Prozent eingebrochen sind, geht es dieser ‚Heiligen Allianz‘ aus Vertretern der Wirtschaft und der Politik primär um die Rettung ihrer elitären Klimapolitik, die auf den Massenwohlstand keine Rücksicht nimmt. Diese wird seit mehr als zwanzig Jahren von CDU/CSU- und SPD-geführten Regierungen und unter allseitigem Zuspruch von Unternehmens- und Gewerkschaftsvertretern vorangetrieben. Anstatt die klimapolitischen Prämissen, einerseits Klimaneutralität erreichen zu wollen und dies anderseits ausschließlich mit Wind- und Solarenergie, nun endlich in Frage zu stellen, ist diese Allianz bestrebt, die Auswirkungen dieser Politik mit Hilfe von immer mehr Subventionen, Industriepolitik und Protektionismus so gut wie möglich unter den Teppich zu kehren.
Der zur Vermeidung einer klimapolitischen Umkehr in Gang gesetzte Subventionstsunami wird auf mittlere und lange Sicht keinen einzigen Arbeitsplatz retten, da nicht etwa klima- und energiepolitische Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen es den Unternehmen gelingen kann, durch eigene Anstrengungen ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu erhalten. Vielmehr entzieht ihnen diese Klimapolitik die Geschäftsgrundlage und sie werden zu Zombieunternehmen gemacht, deren Profitabilität vollkommen von Subventionen und regulatorischen sowie handelspolitischen Maßnahmen abhängt.
Den Eigentümern der Stahlkonzerne kommt dies entgegen, da sie ihr ansonsten wertloses Kapital zumindest versilbern können. Die Zeche zahlen die Beschäftigten mit dem Verlust ihrer ehemals gutbezahlten Industriejobs und die große Masse der Erwerbstätigen mit sinkenden Realeinkommen. Denn neben den gigantischen Kosten zum Umbau der Energieversorgung treten nun die nicht weniger gigantischen Kosten zur vermeintlichen Rettung der Industrie hinzu, die über Schulden und Steuern finanziert werden. Hinzu kommt, dass das für die Reallohnentwicklung entscheidende Produktivitätswachstum geschwächt wird, da das Überleben eines immer größeren Anteils der Unternehmen nicht mehr von produktivitätssteigernden Investitionen zum Erhalt der eigenen Wettbewerbsfähigkeit abhängt, sondern von der Sicherung der Profitabilität durch exzellente Kanäle zu Politik, Staat und EU-Kommission. Mit ihren „nur“ etwa 70.000 Beschäftigen ist die Stahlindustrie lediglich die sehr kleine Spitze eines riesigen Eisbergs, der nun auf die Erwerbstätigen zurollt.