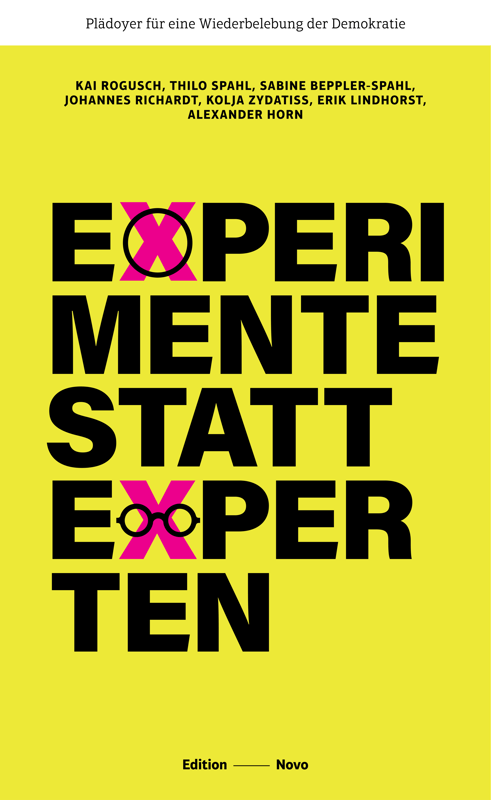29.09.2025
Die Demokratie richtet sich gegen die Wähler
Die Ludwigshafener Oberbürgermeister-Wahl bestach durch niedrige Wahlbeteiligung und eine sehr hohe Anzahl ungültiger Stimmen. Den Ausschluss des AfD-Kandidaten wollten viele nicht hinnehmen.
Die Untragbarkeit von Parteiverboten wurde bei der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen schlagartig sichtbar. Die Bürger der Industriestadt sahen sich in ihrer Wahlfreiheit beschnitten, nachdem der AfD-Kandidat Joachim Paul wenige Wochen vor der Wahl vom Wahlausschuss ausgeschlossen worden war.
Die Rechnung kam am Wahltag: Nur 29,3 Prozent Wahlbeteiligung – ein historisches Tief, selbst für Kommunalwahlen. Über 9 Prozent der Wähler gaben ungültige Stimmen ab, viele schrieben Medienberichten zufolge den Namen des ausgeschlossenen Kandidaten auf den Zettel. Wer auch immer die Stichwahl gewinnt, wird sich mutmaßlich auf kaum mehr als 12 Prozent Zustimmung der Wahlberechtigten stützen können – ein Oberbürgermeister, der bereits geschwächt antritt.
Ludwigshafen zeigt, was Deutschland erwartet, sollte die AfD bundesweit verboten werden. Die regierende SPD, die im Umfragen bei nur noch etwa 15 Prozent liegt, hält dennoch an ihrem Ziel fest. Auch Grüne, Linke und Teile der CDU wollen die Partei verbieten. Die Rechtfertigung? „Wehrhafte Demokratie“. Der Staat müsse antidemokratische Kräfte rechtzeitig stoppen – so das Argument, gestützt auf den Aufstieg der Nazis in den 1930er Jahren und das Verbot der neonazistischen Sozialistischen Reichspartei (SRP) im Jahr 1952 – eine von zwei Parteien, die in der Bundesrepublik bisher verboten wurden. Doch der Vergleich hinkt.
Die SRP entstand aus den Trümmern des Dritten Reichs, gegründet von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und angeführt von Personen wie General Otto Ernst Remer, der 1944 beim Scheitern des Hitler-Attentats eine Rolle spielte und später den Holocaust leugnete. Es war kein Volksaufstand, sondern das letzte Aufbäumen einer diskreditierten, verhassten Ideologie. Die SRP hatte ihren Schwerpunkt in ehemaligen NSDAP-Hochburgen in Niedersachsen, wo auch viele Vertriebene aus dem Osten lebten. Ihr bestes Ergebnis: 11 Prozent bei der Landtagswahl in Niedersachsen 1951. Ein Schock – aber keine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie in einem Land, das die Auswirkungen des faschistischen Terrors noch immer spürte. Die SRP war der letzte Atemzug des Nationalsozialismus – nicht seine Wiedergeburt.
„Die AfD entstand nicht aus ideologischer Nostalgie, sondern aus demokratischer Frustration.“
Die AfD hingegen entstand nicht aus ideologischer Nostalgie, sondern aus demokratischer Frustration. Ihre Unterstützer wollten keinen Nationalsozialismus zurück – sie waren schlicht empört über die Konsenspolitik bei Themen wie Euro-Rettung, Energiewende und Migration. Entwicklungen wie der Atomausstieg oder der unkontrollierte Zustrom von Migranten betrachteten sie mit wachsender Sorge. Doch statt ihre Bedenken ernst zu nehmen, wurden sie von Politik und Medien frühzeitig als Außenseiter oder Rechtsradikale diffamiert. Die Bewegung hin zur AfD war keine Verschwörung gegen die Demokratie, sondern eine Reaktion auf deren Aushöhlung – ausgelöst durch die Ausgrenzung von Bürgern, die völlig legitime Bedenken äußerten, sich politisch aber von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten sahen.
Das SRP-Verbot war primär ein Akt außenpolitischer Schadensbegrenzung. In Ländern, die die Entwicklungen in Deutschland immer noch – aus verständlichen Gründen – mit großem Misstrauen beobachteten, hatte das Abschneiden der SRP in Niedersachsen für Schlagzeilen gesorgt. Auch der amerikanischen Hochkommissars John McCloy drohte zu intervenieren, wenn die Bundesregierung nicht handelte. Die Regierung unter Kanzler Adenauer und das Bundesverfassungsgericht agierten unter diesem Druck.
Heute ist die Situation grundlegend anders: Der Ruf nach einem AfD-Verbot kommt nicht von außen, sondern aus der schwächelnden Mitte der Republik. Parteien, die sich selbst kaum noch stabile Mehrheiten sichern können, wollen nun die größte Oppositionspartei ausschalten.
Damals regierten Union und SPD aus einer Position der Stärke. Adenauers CDU/CSU erzielte 1949 bereits 31 Prozent, 1953 sogar 45 Prozent. Einschließlich der SPD kam die politische Mitte auf über 70 Prozent Zustimmung. Die Parteien genossen Vertrauen – nicht weil sie Gegner verbannten, sondern weil sie die Wähler überzeugten.
„Demokratie, die an der Wahlurne verhindert wird, findet andere Wege. Unmut lässt sich nicht verbieten.“
Heute sieht es anders aus: SPD und CDU verlieren kontinuierlich an Rückhalt und regieren nur noch mithilfe brüchiger Koalitionen. Sie haben ihre gesellschaftliche Verankerung verloren und sind nicht mehr richtig in der Lage, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. Ein Bürgermeister mit vielleicht nur 12 Prozent Rückhalt – das ist keine gelebte Demokratie. Es ist eine technokratische Verwaltung, ohne glaubwürdige demokratische Legitimation. So etwas lässt sich nicht mit dem Begriff „wehrhafte Demokratie“ bemänteln – das ist eine Aushöhlung des Souveräns.
Interessanterweise gelang es der CDU in den 1950er Jahren, die SRP-Wähler – viele davon Flüchtlinge und Heimatvertriebene – in ihre Reihen zu integrieren und so zu neutralisieren. Über viele Jahre galt das Prinzip: „Keine Partei rechts von der CDU“. Heute hat die CDU die Mission aufgegeben – zusammen mit der SPD. Statt Integration gibt es Stigmatisierung und Ausgrenzung. Statt politischem Wettbewerb juristische und mediale Bekämpfung. Wer erwartet, dass die AfD-Wähler einfach verschwinden, irrt sich gewaltig. Die SRP stand für eine tote Vergangenheit – die AfD hingegen verkörpert den sehr lebendigen Populismus der Gegenwart. Man kann und soll sie politisch kritisieren, herausfordern und stellen. Aber sie ist ein Produkt der Demokratie – nicht ihr Feind.
Wenn die etablierten Parteien regieren wollen, ohne noch Mehrheiten zu repräsentieren, wird das nicht in ruhiger Resignation enden. Demokratie, die an der Wahlurne verhindert wird, findet andere Wege. Unmut lässt sich nicht verbieten.
Deutschland steht vor einer klaren Entscheidung: den demokratischen Wettbewerb wiederzubeleben – oder dabei zuzusehen, wie die etablierten Parteien aus Angst vor der AfD das Fundament der Demokratie selbst untergraben.