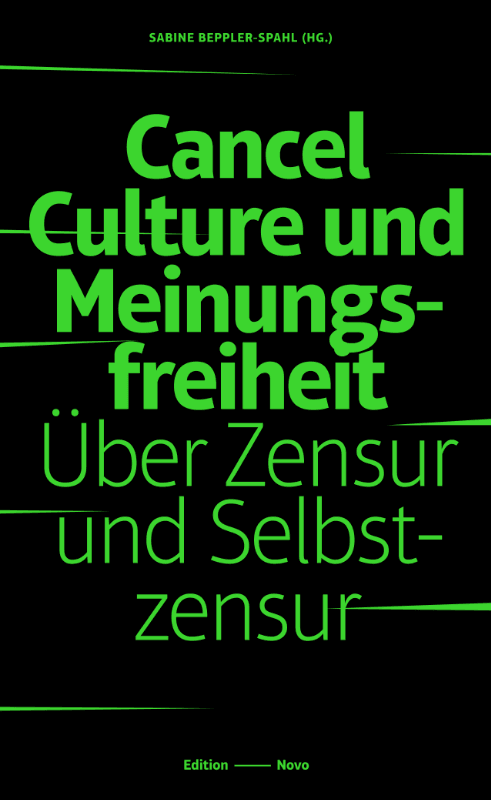26.08.2022
Die Angst vor der Meinungsbildungsfreiheit
Der heutige Journalismus wirkt entpolitisiert und emotionalisiert. Er basiert auf der bedenklichen Vorstellung, dass Medienkonsumenten der moralischen Anleitung bedürfen.
Die Corona-Krise nagt an den Nerven und geht an die Substanz, sowohl bei den einzelnen Menschen als auch bei der Gesellschaft insgesamt, ihren Entscheidungsträgern und ihren Meinungsmachern und -verbreitern. Dünnhäutigkeit und Aggressivität sind überall zu spüren, und kombiniert mit Ungeduld, Ärger, Frustration und persönlichen Ängsten um Leib, Seele und wirtschaftliche Existenz sorgen sie für ein höchst emotionales und von Unsicherheiten und Ängsten durchzogenes gesellschaftliches Klima. Wie gebannt schaut die Öffentlichkeit auf Zahlen und Fakten und darauf, wie diese von der Politik interpretiert und in welche Verordnungen und Handlungsanweisungen übersetzt werden. Den Medien kommt hier eine zentrale Rolle zu: Die Menschen kleben förmlich an den Lippen der Nachrichtensprecher und Kommentatoren in der immer wieder aufkeimenden Hoffnung und der Sehnsucht nach guten, zumindest aber klärenden Nachrichten.
Krisenzeiten sind eigentlich Hoch-Zeiten der Medien. Dies trifft nicht nur auf Krisen- und Kriegsberichterstatter zu, sondern auf die Medienwelt insgesamt. Denn es sind diese Zeiten, in denen Journalismus thematisch den Menschen näherkommt als sonst – beziehungsweise ihnen näherkommen könnte. Tatsächlich aber habe ich angesichts der Rolle, die gerade die dominierenden Medien in Deutschland spielen, ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Ich bin als freier Journalist selbst Teil dieser „Medienwelt“ und weiß daher nur zu gut, dass es so etwas wie „die Medien“ eigentlich nicht gibt. Weder herrscht hier eine kollegiale Solidarität vor, noch verfolgen alle dortigen Player bewusst ein sie einendes Ziel. Gemein ist ihnen lediglich das Ringen um Aufmerksamkeit für das eigene Medienerzeugnis sowie um Beachtung und Anerkennung der eigenen Sichtweise und ihrer Darstellung.
Ohne Distanzierung keine Differenzierung
Dass die Medienwelt uneinheitlich ist, ist kein Makel, sondern ihre ureigenste Stärke: Nur so kann eine Vielfalt an journalistischen Inhalten entstehen, was wiederum die Grundvoraussetzung dafür ist, dass eine Gesellschaft gut informiert und frei demokratische Entscheidungen treffen kann. In Krisensituationen offenbart sich journalistische Qualität. Aber nicht nur das: Auch verborgene und tief verwurzelte Charaktereigenschaften, Neigungen und Moralvorstellungen treten zutage. Nicht jeder ist gleich gut geeignet, um von Krisenherden zu berichten. Traditionell zeichnete sich diese besondere Gruppe von Journalisten dadurch aus, dass sie besonders umsichtig, umfassend informiert, fundiert und realitätsnah arbeiteten und dies auch tun mussten, um ihr eigenes Leben zu schützen. Unvorsichtigkeit und Naivität können in Krisensituationen tödlich sein.
Ein wichtiger Leitsatz des Korrespondenten in Krisenregionen war es auch, sich in Konflikten möglichst nicht auf eine Seite zu schlagen und sich nicht mit einer Sache gemein zu machen. Diese für den Journalisten im Zweifelsfall lebenswichtige Devise garantierte gleichzeitig, dass das Publikum Berichterstattung auf einem hohen journalistischen Niveau geboten bekam. Was passiert aber, wenn die Krise plötzlich zum Bestandteil des hiesigen Alltags und damit auch des Arbeitsalltags nahezu aller Journalisten wird? Verfolgt man, wie sich die dominierenden und flächendeckend konsumierten Medien in dieser Gemengelage verhalten, so fällt eines unmittelbar auf: Die einst von anerkannten und bis heute verehrten Vorbildjournalisten praktizierte – zumindest aber angestrebte – persönliche Distanzierung vom Objekt der Berichterstattung ist nahezu gänzlich verschwunden. Diese Entwicklung zeichnet sich zwar bereits seit vielen Jahren ab. Dennoch hat der Corona-Krisenmodus diese Entwicklung im Journalismus beschleunigt.
„Die einst von anerkannten und bis heute verehrten Vorbildjournalisten praktizierte – zumindest aber angestrebte – persönliche Distanzierung vom Objekt der Berichterstattung ist nahezu gänzlich verschwunden.“
Objektiv und rechtlich betrachtet haben sich die Arbeitsbedingungen von Journalisten in diesem Land in den letzten Jahren nur wenig verändert. Und dennoch scheint es, als hätten große Teile der Medienwelt zunehmend Schwierigkeiten damit, ihre eigene Rolle zu definieren. Diese Unsicherheit wird in der Krise sehr deutlich: Reporter pendeln zwischen dem Lippenlesen auf Regierungspressekonferenzen und dem Suchen nach skandalträchtigen Politikerlügen oder -fehltritten hin und her, mit oder ohne Mundschutz, in jedem Fall aber immer distanzloser. Professionelle Distanz zum Geschehen gilt heute häufig als unangebracht und „kalt“. Stattdessen wird ein mitfühlender, empathischer Journalismus heute als das geeignete Format angesehen, um das Medienpublikum zu informieren.
Durch diese Akzentverschiebung verlieren der Wille und die Fähigkeit, Zusammenhänge auch einmal aus der Vogelperspektive und in der Gesamtschau und eher distanziert, unemotional und kritisch rational zu betrachten, an Bedeutung. Da Medien so näher an das unmittelbare Geschehen heranrücken, werden sie selbst immer häufiger Teil dieses Geschehens. Es sind emotional fordernde und menschlich schwierige Erfahrungen wie diese, die unter Journalisten ein Gefühl der Solidarität und der Gemeinschaft entstehen lassen. Man fühlt sich nicht mehr nur als Übermittler von Fakten, sondern auch von Emotionen und persönlichen Eindrücken und bewegt sich somit aus dem Reich der sachlichen und rationalen Faktenvermittlung hinaus in Bereiche, in denen kontroverses Debattieren nicht wirklich angesagt ist.
Die engen Scheuklappen des Betreuungsjournalismus
Wenn Gefühle und persönliche Involvierung nicht mehr als potenziell verzerrende Fremdeinflüsse gebremst, sondern als belebende Elemente einer neuen Kultur der Berichterstattung gefördert und gefordert werden, verändert sich die Rolle des Journalismus und des Journalisten. Gleichzeitig werden diejenigen „Kollegen“, die diesen Schritt hin zu mehr Emotionalisierung verweigern und versuchen, gegen diesen Strom zu schwimmen, als unethisch und unmenschlich, zumindest aber als unengagiert und arrogant-abgehoben betrachtet, schlimmstenfalls gebrandmarkt und sogar marginalisiert. Wer Haltungsjournalismus ablehnt und offen kritisiert, bekommt schnell zu spüren, was Cancel Culture bedeutet.
Dass derlei keine Randerscheinung ist, zeigt ein Blick in die Medienwelt: Der hier entstehende Drang, sich an missliebigen Journalisten und Medien abzuarbeiten, hat in den letzten Jahren eine bislang ungekannte Intensität erreicht. Nahezu jedes Medium, das nicht auf den Grundkonsens einschwenkt, wird in die Nähe von hetzenden Verschwörern gerückt. Sicherlich können gerade in Zeiten der Verunsicherung Verschwörungstheorien und horrende Falschmeldungen großen Schaden anrichten. Doch die Annahme, dass dies von medialen, staatlichen oder privatwirtschaftlichen Aufsehern mit zensorischen Mitteln unterbunden werden sollte, unterstellt Medienkonsumenten, sie seien unfähig, selbst zu entscheiden, was sie lesen, hören oder sehen möchten und sich auf dieser Grundlage eine Meinung zu bilden. Diese Haltung ist gefährlicher für die Demokratie als alle Verschwörungstheorien zusammen.
„Man fühlt sich nicht mehr nur als Übermittler von Fakten, sondern auch von Emotionen und persönlichen Eindrücken und bewegt sich somit aus dem Reich der sachlichen und rationalen Faktenvermittlung hinaus in Bereiche, in denen kontroverses Debattieren nicht wirklich angesagt ist.“
Die Fähigkeit zur Distanzierung, zu Toleranz sowie der Versuch, die eigene Persönlichkeit zurückzunehmen, um dem Publikum eine möglichst faktenbasierte und rationale Berichterstattung zukommen zu lassen – dies machte das traditionelle Ideal des Journalismus aus. Diesem Ideal lag die Annahme zugrunde, dass eine umfassend informierte Wählerschaft die stabilste Basis einer funktionierenden Demokratie darstellt. Hierzu einen konstruktiven Beitrag zu leisten, galt als zentrale Orientierung journalistischen Strebens. Dazu gehörte auch die Bereitschaft, sich für Meinungsfreiheit und eine offene und kontroverse Debattenkultur einzusetzen. Die Veränderung des Journalismus hin zu einer stärker personalisierten und emotionalisierten Informationsdarreichung führt dazu, dass die Fähigkeit zur persönlichen Distanzierung und zur professionellen Abstandswahrung nicht nur weniger nachgefragt wird; durch mangelnden Einsatz verschwindet diese Fähigkeit zusehends. Deutlich wird dies nicht nur in journalistischen Binnenverhältnissen, sondern auch in den „Außenbeziehungen“, die der Journalismus eingeht.
Mediale Nabelschau und Orientierungsverlust
Die zunehmende Selbstbeschäftigung der Branche sorgt dafür, dass das Gespür dafür verloren geht, wie wichtig die richtige Positionierung im Verhältnis zum Publikum auf der einen und den Entscheidungsträgern in Politik und Gesellschaft auf der anderen Seite für die eigene Arbeit ist. Der Distanzverlust und die daraus entstehende Nähe zur politischen Macht bekommen den Medien nicht gut. Zuweilen hat man das Gefühl, als fühlten sich eigentlich unabhängige Journalisten in der Rolle der Politikverkünder und -vermittler zunehmend wohl. Wenn die Strahlkraft der Macht auf einen Medienapparat trifft, der sich selbst nicht als neutraler oder gar als Gegenspieler, sondern eher als einflussreicher Mitspieler im Geschäft der Politikvermittlung versteht, dann verändert sich der Bezugspunkt, an dem sich Medien ausrichten: Ihr eigentlicher Adressat war nicht die Riege der Mächtigen, sondern das Publikum, das als demokratischer Souverän handelt und dafür hochwertige Informationen benötigt.
Das sich wandelnde mediale Selbstverständnis hat wiederum Auswirkungen auf die Art der Berichterstattung. Denn der begehrte Platz an der Sonne (an der Macht) kann schnell verloren gehen. Dieser Druck einerseits und der klassische journalistische Impetus andererseits zerren an den Journalisten. Wer seine Karriere nicht gefährden will, tut gut daran, den wärmenden Platz an der Sonne nicht freiwillig zu riskieren. Hieraus resultiert für die Gesellschaft ein grundlegendes Problem: Die freie und kritische Meinungsbildung wird erschwert, und zwar nicht vorrangig durch die Politik, sondern durch die Zweifel vieler Medienvertreter an ihrer eigenen Aufgabe und Rolle. Das Verhältnis zu und der richtige Abstand von den Mächtigen ist nur der eine Aspekt, den es im journalistischen Selbstverständnis zu beachten gilt. Hier wirkten schon immer Zugkräfte, derer man sich erwehren muss. Medien und Menschen gelingt es dann, diesen Kräften zu widerstehen, wenn sie auf einem gefestigten und inhaltlichen Verhältnis zu ihren Nutzern stehen. Doch genau dieses Verhältnis wird zunehmend oberflächlicher und flüchtiger – und dadurch störanfälliger.
Der Journalist als aktivistischer Meinungsbildner
Auch die Beziehung des Journalismus zu seinem Publikum hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Immer häufiger scheint es, als genüge einigen Medien das Berichterstatten nicht mehr: Sie belehren ihre Leserschaft und verstehen sich zum Teil als polit-pädagogische Fachkraft, der es nicht mehr hauptsächlich um Informationsvermittlung, sondern in erster Linie um die Vermittlung der richtigen Haltung geht. Die einst klar verständliche (wenngleich in der Praxis natürlich immer nur annähernd umsetzbare) Unterscheidung zwischen Nachricht und Kommentar verliert an Bedeutung. Gleichzeitig lösen sich enge Bindungen von Medien an ihr Publikum (und umgekehrt) langsam auf. Dies gilt insbesondere für den Bereich des politischen Journalismus. Traditionelle politische Bindungen und Profile sowie sich politisch definierende Milieus haben in letzten Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich an Relevanz eingebüßt.
„Zuweilen hat man das Gefühl, als fühlten sich eigentlich unabhängige Journalisten in der Rolle der Politikverkünder und -vermittler zunehmend wohl.“
Mit dieser Entpolitisierung im klassischen Sinne hat sich auch der Rahmen verändert, in dem Medien agieren – und damit auch ihr eigener Anspruch: Ihr Ziel ist es nicht mehr, die politische Bindung zur eigenen Klientel zu intensiveren, sondern es geht darum, Zielgruppen auszuweiten und sich „an alle“ zu wenden. Was wie eine Öffnung klingt, hat in Wirklichkeit einen Verlust an Vielfalt und Qualität zur Folge: Viele Medien verlieren an Profil und Tiefgang und wenden sich Themen und Standpunkten zu, die ein größeres Publikum versprechen. Der Mainstream wird so zur Richtschnur des ökonomisch erfolgversprechenden journalistischen Handelns.
Im modernen Journalismus spielt daher der Leitgedanke der nützlichen Serviceleistung eine immer größere Rolle. Der Auftrag liegt nicht mehr in der Bereitstellung von Informationen für die selbst und frei Entscheidungen treffenden Medienkonsumenten, sondern darin, diesen bei der Entscheidungsfindung aktiv zu helfen oder bestenfalls deren „richtige“ Entscheidung sogar vorzuformulieren. Ein hervorragender Journalist ist in diesem Umfeld nicht mehr der mit den besten Informationsquellen oder einer besonderen Darstellungs- oder Sichtweise, sondern der, der besonders effektiv auf die Entscheidungsfindung seines Publikums einwirkt. Er wird so selbst zum politischen Aktivisten, und viele Medienvertreter würden dies auch so unterschreiben.
Diese Entwicklung ist ein Grund dafür, dass immer mehr Menschen den Eindruck haben, „die Medien“ verfolgten ihre eigene Agenda. Denn sehr häufig machen sich Journalisten mit politischen Zielen „gemein“. In den letzten Jahren wurde dies besonders deutlich: Die Berichterstattung zu Corona wechselte zwischen moralischen Appellen und Sendungen im Stil alter Telekolleg- oder Kindersendungen, flankiert mit einrahmenden Aufrufen und Hashtags, sich coronakonform zu verhalten, zu Hause zu bleiben etc. Doch es wurde auch explizit Meinung und Stimmung gegen Abweichler gemacht beziehungsweise es wurden Meinungen, die nicht diesem Konsens und dem selbsterteilten „Lehrauftrag“ entsprechen, sehr gezielt an den Rand gedrängt oder ausgeblendet.
Ungecancelte Informationsflut: Dünger für die Demokratie
Als ich vor über 30 Jahren zaghaft mit dem Zeitungslesen begann, war mir bewusst, dass ich damit für mich die Büchse der Pandora öffne. Ich merkte schnell, dass Medien gar nicht die Aufgabe haben, Fakten mundgerecht zu präsentieren. Vielmehr erwarten sie, dass man sich durch sie durchkämpft. Zeitungslesen war für mich anspruchsvoller Konfrontationsunterricht, denn oft erfuhr ich Sachen, die ich eigentlich gar nicht wissen oder so nicht sehen wollte. Mein Horizont wurde zwangserweitert und durch das Lesen verschiedener Zeitungen übte ich mich darin, unterschiedliche Standpunkte zu unterscheiden und mich selbst zu positionieren.
„Die Medien sollten sich in ihren Ansprüchen gesundschrumpfen: Es ist ihre Aufgabe, zur freien Willensbildung beizutragen und nicht, sie auszurichten oder zu managen.“
Es ist diese Freiheit des Publikums, die im Zentrum der Meinungsfreiheit steht bzw. stehen sollte. Dass ein Redakteur einer Zeitung oder ein TV-Kommentator nicht schreiben oder sagen kann, was und wie er es will, ist für sich betrachtet kein gesellschaftliches Problem, solange der Konsument die Freiheit hat, aus unterschiedlichen Medien mit unterschiedlichen Inhalten frei auszuwählen. Diesem Selbstverständnis folgend war auch immer klar, dass eine „linke“ Zeitung Ereignisse anders interpretiert als eine „rechte“. Doch im Laufe der Jahre sind diese einst eindeutigen Unterscheidungen unschärfer geworden, was an der Politik liegt wie auch an dem daraus entstehenden Anspruch moderner Medien, sich „an alle“ zu wenden.
Diese Ausweitung kam in Wirklichkeit jedoch einem Qualitätsverlust gleich: Medien verloren an Profil wie auch an journalistischem Tiefgang, sie schworen dem parteipolitischen Partisanenkampf ab und entdeckten Themenbereiche, von denen sie sich eine stabilere und auch leichter zu unterhaltende Konsumentenbindung versprachen. Heute verzichten viele Medien auf aufwendige Erläuterungen, weil sie befürchten, ihr Publikum könnte oder wollte ihnen nicht folgen. Hart konfrontiert werden soll nur noch in kleinen Dosen, wenn überhaupt, denn die Konkurrenz ist ja nur einen Klick entfernt. Diese Form der informierenden Sedierung der Bevölkerung hat Konsequenzen für die Demokratie.
Die antrainierte Bequemlichkeit des Publikums führt dazu, dass sich Medien noch mehr als politische Akteure verstehen und die quasi verwaiste Rolle des „Souveräns“ einnehmen. Deutlich wird dies nicht zuletzt im Gebaren prominenter Journalisten, Politiker weniger mit kritischen Fragen, sondern eher mit eigenen Handlungsaufforderungen zu konfrontieren, ganz so, als seien sie die Anwälte der zum Schweigen verdonnerten Öffentlichkeit. Doch dieses Ansinnen ist übergriffig. Die Medien sollten sich in ihren Ansprüchen gesundschrumpfen: Es ist ihre Aufgabe, zur freien Willensbildung beizutragen und nicht, sie auszurichten oder zu managen. Indem sie dies dennoch tun, degradieren sie sich selbst zu Handpuppen der Politik und die Bürger zu erziehungsbedürftigen Schulkindern. Dem Land und der Demokratie täte es gut, wenn Medien Meinungsfreiheit wieder so verstünden, wie sie eigentlich gemeint ist: als Meinungsbildungsfreiheit.