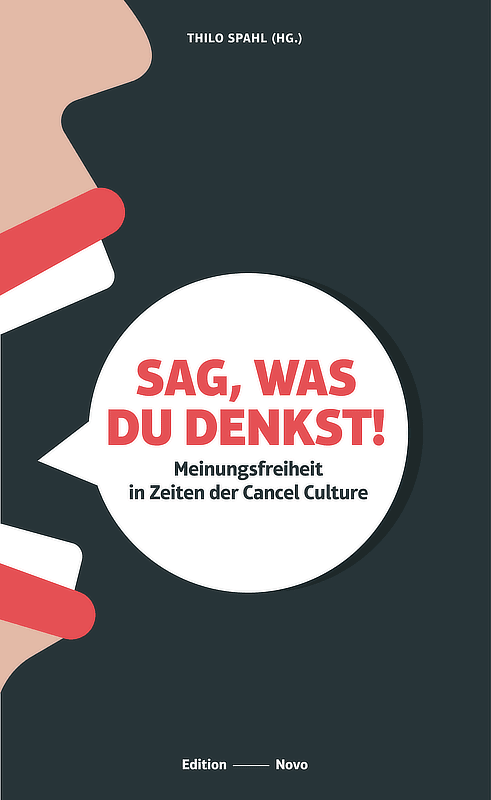02.03.2022
Das große Ordnen
Von Karim Dabbouz
Im modernen Mediensystem werden Argumente mit Haltung gleichgesetzt.
Beim Debattieren geht es darum, Argumente gegeneinander antreten zu lassen, um Antworten auf drängende Fragen zu finden. Debattieren ist Problemlösen. Im modernen Mediensystem geht es allerdings häufig weniger um die Frage, wie sich Probleme lösen lassen, als darum, welche Haltung oder welcher Hintergedanke mutmaßlich hinter Argumenten verborgen ist. Debatten werden deshalb nicht geführt, sondern geordnet.
Was ist eine Debatte?
Wir führen Debatten, indem wir mindestens zwei Positionen gegeneinander antreten lassen. Eine Debatte umfasst aber viele verschiedene Fragen und oft eine ganze Reihe von Problemen. In der Klimadebatte etwa ließen sich zahlreiche Fragen diskutieren. Angefangen bei der Frage, ob es einen Klimawandel überhaupt gibt oder ob der Mensch für ihn verantwortlich ist, bis hin zur Frage, ob es sinnvoll ist, Elektromobilität staatlich zu fördern. Schließlich könnte man auch andere Technologien fördern oder der Staat könnte sich ganz heraushalten und die Anreize des Markts wirken lassen. Auch könnte man argumentieren, die Folgen eines Temperaturanstiegs bis x Grad ließen sich durch menschlichen Erfindergeist und geeignete Anpassungsmaßnahmen auffangen und die Ressourcen seien nicht in der Verhinderung des Temperaturanstiegs am besten aufgehoben, sondern indem man die damit einhergehenden Probleme löst.
Alle diese Fragen gehören zur Klimadebatte und lassen sich selbst noch weiter aufschlüsseln. Durch das Stellen von Fragen gelangen wir zu weiteren Fragen und über das Beantworten dieser Fragen können wir irgendwann vielleicht die Ausgangsfrage beantworten und ein großes Problem lösen. Eine funktionierende Debatte hat daher Ähnlichkeit mit wissenschaftlicher Methode, ganz besonders mit dem kritischen Rationalismus: Wir können nie ganz sicher sein, ob wir uns nicht doch irren. Daraus folgt, dass wir natürlich weiter Fragen stellen müssen.
„Eine funktionierende Debatte hat Ähnlichkeit mit wissenschaftlicher Methode, ganz besonders mit dem kritischen Rationalismus.“
Da Debatten zu Fragen führen und Fragen wiederum zu weiteren Fragen und weil wir nie sicher wissen können, ob wir wirklich richtig liegen, ist eine Debatte offen und sie hat ein Ziel, das wir aber nicht kennen. Das Ziel einer Debatte ist vor allem nicht der Konsens, denn mit steigender Komplexität kann es diesen gar nicht geben. Was es aber geben kann, sind Antworten auf Fragen sowie Lösungen für einzelne Probleme. Diese Problemlösungen interpenetrieren sich. Sie kommen sich in die Quere, beeinflussen sich gegenseitig, haben Externalitäten, weshalb der Fokus einer Debatte oft auf eine andere übergeht, nur um einige Monate oder Jahre später wieder hinüberzuwechseln. Das ist der Grund, weshalb Debatten mit dem scheinbaren Paradoxon fertig werden, zwar ein Ziel zu haben, aber dennoch unendlich zu sein: Mit dem Debattieren ist man niemals fertig, die Debatte verharrt höchstens im Wartemodus, nur um einige Zeit später wieder aktuell zu werden. Nahezu alles keimt irgendwann aufgrund irgendeiner Frage oder eines Problems wieder auf und entfacht die gesamte Debatte von neuem. Das Ziel einer Debatte ist deshalb auch nicht, sie zu beenden. Im Gegenteil: Debatten, die für beendet erklärt werden, sind ein guter Warnhinweis dafür, dass die Gesellschaft etwas ihrer Offenheit verliert. Das gilt ganz besonders, wenn die Politik oder Medien selbst eine Debatte für beendet erklären. Insofern müssen wir feststellen, dass die westlichen Gesellschaften sich auf einem kritischen Pfad bewegen. Denn es wird zwar debattiert, aber die Debatten sind nicht so ergebnisoffen, wie man es im Westen erwarten würde. Woran liegt das?
Alles steht unter Beobachtung
Der alte philosophische Streit zwischen Konstruktivismus und Realismus läuft in den Medienwissenschaften auf die Frage hinaus, ob Medien Wirklichkeit konstruieren oder Ereignisse aus der Wirklichkeit selektieren. 1 Selektion bedeutet, dass Medien eine Gatekeeper-Funktion einnehmen. Sie suchen sich Ereignisse aus und berichten über sie. Damit erschweren sie manchen Anliegen den Zutritt, während sie anderen zu Aufmerksamkeit verhelfen.
Die Gatekeeper-Rolle klassischer Medien verliert allerdings an Bedeutung und zwar angetrieben durch Technologien, die unter dem Begriff Web 2.0 zusammengefasst werden, also durch die Möglichkeit, Medieninhalte nicht mehr nur zu konsumieren, sondern mit geringem Aufwand selbst zu produzieren. Angefangen hat diese Entwicklung mit Blogs, die es auch Laien erlaubten, Text und Bild ohne große Vorkenntnisse zu publizieren. Die Vernetzung im Web 2.0 war dabei anfangs dezentral. Die Publikationen waren, abgesehen von Suchmaschinen und Blog-Aggregatoren, hauptsächlich durch gegenseitige Verlinkung vernetzt.
„Das Ziel einer Debatte ist vor allem nicht der Konsens, denn mit steigender Komplexität kann es diesen gar nicht geben.“
Mit den großen Online-Intermediären wie Facebook und Twitter büßte das Web 2.0 einen Großteil seiner ursprünglichen Offenheit ein. Zwar machten Online-Intermediäre es noch leichter, Inhalte zu veröffentlichen, bildeten aufgrund des Netzwerkeffekts aber nahezu Monopolstellungen aus. Eine dezentrale Struktur wurde allmählich durch eine zentrale Struktur ersetzt, das Internet vertikal integriert. Heute sind YouTube, Facebook, Twitter und Instagram praktisch Kuratoren des Web. Ein großer Teil der Medieninhalte wird über diese Intermediäre konsumiert.
Dabei fügen sie dem Web 2.0 eine entscheidende Funktion hinzu und zwar die Möglichkeit, auf veröffentlichte Inhalte direkt zu reagieren. Sie also zu kommentieren, zu liken und sie mit anderen zu teilen. Das hat einen großen Einfluss auf das Beziehungsmodell in Medien. Statt einer zweiseitigen Sender-Empfänger-Beziehung gibt es nun eine triadische Sender-Empfänger-Zuschauer-Beziehung, wobei jeder Teilnehmer jede Rolle einnehmen kann, mitunter auch zwei Rollen gleichzeitig. Das ist etwa dann der Fall, wenn ein Journalist einen Artikel eines anderen Journalisten auf Twitter teilt und kommentiert. Er ist dann Empfänger und Produzent zugleich, während alle anderen Zuschauer sind – auch der Journalist, der den geteilten Artikel ursprünglich verfasst hat.
Wir stehen beim Konsumieren von Medien also unter ständiger Beobachtung, das gilt sogar dann, wenn wir nicht reagieren, also weder teilen noch liken oder kommentieren. Denn die Rezeption erfolgt in den neuen Medien quasi „on the fly“. Kaum ist etwas veröffentlicht, erwartet man die Reaktionen und wenn wir reagieren, können wir nie wissen, wer gerade dabei zusieht. Wir müssen aber stets damit rechnen, dass jemand zusieht. In der Folge können wir natürlich versuchen, Medien nur passiv zu konsumieren, sie also nicht zu kommentieren, nicht zu teilen und nicht zu liken, also keinerlei Signale zu senden. Aber auch beim Nichtsenden von Signalen müssen wir davon ausgehen, dass dies als Kommunikation aufgefasst wird. Man denke nur an die Black-Lives-Matter-Bewegung, die mit dem Spruch „Silence is violence“ versuchte, Menschen dazu zu zwingen, sich öffentlich zu positionieren. Hier wird aus der alten kommunikationswissenschaftlichen Binsenweisheit „Man kann nicht nicht kommunizieren“ eine Drohung, die nicht nur gesellschaftlich bedenklich ist, sondern auch die Funktionsweise von Medien entscheidend beeinflusst.
„Debatten, die für beendet erklärt werden, sind ein guter Warnhinweis dafür, dass die Gesellschaft etwas ihrer Offenheit verliert.“
Die Filterblase als Reaktion auf Medienvielfalt
Neben diesem triadischen Beziehungsmodell und der ständigen Beobachtung hat sich durch Online-Intermediäre noch etwas verändert. Plötzlich werden wir mit Themen und Positionen konfrontiert, die uns nicht gefallen. Wer früher an politischen Debatten interessiert war, hatte in der Regel ein Abonnement für ein oder zwei Zeitungen, die er regelmäßig las. Die Zeitung wurde mit der Post auf direktem Weg in die eigenen vier Wände geliefert. Alternativ gab man die URL direkt im Browser ein und landete so auf medial gewohntem Terrain. Wer Medien heute über die Online-Intermediäre konsumiert, ist hingegen einer Vielzahl unterschiedlicher Inhalte ausgesetzt. Hinzu kommt die Produktion von Inhalten durch Rezipienten, also durch Freunde, Follower und so weiter, wenn diese etwas kommentieren, teilen oder liken.
Auf den ersten Blick widerspricht diese ständige Konfrontation mit unliebsamen Inhalten dem populären Konzept der Filterblase, die auch von Journalisten gerne als Begründung für ihren Kampf gegen „Fake-News“, „Hetze“ und „Hass“ angeführt wird. Bei genauerem Blick ist dieser Kampf aber vor allem eine Abwehrstrategie klassischer Medien, die ihre Rolle als Gatekeeper einbüßen. Denn die Filterblase gibt es zwar, allerdings ist sie nicht voreingestellt und damit kein Problem der Medien an sich und auch nicht in erster Linie ein Problem von Facebook, Twitter und Co. Sie ist eine Folge der größeren Vielfalt der Medienlandschaft. Das wird deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie sie überhaupt entsteht, nämlich durch unsere Nutzung selbst. Das, was wir abstrakt „der Algorithmus“ nennen, lernt von uns. Jede künstliche Intelligenz muss trainiert werden und sie wird trainiert durch unser Verhalten, also durch unsere inhaltlichen Präferenzen. Diese Präferenzen äußern wir subtil, etwa indem wir uns Artikel von Zeit Online im Durchschnitt länger anschauen als Artikel der F.A.Z. Oder sehr explizit, indem wir Blocklisten bei Twitter pflegen, um nicht mit Dingen (und Menschen!) konfrontiert zu werden, die uns stören. Die Filterblase ist also die Reaktion der Nutzer auf größere Vielfalt. Und zwar auch auf Vielfalt an Debattenthemen und Antworten auf Fragen innerhalb dieser Debatten. Es ist eine Strategie, mit der wir auf zunehmende Komplexität reagieren.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen spricht in diesem Zusammenhang von Gereiztheit, da wir in der modernen Medienlandschaft ständig mit Meinungen, Positionen und Themen konfrontiert sind, die uns nicht gefallen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: In der modernen Medienlandschaft steht uns nahezu das gesamte menschliche Wissen offen. Wir kommen mit seiner Komplexität nur nicht zurecht. Eine Reaktion darauf ist die bekannte Empörung, die wir in sozialen Medien beobachten. Auf die Empörung (oder den Shitstorm) folgt oft die Empörung über die Empörung 2. Der Gegenstand der Kommunikation wird verlagert von den Dingen an sich, über die wir etwas lernen könnten, auf eine Metaebene, wo es um Fragen der Form, der Gefühle und vor allem der Verortung geht. Um unliebsamen Inhalten aus dem Weg zu gehen, müssen wir Aufwand betreiben.
„Der Gegenstand der Kommunikation wird verlagert von den Dingen an sich, über die wir etwas lernen könnten, auf eine Metaebene, wo es um Fragen der Form, der Gefühle und vor allem der Verortung geht.“
Das moderne Mediensystem
Angelehnt an die Luhmannsche Systemtheorie können wir Medien als funktionales System der Gesellschaft beschreiben. Wie jedes soziale System wird das Mediensystem durch sinnhafte Operationen gebildet. 3 Entscheidend ist dabei die Autopoiesis: Soziale Systeme wie das Mediensystem erschaffen sich selbst und zwar durch Operationen, die an andere Operationen anknüpfen. Eine Tageszeitung veröffentlicht eine Reportage zu einem bekannten Thema, die Tagesschau bringt einen Kommentar, eine Lokalredaktion recherchiert, ob etwas Ähnliches auch bei ihnen in der Gegend stattfindet. Jede dieser Operationen nimmt also Bezug auf vorherige Operationen. Sinn bestimmt dabei, welche Operationen anschlussfähig sind, also zum System passen und es somit aufrechterhalten. Durch das Anknüpfen von Operationen an Operationen differenziert sich das System von seiner Umwelt. Das heißt, dass das Mediensystem seine Systemgrenzen selbst erzeugt.
Soziale Systeme stehen dabei vor der Herausforderung, dass die Umwelt stets komplexer ist als das System selbst. Das heißt, dass das System Komplexität reduzieren muss, um überhaupt System sein zu können. Ein System, das so komplex wie seine Umwelt ist, wäre gewissermaßen selbst Umwelt. Es wäre gar nicht als etwas Eigenständiges erfahrbar.
Das Mediensystem leistet diese Komplexitätsreduktion, indem es mit einer binären Codierung arbeitet. Es unterscheidet zwischen Information und Nichtinformation. 4 Behandelt wird, was im Sinne des Systems Information ist. Sobald die Information mitgeteilt wurde, wird sie zur Nichtinformation. Sie ist nun bekannt und wird als bekannt vorausgesetzt. 5 Das erklärt, wieso einmal etablierte Vorstellungen (und auch Formulierungen) sich so schwer aus der Welt räumen lassen, selbst wenn sie irreführend sind, falsch oder auf falschen Prämissen fußen: Sie werden als Bekanntes im Mediensystem weiterverarbeitet und das System schließt weitere Informationen an dieses Bekannte an. Das Falsche verfestigt sich, alles andere wird aussortiert. Es sei denn, es kommt dem System in die Quere. Dann braucht es andere Strategien, um damit umzugehen.
Als Luhmann Mitte der 1990er Jahre diese Funktionsweise von Massenmedien beschrieb, sah die Medienlandschaft noch gänzlich anders aus als heute. Zwar gab es bereits vereinzelte Online-Medien, allerdings waren diese höchstens eine Verlängerung ihrer klassischen Printangebote. Der Journalismus war gewissermaßen unter sich. Es gab keine Polit-Influencer auf YouTube, kein Twitter, keine Blogs und vor allem gab es außer Leserbriefen kaum Widerspruch aus der Bevölkerung. Auch die ständige gegenseitige Beobachtung, die das moderne Mediensystem kennzeichnet, existierte nicht. Das Mediensystem war also relativ störungsfrei und konnte seine Systemgrenzen mit recht geringem Aufwand aufrechterhalten.
„Funktional besteht kein Unterschied zwischen der Onlineausgabe der Welt, einem privat betriebenen Blog, einem YouTube-Video und einem Twitter-Thread.“
An dieser Stelle mag man einwenden, dass die Technologien des Web 2.0 gar kein Teil des Systems sind, das Luhmann „Massenmedien“ nannte. Zieht man aber seine Charakterisierung heran beziehungsweise die Ursachen, aus denen sich Massenmedien als soziales System innerhalb der Gesellschaft ausdifferenzieren konnten, 6 dann müssen sie ein Teil davon sein. Denn wie die klassischen Institutionen des Mediensystems erlauben auch soziale Medien und Blogs eine zeitliche und räumliche Distanz zwischen Sendern und Empfängern. Funktional besteht kein Unterschied zwischen der Onlineausgabe der Welt, einem privat betriebenen Blog, einem YouTube-Video und einem Twitter-Thread. Alle nutzen technische Möglichkeiten, um Kommunikation zu erschaffen, die Raum und Zeit überdauert und viele verschiedene Menschen gleichzeitig erreichen kann. Führt man sich das vor Augen, ist leicht zu erkennen, warum der klassische Journalismus mitunter so gereizt auf die Herausforderungen des modernen Mediensystems reagiert. Er ist nicht mehr Herr im eigenen Haus.
Für Journalismus ist Komplexität Druck
Luhmann ging davon aus, dass das Mediensystem binär codiert ist und über die Differenz von Information/Nichtinformation Komplexität reduziert. Das Problem, vor dem das moderne Mediensystem steht, ist allerdings, dass es heute mit größerer Komplexität zurechtkommen muss. Das wird schnell ersichtlich, wenn man sich die Vielfalt an Inhalten vor Augen führt, die sich anschicken, als Information im Mediensystem behandelt zu werden beziehungsweise Teil des Systems zu werden. Es ist dieselbe Vielfalt an Inhalten, die dazu führt, dass Menschen sich in Filterblasen einrichten, weil sie von den vielen neuen Informationen und möglichen Argumenten überreizt beziehungsweise überfordert sind. Plötzlich stellt sich Journalisten die Frage, wie sie mit dem Beitrag eines YouTubers umgehen, der in einem einstündigen Video vorgibt, die CDU zu zerstören: 7 Ignorieren? Darauf eingehen? Widersprechen?
Systemtheoretisch ist hier die entscheidende Frage, ob das Mediensystem daran anschließt und wie es das tut. Dass Inhalte der neuen Medien, also Blogs, Facebook-Posts, Tweets etc. in klassischen Medien behandelt werden und damit im Mediensystem anschlussfähig sind, steht außer Frage, denn dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Der YouTuber Rezo bietet mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ tatsächlich ein sehr eindrucksvolles, denn in diesem Fall reichte die Anschlussfähigkeit so weit, dass Zeit Online ihm eine eigene Kolumne gab. 8 Eine vermeintliche Trennung zwischen klassischem Mediensystem und neuen Medien ist hier völlig aufgehoben worden. Es ist ein System und wir alle sind Teil davon, sobald wir Inhalte teilen, liken oder kommentieren. Vielleicht nicht als einzelne, herausstehende Person, aber als Hintergrundrauschen, das andere Akteure wahrnehmen und an das sie anschließen, indem sie darauf reagieren.
„Plötzlich stellt sich Journalisten die Frage, wie sie mit dem Beitrag eines YouTubers umgehen, der in einem einstündigen Video vorgibt, die CDU zu zerstören: Ignorieren? Darauf eingehen? Widersprechen?“
Auch Faktenchecks sind ein gutes Beispiel dafür, wie Inhalte aus sozialen Medien in etablierten Medien als Information behandelt werden. Offensichtlich sind die Faktenchecks dabei selbst bereits Selektion, denn irgendwie müssen die Faktenchecker entscheiden, zu welchen Aussagen, Argumenten, Themen und Behauptungen sich ein Faktencheck aus ihrer Sicht lohnt und zu welchen nicht.
Hier zeigt sich etwas Interessantes, denn offenbar ist Information nicht gleich Information. Eine Information kann auch eine Falschinformation sein, eine irreführende Behauptung oder eine umstrittene These. Vor allem kann Information für das Mediensystem störend sein, sodass es Strategien braucht, um mit den Inhalten, die sich durch neue Technologien dem Mediensystem aufdrängen, zurechtzukommen. Entscheidend ist, dass es diese Information offenbar nicht einfach ignorieren kann.
Darüber hinaus stehen auch Journalisten und Medien im modernen Mediensystem unter ständigem Druck durch Beobachtung, denn auch sie sind abwechselnd Zuschauer, Empfänger und Produzenten. Alles, was sie sagen (oder nicht sagen), kann direkt rezipiert werden und ist dann im Gegensatz zum klassischen Leserbrief für alle anderen einsehbar. Man denke zum Beispiel an den Vorwurf, dass Zeitung A zu Thema B nicht ausreichend berichtet oder dass Journalist Bob etwas vermeintlich Falsches sagt und Journalistin Alice das als klare politische Positionierung auffasst. Man kann sagen, der Journalismus steht heute unter größerer Kontrolle. Er muss präziser sein, kann nicht mehr so einfach nur mit systeminternem Sinn arbeiten, sondern muss seine Inhalte noch mehr als sonst einem Realitätscheck unterziehen. Er muss besser zuhören, mehr wissen, mit unterschiedlichen Experten sprechen, auf die Zuschauer hören, darf sich nicht im Ton vergreifen und so weiter. Das ist Druck.
Das Ordnen von Debatten ist Reaktion auf Komplexität
Wie eingangs erläutert, benötigt eine funktionierende Debatte nicht viel. Nur ein Thema, eine Frage sowie Argumente, mit denen sich die Frage beantworten lässt. Die Debatte braucht außerdem eine Verankerung in der Realität, also in der Welt, wie sie außerhalb der Debatte tatsächlich ist und funktioniert. Je lockerer diese Verankerung im Fundament der Dinge an sich steckt, desto schwieriger wird die Debatte. Sie hat dann keinen Halt, gegen den sie die Argumente prüfen kann. Deshalb ist es so schwierig, über Weltanschauungen oder Glauben zu debattieren.
„Der Journalismus steht heute unter größerer Kontrolle. Er muss präziser sein, kann nicht mehr so einfach nur mit systeminternem Sinn arbeiten, sondern muss seine Inhalte noch mehr als sonst einem Realitätscheck unterziehen.“
Faktenchecks zeigen aber gut, dass das Mediensystem auch ungültige Argumente nicht einfach ignoriert, sondern bereitwillig annimmt und verarbeitet. Es investiert dann viel Energie in ein Unterfangen, das Information ordnet. An die Codierung Information/Nichtinformation schließt also ein weiterer Prozess an: ein Ordnungsunterfangen unter Zuhilfenahme von Deutungen. Dieser Prozess ist nicht auf Faktenchecks beschränkt, sondern findet im gesamten modernen Mediensystem statt. Ein gutes Beispiel liefert die Berichterstattung über die private Seenotrettung durch NGOs im Mittelmeer. Wir haben es hier mit einer Frage in der Migrationsdebatte zu tun, die auf einem drängenden Problem fußt, nämlich dass seit 2016 bei der Überfahrt über das Mittelmeer mehr als 10.000 Menschen ertrunken sind. 9
Eines der prominentesten Argumente gegen diese Arbeit der NGOs lautet wie folgt: Die Anwesenheit von Rettungsschiffen im Mittelmeer sorgt dafür, dass mehr Menschen die unsichere Überfahrt und damit den Tod riskieren. Das Argument stützt sich natürlich auf eine Prämisse, die lautet: Die private Seenotrettung hat einen Pull-Effekt. Genau hier ließe sich das Argument angreifen. Um das Argument zu entkräften und damit den Standpunkt pro Seenotrettung zu stärken, bräuchte man nur die Prämisse zu widerlegen. Journalismus kann das leisten oder zumindest weitere Fragen stellen.
Entscheidend ist, dass dieses Argument haltungsagnostisch ist. Es steht nicht eindeutig für eine bestimmte Position in der Migrationsdebatte, also pro Migration oder contra Migration. Im Mediensystem wird es aber so behandelt. 2018 veröffentlichte die Zeit einen Artikel, in dem ein Pro und Contra der privaten Seenotrettung gegenübergestellt wurden. 10 Kurz darauf entschuldigte sich die Redaktion für den Beitrag 11 – wohl auch, weil es in Folge des Artikels zu großer Empörung gekommen war. Statt das Argument zu entkräften, reagierten viele Journalisten sowie andere Nutzer in sozialen Netzwerken mit Empörung. Statt also tatsächlich zu debattierten, wurde das Argument einer vermeintlichen Haltung zugeordnet. Die Autorin des Artikels müsse migrationsfeindlich sein oder billige den Tod von unschuldigen Menschen. So als sei das Äußern von Argumenten an sich ein eindeutiger Beweis dafür, auf welcher Seite jemand steht.
Ein anderes Beispiel finden wir in der Klimadebatte. Hier stellt sich die Frage, wie die Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen in Zukunft sichergestellt werden soll, wenn diese Energiequellen abhängig vom Wetter sind und somit schwanken. Der Antwort auf diese Frage ließe sich journalistisch mit weiteren naturwissenschaftlichen und technischen Fragen näherkommen. Eine solche Debatte findet aber kaum statt. Dass es in der Klimadebatte überhaupt eine große Reihe an naturwissenschaftlichen und technischen Fragen zu beantworten gibt, das Thema also äußerst komplex ist, das spiegelt das Mediensystem nicht wider. Stattdessen werden Argumente, die der Debatte zuträglich sind, geordnet und zwar wieder in ein binäres Schema: pro oder contra Klimaschutz.
„Wenn ein Argument oder auch nur die Nähe zu einem Argument in ein solches binäres Schema eingeordnet wird, dann ist der Negativwert dieses Schemas (böse/Feind/falsch) unsagbar.“
Dieses Ordnungsunterfangen im Mediensystem ist der Versuch, Informationen zu verarbeiten, die störend wirken. Der Prozess verläuft dabei nicht auf der Ebene der Debatte, also mit Argumenten, die sich in der Realität bewähren, sondern auf der Metaebene. Er nutzt Zuordnungen der Form: Aussage A ist gleichbedeutend mit Haltung H. Auf diese Weise kommen auch journalistische Kommentare zustande, deren Argumentation hinausläuft auf die Form: „Aussage A offenbart Haltung H und ist somit abzulehnen.“ Es erklärt außerdem, wie es sein kann, dass im Journalismus mit Begriffen wie „Klimaleugner“ oder „Coronakritiker“ gearbeitet wird: Die Debatte verlässt den Boden der Realität und verlagert sich auf die Metaebene, die geprägt ist von Form-, Gefühls- und Haltungsfragen. Wichtig ist hier nicht, ob ein Argument eine Frage beantworten kann, sondern wo dieses Argument zu verorten ist, wie es geäußert wird, von wem es (sonst noch) geäußert wird oder aus welchen angeblichen Gründen es geäußert wird. Argumente sind nicht einfach, sondern sie sind, was sie angeblich bedeuten.
Wir beobachten hier etwas, das der Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber als Autopoietisierung des Journalismus bezeichnet, womit der Kreis zur Luhmannschen Systemtheorie wieder geschlossen wäre: Journalismus reproduziert sich selbst, indem er sich zunehmend auf sich selbst bezieht 12, statt sich mit der Welt da draußen zu befassen. Journalisten schreiben über Journalisten, YouTuber sprechen über Politiker, Politiker twittern über Journalisten, woraufhin Journalisten wieder über twitternde Politiker schreiben oder über Journalisten, die ebenfalls über Politiker schreiben, dabei aber die falschen Worte benutzen. All das findet statt in einem modernen Mediensystem, das klarzukommen versucht mit Komplexität und Informationen, die störend wirken, da sie an Bekanntes anschließen wollen, aber irgendwie nicht so recht zum Bekannten passen. Möglicherweise erklärt dieser Selbstbezug des Journalismus auch, weshalb so viele Menschen den Eindruck haben, der Journalismus würde lügen oder falsch informieren: Da er sich ständig auf sich selbst bezieht und große Teile der Welt außen vor lässt, erscheint er Zuschauern als Sandbox für journalistisch-aktivistisches Wunschdenken, das mit der Lebensrealität „draußen“ kaum etwas zu tun hat. Und weil diese Zuschauer sich das nicht gefallen lassen, kommentieren sie sich online in Rage, werden damit selbst zu Medienproduzenten, über die sich der Journalismus selbst dann wieder ereifern kann.
Fazit
Es zeichnen sich drei Entwicklungen ab:
- Das moderne Mediensystem ist so vielfältig wie noch nie. Es ist kein abgeschottetes System, sondern durchlässig. Wir alle können Teilnehmer sein und zwar als stille Zuschauer oder aber als produzierende Rezipienten, auf deren Informationen sich klassische Medien beziehen.
- Je besser die Möglichkeiten, uns ausgiebig und wahrheitsgemäß über jedes nur erdenkliche Thema zu informieren, desto komplexer die Aufgabe der Meinungsbildung und desto größer ist unser Drang, Ordnung zu schaffen. Da wir angesichts der Flut der Informationen häufig überfordert sind, schaffen wir Ordnung über die Metaebene. Hier zählen statt Argumenten Haltung, Gefühl, Gruppendenken.
- Ordnung schaffen wir am einfachsten durch ein binäres Schema, also Freund/Feind, gut/böse oder richtig/falsch.
Für die Meinungsvielfalt hat das natürlich Konsequenzen. Wenn ein Argument oder auch nur die Nähe zu einem Argument in ein solches binäres Schema eingeordnet wird, dann ist der Negativwert dieses Schemas (böse/Feind/falsch) unsagbar. Es ist zwar Information, aber es ist falsche oder unerwünschte Information – und zwar selbst dann, wenn das Argument valide ist und einen Beitrag zur Problemlösung leisten könnte. So werden letztlich auch die Träger dieser Argumente zu Trägern negativer Information und damit zu Personen, über die man sich zwar ereifern darf, die aber selbst nicht mitreden sollen.