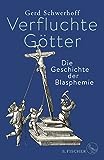18.08.2023
„Der Mechanismus war und ist letztlich immer derselbe“
Interview mit Gerd Schwerhoff
Gotteslästerung zieht sich als Thema durch die Geschichte. Heute wird die Diskussion über Blasphemie identitätspolitisch aufgeladen, und meist geht es um den Islam.
Christian Zeller: Der Begriff der Blasphemie bzw. der Gotteslästerung wirkt in westlichen, säkularen Gesellschaften, in denen bei den großen christlichen Kirchen die Mitglieder in Scharen austreten, fast ein wenig aus der Zeit gefallen. Monty Pythons „Das Leben des Brian“ sorgte im Jahr 1979 noch für heftige Proteste und Boykottaufrufe christlicher Gruppierungen. Immerhin noch Mitte der 1990er Jahre konnte die Satire-Zeitschrift Titanic mit der Abbildung von Jesus, der am Kreuz hängend eine Klopapierrolle in den Händen hält, große Empörung in katholischen Kreisen generieren. Die Darstellung war unterschrieben mit den Worten: „Spielt Jesus noch eine Rolle?“ Derartiges besäße heute wohl kaum noch Erregungspotential. Wenn in den letzten Jahren von Blasphemie die Rede war, dann eher im Zusammenhang mit der islamischen Religion.
Hier hat sich das mediale Erregungspotential allerdings umgekehrt: Protestiert wurde etwa nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Jahr 2015 mit dem Hashtag: „Je suis Charlie“. Subtext war, dass ein Anschlag auf ein Presseorgan, das Karikaturen von Mohammed veröffentlicht, einen Anschlag auf jeden einzelnen Bürger in Gesellschaften mit Presse- und Meinungsfreiheit darstelle. Sie vertreten nun die These, dass wir auch innerhalb säkularer Gesellschaften eine Renaissance der Blasphemie erleben, und zwar in Bezug auf gegenwärtige, zumeist als „Identitätspolitik“ bezeichnete Bestrebungen, Gleichachtung und Gleichberechtigung für marginalisierte Bevölkerungsgruppen herzustellen. Welche Überlegung führt Sie zu dieser Auffassung?
Gerd Schwerhoff: Wie Sie sagen, spielte das Thema Blasphemie bei den globalen Auseinandersetzungen zwischen „der“ islamischen Welt und „dem“ Westen (schon in dieser Gegenüberstellung stecken freilich fragwürdige Behauptungen über vermeintliche kollektive Identitäten) seit den 1990er Jahren eine Schlüsselrolle. Tatsächlich oder vermeintlich herabwürdigende Darstellungen des Islam wurden von bestimmten Akteuren, von totalitären Machthabern wie im Iran oder von fundamentalistisch eingestellten Moralunternehmern, skandalisiert und führten zu Wellen öffentlicher Empörung unter den Betroffenen. Dabei war es letztlich egal, ob es um einen dicken Roman ging wie im Fall von Salman Rushdies „Satanische Verse“, um eine Satirezeitschrift wie Charlie Hebdo, die von einer laizistischen Perspektive aus sich unterschiedslos über alle Religionen lustig machte, oder um die Mohammed-Karikaturen, mit denen eine dänische Zeitung 2005 die Toleranz „der“ Muslime auf fragwürdige Weise „testen“ wollte.
Der Mechanismus war und ist letztlich immer derselbe: Mit der Anprangerung einer „Gotteslästerung“ durch interessierte pressure groups wird ein doppeltes Ziel erreicht, nämlich der eigene Glaube unterstrichen und zugleich ein Feind geschaffen oder bekräftigt, gegen den es sich zusammenzuschließen gilt. Tatsächlich funktionierte der westliche Gegendiskurs zur Verteidigung der Meinungsfreiheit bisweilen ein Stück weit ähnlich, indem die Blasphemie regelrecht zelebriert wurde – Herabsetzung der fremden Religion gleichsam als ‚heilige Pflicht‘ zur Verteidigung der Freiheit. Insofern gibt es in den säkularisierten Gesellschaften des Westens vielleicht nicht eine Renaissance der Blasphemie im buchstäblichen Sinn, aber doch ähnliche Mechanismen. Auch wenn es nicht um Religion im traditionellen Verständnis geht, dann aber doch um gewisse heilige, unverfügbare Werte, die nach eigenem Verständnis den Kern der eigenen Identität ausmachen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, auf der Rechten traditionell „Volk“ oder „Nation“. So kann die Entweihung der Nationalflagge als blasphemischer Akt angeprangert werden. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums geht es in der Regel um Menschenrechte und Menschenwürde, etwa um soziale Gleichheit bzw. den Anspruch aller darauf, mit Achtung und Respekt behandelt zu werden. Das sind zunächst einmal fundamentale Werte, deren Geltung m.E. unbestreitbar ist. Allzu oft jedoch wird der Vorwurf, diese Werte verletzt und andere herabgewürdigt zu haben, zu einer Waffe in der Hand bestimmter Interessengruppen, die die Meinungsfreiheit einzuschränken droht, ganz ähnlich, wie wir es auch in den Blasphemiedebatten der letzten Jahre gesehen haben.
„In der Aufklärung setzte sich mehr und mehr die Auffassung durch, dass die göttliche Majestät nicht durch menschliche Sprechakte verletzt werden könne.“
Lassen Sie uns gerne unter dem Stichpunkt „Blasphemie" noch weiter auf Entwicklungen in der Gegenwart schauen. Aber zunächst: Wie stellt sich denn das Blasphemie-Phänomen in den Grundzügen aus historischer Sicht dar? Welche wesentlichen Entwicklungslinien gab es hier?
Anders als in der soeben genannten Definition von Blasphemie (Herabsetzung des Heiligen) war Gotteslästerung lange Zeit etwas sehr viel Konkreteres, nämlich buchstäblich ein Angriff auf die Ehre Gottes durch Beleidigungen und Beschimpfungen, durch Schwüre und Flüche. „Gott“ wurde dabei im christlichen Kontext sehr anthropomorph gedacht, seine Reaktionen auf die Herabsetzungen fielen sehr menschlich aus: Er wurde zornig und drohte, Strafen über die gesamte menschliche Gemeinschaft auszusenden, wenn diese den Lästerer nicht schnell und nachhaltig in die Schranken wies. Bereits im Alten Testament befiehlt deswegen Jahwe dem Moses, den Gotteslästerer durch kollektive Steinigung zu töten und ihn damit zugleich total aus der Gemeinschaft auszuschließen. Der Blasphemiker stellte den Absolutheits- und Wahrheitsanspruch der monotheistischen Religion nach deren eigener Interpretation grundlegend in Frage und musste deswegen konsequent ausgegrenzt werden.
Dieser Anspruch wurde so konsequent unterstrichen und zugleich die eigene Gemeinschaft gestärkt – eine Art von religiöser Identitätspolitik avant la lettre. Trotzdem gab es im Christentum, vermutlich mehr als in anderen monotheistischen Religionen, stets eine gewisse Kultur des Spottens und der lockeren Reden über das Religiöse – das wäre noch mal eine ganz eigene Geschichte. Bleiben wir aber beim offiziellen Diskurs über Blasphemie. Nachdem die beschriebene anthropomorphe Gottesvorstellung über lange Jahrhunderte die Vorstellung von Gotteslästerung geprägt hatte, gab es in der Aufklärung einen starken Umbruch. Mehr und mehr setzte sich die Auffassung durch, dass die göttliche Majestät nicht durch menschliche Sprechakte verletzt werden könne. Es bedürfe keiner menschlichen Gesetze, um die Ehre Gottes zu schützen, so hieß es nun. Dennoch, und das ist eine wichtige Pointe, wurden die Blasphemieverbote nun nicht einfach abgeschafft, sondern mit anderen Begründungen versehen. Eine davon (sie findet sich schon in der Antike) war, dass Religion für den Zusammenhalt von Staat und Gesellschaft so wichtig ist, dass sie nicht durch blasphemische Äußerungen geschwächt werden dürfe.
Das war im 19. und noch im 20. Jahrhundert ein wichtiger Gesichtspunkt, aber die Säkularisierung der westlichen Gesellschaften hat dem Argument weitgehend den Boden entzogen. Was bleibt, ist die Erhaltung des öffentlichen Friedens, den unser heutiger Paragraph 166 des StGB zur Religionsbeschimpfung in den Mittelpunkt stellt. Man soll nicht mit übermäßigem Spott Andersgläubigen einen Anlass zu Ausschreitungen und Gewalt bieten. Mit diesem Paragraphen könnte in Deutschland potentiell eine Koranverbrennung wie aktuell in Schweden juristisch verboten werden. Allerdings wird auch hierzulande die Meinungsfreiheit meist so stark gewichtet, dass kaum mehr blasphemische Äußerungen inkriminiert werden. Jedoch gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt, der in der Gegenwart immer stärker diskutiert wird, nämlich die Gefahr, dass durch derartige Lästerung die Gefühle – eben die Identität – bestimmter Gruppen verletzt werden und dadurch eine kollektive Abwertung passiert. Selbst der Europäische Gerichtshof hat schon in diese Richtung argumentiert.
„‚Verletzte Identitätsansprüche‘ sind nicht einfach so gegeben, sondern sie werden kulturell konstruiert, also konkret behauptet und beklagt oder eben bestritten.“
Die Aufklärung in westlichen Gesellschaften hat also dafür gesorgt, dass Blasphemie im wörtlichen Sinne als Gotteslästerung an Bedeutung verloren hat. Die christliche Religion versorgt liberale Demokratien schlicht nicht mehr mit einem allumfassenden „transzendentalen Obdach" (G. Lukács), so dass auch der Blasphemie-Vorwurf an Relevanz einbüßt. „Blasphemie" ist rechtlich nur insofern noch relevant, als sichergestellt werden soll, dass die verschiedenen Religionen in einer pluralen Gesellschaft friedlich koexistieren. Eine Frage stellt sich mir hier: Wieso ist der Blasphemie-Thematik für den Islam nach wie vor in diesem Maße relevant? Lässt sich das allein aus verletzten Identitätsansprüchen erklären oder hat das tiefere Ursachen?
Bei der Beantwortung dieser Frage muss ich zum Teil passen, da wären Kenner der islamischen Kulturen und Gesellschaften gefragt. Natürlich spricht manches dafür, dass Religion in nichtwestlichen Gesellschaften (noch, oder sogar wieder) wichtiger ist als z.B. in Europa; dabei habe ich allerdings den begründeten Verdacht, dass diese Gesellschaften sehr viel vielfältiger sind als wir denken. Aber das sind sehr grobe Vereinfachungen. Mein Ausgangspunkt als Historiker der Vormoderne ist die christliche Welt. Von daher bleibe ich mit einer Expertise zunächst einmal eurozentrisch, was ich im Übrigen nicht schlimm finde, wenn man diese Grenzen klar benennt.
Wenn ich aus meiner Perspektive Überlegungen zur Frage anstelle, dann würde ich bei den kommunikativen Dynamiken ansetzen, nicht bei möglichen „tieferen Ursachen“. „Verletzte Identitätsansprüche“ sind nicht einfach so gegeben, sondern sie werden kulturell konstruiert, also konkret behauptet und beklagt oder eben bestritten. Aus westlicher Sicht zu konstatieren, „der“ Islam habe eben keine Aufklärung im europäischen Sinn hinter sich bzw. er müsse diese noch in der Zukunft durchlaufen, stellt eine solche Identitätsbehauptung dar. Ebenso die Anklage, „der“ Westen treffe mit der Herabwürdigung des Propheten Mohammed die gesamte islamische Gemeinschaft rund um den Globus. Mit dieser Anklage wird von ganz konkreten Personen oder Gruppen Politik gemacht, wie wir es aus der neueren Geschichte kennen, von einem theokratischen Diktator wie Khomeini mit seinem Todesurteil gegen Salman Rushdie oder von wahhabitischen Predigern mit ihrer Anprangerung westlicher Gotteslästerungen. Offenbar treffen derartige Anklagen bei vielen Muslimen einen Nerv, die in den Lästerungen den Ausdruck westlicher Arroganz und eines gewissen Überlegenheitsgestus gegenüber dem kulturell-religiös Anderen sehen.
Interessant daran ist nicht zuletzt, dass diese Anklage von westlichen Gruppen häufig aufgegriffen und verstärkt wird. Die Rede ist dann von Islamophobie und sogar Rassismus. Unter ganz anderen Vorzeichen taucht dabei die Forderung nach einer Unterdrückung und Bestrafung blasphemischer Reden wieder auf, paradoxerweise auf der linken Seite des politischen Spektrums, die bis vor einiger Zeit gegen die strafrechtliche Ahndung von Gotteslästerung Sturm lief.
Gewiss, keine Gesellschaft und keine Religion ist ein monolithischer Block, weder „das Christentum" noch „der Islam" – aber Tendenzaussagen scheinen mir dennoch möglich. Mir sind keine derart lautstarken Proteste gegen Blasphemie in gegenwärtigen, vom Christentum geprägten Gesellschaften bekannt wie wir sie etwa kürzlich bei der Stürmung der schwedischen Botschaft im Irak angesichts der angekündigten Verbrennung eines Korans in Schweden gesehen haben – was im Umkehrschluss natürlich nicht heißt, dass nun jeder Moslem gleich die Botschaft stürmt. Diese Varianz verlangt aus meiner Sicht schon nach einer Erklärung. Aber fokussieren wir doch nun auf die gegenwärtigen kommunikativen Dynamiken, die Sie schon angesprochen haben. Welche Dynamik sehen Sie denn hinter dem Vorwurf von linksgerichteten Aktivisten, man sei „islamophob", wenn man bestimmte Phänomene innerhalb dieser Religion kritisiert? Verkörpert hier möglicherweise der Islam als Repräsentanz der vom Westen Unterdrückten genau die Unverfügbarkeit, die Sie bestimmten gegenwärtigen Strömungen innerhalb der Linken attestieren würden?
Der Clou am Unverfügbaren ist ja oft, ob in Hinblick auf die Religion oder auf allgemeine menschliche Werte, dass es eine sehr weitgehende Verfügbarkeit möglich macht. Weil Gott unbegreiflich ist, allen Blicken, allem Wollen und Sollen entzogen ist, gibt es kaum Grenzen dessen, was ihm potentiell an Eigenschaften und Gefühlen zugeschrieben werden kann. Auch kollektive Identitäten sind ja, für die jeweiligen Mitglieder der Gemeinschaft ebenso wie für die Beobachter, weitgehend unverfügbar und werden deswegen umso fröhlicher konstruiert. Bei diesen Konstruktionen, im Versuch, Identitäten greifbar zu machen, spielen Verletzungsbehauptungen regelmäßig eine zentrale Rolle, ganz wie es bei der Blasphemie der Fall ist. Es geht dann nicht mehr um eine migrantische Gemeinschaft muslimischen Glaubens, die in diesem und jenem Land diskriminiert wird (was es zweifellos gibt); auch nicht um eine konkrete „Feindlichkeit gegen Muslime als Muslime“ (Pfahl-Traughber), die es zweifellos auch gibt. Sondern es geht um die Diagnose einer grundsätzlichen Islamophobie, aus der sich die Herabsetzung „der“ Muslime durch „den“ Westen speist. Dadurch gewinnen die Ankläger eine große Diskursmacht. In „heiligem Zorn“ machen sie sich die gerechte Sache der vermeintlichen Opfer zu eigen, oft als Stellvertreter, gar nicht aus eigener Betroffenheit; und diesen heiligen, gerechten und deshalb auch bisweilen hemmungslosen Zorn richten sie gegen die vermeintlichen Täter.
„Es ist wichtig, die kommunikativen Dynamiken der identitätspolitischen Debatten aufzuzeigen und damit viele Aspekte wieder in den Bereich des Verfügbaren zurückzuholen und sie gewissermaßen kommunikativ einzuhegen.“
Sehen Sie hier Parallelen in der Geschichte?
Im Namen einer höheren Wahrheit mit fundamentalistischem Furor ein Feindbild zu konstruieren, hat natürlich eine lange Tradition. Im christlichen Kontext war (und ist) es ja gerade der exklusive monotheistische Wahrheitsanspruch, der diesen Furor befeuert: Wenn mein Glauben der alleinseligmachende ist, so müssen alle anderen falsch liegen und deswegen entschieden bekämpft werden. Für die vormoderne Welt scheint es nun bezeichnend zu sein, dass diese Ansprüche spiegelbildlich existierten, zwischen den Religionen, aber auch und gerade innerhalb der Religion. Dem Christentum ist diese innere Spaltung und Feindsetzung seit der Spätantike eingeschrieben, niemand wurde in schärferen Worten verurteilt als die Abweichler in den eigenen Reihen; lange wurden sie als „Ketzer“ verteufelt. Diese hätten das, einmal an die Macht gekommen, umgekehrt im Übrigen auch nicht anders gemacht.
Heute sind uns diese übergreifenden Wahrheitsansprüche abhandengekommen. Die „heiligen Dinge“, gegen deren Verletzung die Rechten und Populisten Sturm laufen, sind ganz andere als diejenigen, deren Verletzung die Linksidentitären beklagen. Dabei kann ich die Werte der letztgenannten im Prinzip durchaus unterschreiben: Respekt und Achtung gegenüber allen Menschen, gleich welcher geschlechtlichen Orientierung oder welcher Hautfarbe auch immer, sind als Grundlage eines gedeihlichen Zusammenlebens notwendig. Aber die stete und obstinate Suche nach möglichen Verletzungen und Mikroaggressionen droht doch die gesamtgesellschaftliche Solidarität zu unterminieren und eine klare Benennung unterschiedlicher Meinungen und Werthaltungen unmöglich zu machen, auf die ein ziviler Austrag von Streitigkeiten doch angewiesen ist. Auf diese Weise zerfiele die Gesellschaft in viele kleinere Facetten, die untereinander nicht mehr kommunizieren. Das wäre fatal.
Wie sollte man im Lichte dieser Diagnose mit den Unverfügbarkeitsansprüchen der Linksidentitären umgehen?
Ich glaube, es ist wichtig, die kommunikativen Dynamiken der identitätspolitischen Debatten aufzuzeigen und damit viele Aspekte wieder in den Bereich des Verfügbaren zurückzuholen und sie gewissermaßen kommunikativ einzuhegen. Klagen über Verletzungen kollektiver Gefühle sind ja deswegen attraktiv, weil die jeweiligen Ankläger damit gleichsam in die diskursive Vorhand kommen. Die Klage selbst ist ja schon eine Art Beweis für ihre Stichhaltigkeit, denn wenn es einen Aufschrei gibt, muss ja eine Verletzung vorangegangen sein. Demgegenüber muss es erlaubt sein, nach der Legitimität und Legitimation derjenigen zu fragen, die sich oft stellvertretend erregen. Und es sollte sichtbar gemacht werden, was und wer in der Debatte unsichtbar gemacht wird, etwa Gefühle und Interessen vieler anderer Menschen, deren Gefühle und Interessen latent gehalten werden.
Um das viel strapazierte Beispiel des Genderns zu bemühen: Ich halte es im Prinzip für richtig, soweit wie möglich Menschen sprachlich angemessen zu adressieren, die sich nicht in der binären Geschlechterordnung wiederfinden. Aber auch die Mehrzahl von Menschen, die sich dort im Prinzip wohlfühlen, haben ein legitimes – wenn man so will: identitätspolitisches – Recht darauf, ihre eigenes So-Sein sprachlich ausgedrückt zu finden, ohne dabei negativ stigmatisiert zu werden. Ansonsten kommt die gesamtgesellschaftliche Solidarität ganz unter die Räder. Um also die Frage noch mal aufzugreifen: Ich würde stets versuchen, einen Schritt zurückzutreten und öffentlich zu thematisieren, wie wir mit derlei „heiligen Dingen“ umgehen, und dass sie vielleicht nicht ganz so heilig sind. Das würde vielleicht auch ein wenig zur Gelassenheit beitragen, und die stünde allen Seiten gut zu Gesicht.
Besten Dank, Herr Schwerhoff, für die anregende Konversation.
Das Interview führte Christian Zeller.