22.05.2015
Billiges Geld ist keine Lösung
Analyse von Phil Mullan
Nach der Wirtschaftskrise werden die Rufe nach einer strengen Regulierung der Finanzwirtschaft lauter. Das Problem ist jedoch die Schwäche der Realwirtschaft. Die Krise kann nur durch Investitionen und Produktionssteigerungen überwunden werden.
In letzter Zeit wurde in den Wirtschaftsnachrichten häufig über das Maßnahmenpaket der Europäischen Zentralbank (EZB) berichtet. Das Paket ist ein weiterer Versuch, die träge Wirtschaft der Eurozone anzukurbeln. Dazu gehört als neue Maßnahme auch ein negativer Zinssatz für Unternehmen, die kurzfristig Geld bei der EZB deponieren wollen. Die Banken müssten also für das Privileg bezahlen, Geld in die EZB zu befördern. Das klingt nach einem verzweifelten Versuch die Banken dazu bringen, ihr Geld an jemanden zu verleihen, der es für etwas ausgeben könnte.
Währenddessen verlassen sich die US-amerikanischen, britischen und japanischen Zentralbanken weiterhin auf die „unkonventionelle“ Geldpolitik der quantitativen Lockerung (engl.: Quantitative Easing). Damit möchten sie für ihre jeweilige Wirtschaft dasselbe erreichen wie die EZB. Quantitative Lockerung ist der Mechanismus, bei dem die Banken finanzielle Anleihen kaufen, um viele Milliarden Euro zusätzliches Geld locker zu machen – in der Hoffnung, dass die Leute dann mehr davon ausgeben. Es scheint so, als sei die Politik des leichten Geldes überall das offizielle Mittel der Wahl. Es gibt sogar Gerüchte, dass China angesichts seines derzeitigen ökonomischen Gegenwinds ein eigenes Projekt der quantitativen Lockerung in Angriff nehmen könnte.
„Um diese Krise zu überwinden, ist etwas ganz anderes nötig als ein weiteres Maßnahmenpaket mit ‚leichtem Geld‘“
Diese allgegenwärtige und fast ausschließliche Abhängigkeit von geldpolitischen Maßnahmen seitens der staatlichen Wirtschaftspolitik wirkt auf den ersten Blick nicht sonderlich spannend. Vielleicht erscheint diese Entwicklung nur relevant, wenn man ein Haus kauft und sich fragt, was für eine Hypothek man aufnehmen sollte. Man denkt womöglich auch darüber nach, wenn man sich mit seinen Haushaltsfinanzen beschäftigt. Man könnte sich Sorgen machen, dass die Ersparnisse aufgrund des negativen Zinssatzes ihren Wert zu verlieren drohten. Ist es mal wieder an der Zeit, die Ökonomie als „trostlose Wissenschaft“ zu schelten?
Nein, keineswegs. Die zugegebenermaßen trockene Geldpolitik beeinflusst wesentlich mehr als die persönlichen Haushaltsfinanzen. Es ist wichtig für unsere Zukunft, das zu verstehen.
Geldpolitik wird dieser Tage oft „die einzige Option“ genannt. Da ist was dran, doch diese Option hat ihre natürlichen Grenzen. Debatten über Zinssätze oder über andere Arten der Geldpolitik – konventionell, unkonventionell oder Steuerung der Inflation, des Preisniveaus oder der Solleistung –, sind nicht nur wegen der technischen Pros und Contras interessant. Das gilt auch für Diskussionen über die damit verbundene sogenannte Geldpolitik auf Makroebene, die ebenfalls von den Zentralbanken ausgeht. Diese Debatten sind auch darum aufschlussreich, weil man an ihnen erkennt, auf welchen kleinen Bereich sich der Staat bei seiner Wirtschaftspolitik beschränkt.
All die Aufmerksamkeit, die sich auf die Geld- und Finanzpolitik richtet, sagt uns drei Dinge über den Versuch des Westens, seine kränkelnde Wirtschaft anzukurbeln. Erstens über die Politik, zweitens über die Wirtschaft und drittens über die Möglichkeit, die aktuellen ökonomischen Probleme zu lösen. Um diese Krise zu überwinden, ist etwas ganz anderes nötig als ein weiteres Maßnahmenpaket mit „leichtem Geld“. Eine grundlegende Umstrukturierung und der Einsatz für eine umfassende und radikale Renaissance der Wirtschaft sind erforderlich. Leichtes Geld ist kein Schritt in diese Richtung. Vielmehr verschleiert es die dringende Notwendigkeit einer wirklichen Veränderung.
Wirtschaftspolitik verliert ihren demokratischen Anker
Zunächst zur politischen Aussage dieses Artikels: Die finanzpolitische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik zeigt auf, wie technokratisch und apolitisch sie inzwischen geworden ist.
Bemühungen, die Wirtschaft wiederzubeleben und uns sichere, gut bezahlte Jobs zu bescheren, wurden auf die schnelle Verfügbarkeit billiger Kredite für Unternehmen und Privathaushalte reduziert. Es lässt sich nicht verschleiern, dass man hier nur an bürokratischen Knöpfchen dreht. Zentralbanken investieren und produzieren nichts, noch bauen sie etwas auf. Sie setzen lediglich ein paar technische Parameter für die Kosten und Verfügbarkeit von Geld fest, das andere, reale ökonomische Akteure in der Wirtschaft nutzen sollen. Wie Mark Carney, der Direktor der Bank von England, kürzlich betonte: Zentralbanken haben nur eine begrenzte Kontrolle über die Hypothekenblase, über die so viel geredet wird. „Wir von der Bank von England werden kein einziges Haus bauen“, sagte er. „Wir haben keinen Einfluss darauf.“ [1] Ein wichtiger Hinweis – und diejenigen, die von Zentralbanken so viel erwarten, sollten vielleicht ein wenig darüber nachdenken.
Geldpolitik ist der Teil der Politik, der am weitesten von der politischen Sphäre und der demokratischen Rechenschaftspflicht entfernt ist. Eines der großen geldpolitischen Themen der letzten 30 Jahre war die Erklärung der „Unabhängigkeit“ der Zentralbank von der Regierung. Diese Erklärung war von der Vorstellung getragen, dass man diesen lästigen Politikern nicht so etwas Wichtiges wie den Wert des Geldes und die Kontrolle der Inflation anvertrauen kann. Demnach waren die unschlüssigen Politiker und nicht die tieferen systemischen Probleme für die Inflation der 1970er-Jahre verantwortlich. Das war eine Zeit, in der sich der Nachkriegsboom verflüchtigte und die Inflationsrate der ökonomische Indikator wurde, über den man am meisten sprach.
„Die Unabhängigkeit der Zentralbanken war schon immer ein Stück weit fiktional“
Die Idee einer „unabhängigen“ Zentralbank war damals schon nicht neu. Die Deutsche Bundesbank, die 1957 gegründet wurde, wurde zum Modell für die modernen unabhängigen Zentralbanken. Mit der Deutschen Bundesbank distanzierte sich die neue Bundesrepublik von den Krisen der Weimarer Republik und den darauffolgenden Schrecken der Nazi-Zeit. Ihr institutionelles Vermächtnis der Unabhängigkeit von demokratischer Politik lebt bis heute in den Maastrichter Verträgen fort. Diese Verträge begrenzen den Bewegungsspielraum für die EZB. Insbesondere ist es der Zentralbank der Eurozone nicht gestattet, von Regierungen Schuldtitel zu kaufen und damit die Ausgabenpolitik der Europäischen Union zu finanzieren. So erklärt sich das bisherige Zögern der EZB, wie die anderen großen Zentralbanken eine quantitative Lockerung durchzuführen. Es mussten bislang andere Wege gefunden werden, Liquidität in die Finanzmärkte der Eurozone zu pumpen.
In der ersten Phase des Konjunkturrückgangs nach dem Ende des Nachkriegsbooms konnte die amerikanische Notenbank unter ihrem strengen Vorsitzenden Paul Volcker Anfang der 1980er-Jahre erfolgreich die Inflation eindämmen. Daher kam die Idee, unabhängigen Zentralbanken mehr Autorität zu verleihen. Seitdem ist „Unabhängigkeit“ von der Regierung zu einer Orthodoxie des Zentralbankenwesens geworden. So bestand 1997 eine der ersten Maßnahmen der neuen Labour-Regierung in Großbritannien darin, die „operationale Unabhängigkeit“ der Bank von England bekanntzugeben.
Die Unabhängigkeit der Zentralbanken war schon immer ein Stück weit fiktional, wie der Historiker Niall Ferguson schreibt: „Historisch betrachtet war die [Unabhängigkeit der Zentralbanken] schon immer von den Bedürfnissen des Staates abhängig.“ [2] Die Idee einer solchen Unabhängigkeit spiegelt jedoch den Zeitgeist der Entpolitisierung wirtschaftlicher Fragen treffend wider. Das Ende von inneren sozialen Auseinandersetzungen im Westen sowie der Einflussverlust der Linken und der Arbeiterparteien in den 1980er-Jahren führte zur universellen Akzeptanz der Marktorganisation als dem natürlichen Lauf der Dinge.
„Politiker waren nunmehr damit zufrieden, einen Platz auf der Rückbank der Wirtschaftspolitik einzunehmen“
Der symbolträchtige Fall der Berliner Mauer vor einem Vierteljahrhundert und die darauf folgende Implosion des Sowjetblocks, die den Kalten Krieg beendete, bestätigten die scheinbare Abwesenheit jeglicher Alternativen zum Markt. Eine Kernfrage der Wirtschaftswissenschaften – ob der Markt für die Gesellschaft nützlich oder schädlich ist – war damit nicht länger Gegenstand der politischen Auseinandersetzung. Es schien, als würde jeder den Markt als richtigen Weg für die Wirtschaft anerkennen, von Washington bis Peking.
Diese universelle Akzeptanz des Marktes schien die Idee von einem Minimalstaat zu stützen. Regierungen hatten demnach bei der Förderung von Wachstum und wirtschaftlicher Entwicklung kaum eine legitime Rolle zu spielen. Es wurde behauptet, dass die Zeit der Mischwirtschaft vorbei sei. Man erkannte die Grenzen staatlicher Wirtschaftsinterventionen, als in den 1970er-Jahren die keynesianische Finanzpolitik diskreditiert wurde – sie wurde für die Inflation verantwortlich gemacht. Die Erkenntnisse fügten sich nahtlos in den aufkommenden Zweifel ein, ob wirtschaftliches Wachstum an sich etwas Gutes für die Gesellschaft ist. Es war die Zeit der aufkommenden Sorgen über die ökologischen Auswirkungen wirtschaftlicher Entwicklung. Von nun an wurde das lose definierte, aber die Wirtschaft hemmende Konzept der „nachhaltigen Entwicklung“ verfolgt.
Als politische Folge der neuen Übereinstimmung über den Markt und der wachsenden Vorbehalte über die Vorzüge von Wachstum, waren die Politiker nunmehr damit zufrieden, einen Platz auf der Rückbank der Wirtschaftspolitik einzunehmen. Gott bewahre, dass Politiker selbst eine Führungsrolle zugunsten eines wirtschaftlichen Wandels einnehmen sollten – von einer wirtschaftlichen Erneuerung ganz zu schweigen. Sie waren darauf erpicht, Autorität an andere abzugeben, in erster Linie an die Zentralbanken. Den „unabhängigen“ Zentralbanken finanzpolitische Verantwortung zu übertragen, gehörte also zu einem allgemeinen Trend, die Wirtschaftspolitik von der politischen Sphäre abzutrennen. Die Folge: Der einflussreichste Aspekt der wirtschaftspolitischen Gestaltung wurde von der Rechenschaftspflicht der demokratisch gewählten Regierung losgelöst.
Der Finanzmarkt-Kapitalismus als Verfallssymptom
Zweitens zeigt die Konzentration auf Geldgeschäfte, wie weitgehend die westlichen Volkswirtschaften bereits „finanzialisiert“ sind – d.h. sie werden stark von Entwicklungen im Finanzwesen bestimmt und ihr Wohlstand hängt mehr und mehr von diesem ab. Die westlichen Volkswirtschaften haben mit diesem Wandel auf die Konjunkturschwäche der Produktions- und Dienstleistungssektoren nach 1970 reagiert. Kurz gesagt: Der Finanzsektor ist expandiert, um die neuen Schwächen des Produktionssektors auszugleichen.
Dies deutet auf mehr als einen besonders aktiven oder großen Finanzsektor hin – der Sektor erlebte seinen Aufstieg unter Bedingungen, unter denen sich die endogene Expansion des Produktivkapitals verlangsamte; exakt jene Bedingungen, die wir seit den 1970er-Jahren erleben. Gekennzeichnet durch abrupte Rückgänge der Rentabilität, der Investitionen und des Produktivitätswachstums verlassen sich die westlichen Volkswirtschaften immer mehr auf die Mechanismen des Finanzwesens.
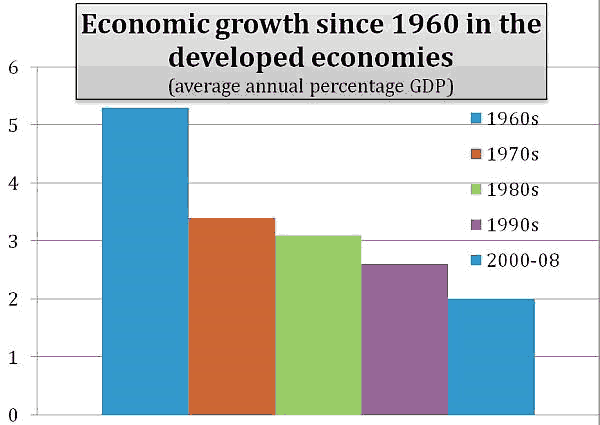
Abbildung 1: Wirtschaftswachstum seit 1960 in den Industrieländern (durchschnittlicher jährlicher Prozentanteil am Bruttoinlandsprodukt). Quelle: McKinsey Global Institute.
Staatliche Eingriffe in die Wirtschaft finden schwerpunktmäßig im Geld- und Finanzbereich statt – ein Symptom dieser Verschiebung. In Volkswirtschaften, in denen die Bedeutung des Finanzsektors zugenommen hat und, noch wichtiger, wo sich Unternehmen außerhalb des Finanzsektors relativ gesehen mehr mit der Erstellung von Finanzprodukten als mit der physischen Produktion befasst haben, sah der Staat sich veranlasst, auch in diesen Bereichen aktiv zu werden. Er wollte damit Finanzdienstleister unterstützen oder Finanzaktivitäten erleichtern. Die durch die Aushöhlung des produzierenden Gewerbes entstandene Finanzialisierung führt zu einer Bevorzugung von Finanzierungstätigkeiten. Hier kommen die Zentralbanken ins Spiel, die nun eine wichtigere Rolle innerhalb des Staates einnehmen. Der Staat hat diesen Entwicklungen nicht passiv zugesehen; er hat die Finanzialisierung aktiv unterstützt, sie vorangetrieben und versucht, das Beste aus diesem Strukturwandel zu machen.
Kennzeichen der Finanzialisierung
Was zeichnet die Finanzialisierung aus? Finanzgeschäfte ziehen das verfügbare Geld an, das nicht länger im produktiven Sektor investiert wird. Die Finanzgeschäfte können so die Wirtschaft über einen unbestimmten Zeitraum stützen. Für eine finanzialisierte Wirtschaft ist es typisch, dass sie zwar weniger auf das Schaffen neuer Werte ausgerichtet ist, dieses Defizit aber bis zu einem gewissen Grad ausgleichen kann. Kreditverlängerungen sind hier die klassischen Methoden. Sie erlauben Unternehmen und Privatpersonen weiterzuarbeiten, obwohl die neu geschaffenen Werte relativ unzureichend sind. Kredite und die Ausweitung der Verschuldung machen es möglich, dass weiterhin Güter produziert und konsumiert werden, obwohl der Wertschöpfungsprozess beeinträchtigt ist.
Das McKinsey-Diagramm unten veranschaulicht die allgemeine Zunahme der Verschuldung in den entwickelten Volkswirtschaften seit den 1980er-Jahren. Das Diagramm zeigt, dass die Verschuldung in den schwächer entwickelten Volkswirtschaften am schnellsten zugenommen hat, etwa in Großbritannien. Die britische Gesamtverschuldung stieg von unter 200 Prozent des Bruttoinlandsproduktes Mitte der 1980er-Jahre auf ca. 500 Prozent am Vorabend der Finanzkrise an. Dieser Anstieg ist teilweise der Rolle Großbritanniens als internationales Bankenzentrum geschuldet, die wiederum Ausdruck einer starken Finanzialisierung ist. Auch in den USA stieg die Verschuldung in diesem Zeitraum signifikant an, nämlich von ca. 170 Prozent auf ca. 300 Prozent. Eine Existenz auf Kredit heißt im Wesentlichen, potentielle zukünftige Gewinne aufzuzehren, statt von aktuell produzierten Werten zu leben. Nicht einmal die aufkeimende Angst vor einem exzessiven Schuldenniveau im Zuge der Finanzkrise konnte dem Schuldenwachstum ein Ende setzen. In den meisten westlichen Staaten sind seit 2008 die Schulden im Verhältnis zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt weiter angestiegen. Auch in den USA, die als erfolgreichste Nation bei der Schuldenreduzierung gelten, ist der Wert nur minimal gefallen – von 357 Prozent im Jahr 2008 auf 346 Prozent im Jahr 2013 [3].
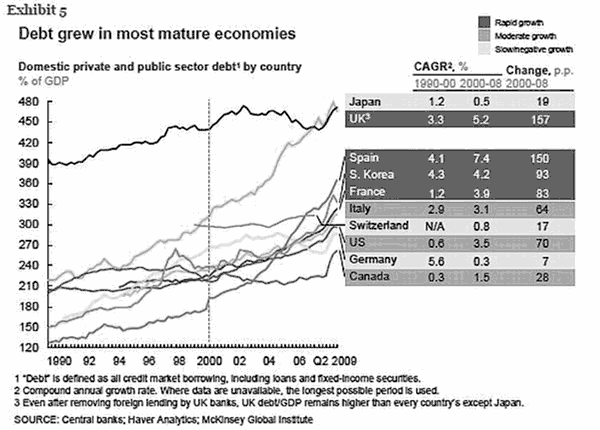
Abbildung 2: Die Verschuldung ist in den meisten Ländern gestiegen. Verschuldung des privaten und öffentlichen Sektors nach Ländern in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Quelle: McKinsey Global Institute.
Der Wandel zu einer finanzialisierteren Wirtschaft geht aus einer bestimmten Beziehung des Finanzwesens zum Rest der Wirtschaft während normalerer ökonomischer Verhältnisse hervor. Dazu gehören etwa das 19. Jahrhundert in Großbritannien oder der Boom in allen Industrienationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals war das Finanzwesen ein wichtiger Bestandteil des Tagesgeschäfts. Es half dabei, die Herstellung von Waren und Dienstleistungen zu finanzieren.
„Geld hat keinen Wert an sich“
Das Finanzwesen ist daher ein charakteristischer Teil der Wirtschaft. In Zeiten eines relativ stabilen Wirtschaftswachstums sieht man das Finanzwesen allerdings meist als dem Produktionssektor untergeordnet an. Finanzdienstleistungen schaffen keine neuen Werte. Ein Banker zu sein galt nie als besonders unehrenhaft – eher als ein wenig langweilig –, aber unter wirtschaftlichen und kulturellen Gesichtspunkten wurde ein Produzent als deutlich wichtiger für die moderne Lebensweise und den Wohlstand angesehen. Egal, ob über das Kräftegleichgewicht im Kalten Krieg, das Aufkommen der Konsumgesellschaft und der Werbung oder einfach über die Sicherstellung der Vollbeschäftigung diskutiert wurde: Man erkannte instinktiv, dass es auf die Produktion ankam. Die Produktion war von übergeordneter Bedeutung. Zunächst natürlich die Produktion von Gütern (von Rohmaterialien bis hin zu Lebensmitteln, Autos, Haushaltsgeräten, Schiffen und Flugzeugen), immer mehr aber auch von Dienstleistungen – nicht zuletzt durch den Aufstieg der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie (TV, Filme; Reisen und Hotels) sowie des Gastgewerbes (Restaurants) im 20. Jahrhundert.
Die ökonomisch und kulturell untergeordnete Rolle des Finanzwesens existierte zeitgleich mit einer fantastischen Vorstellung über einen Aspekt des Finanzwesens, der nichts mit neu erzeugten Werten zu tun hat. Im Finanzwesen scheint Geld ein Mittel für die Schaffung von mehr Geld zu sein und die Rolle der Produktion kann leicht in den Hintergrund gedrängt werden. Dabei sind es die neuen, durch die Produktion erzeugten Werte, die das „zusätzliche“ Geld in Form von Dividenden und anderen Erträgen der Kapitalanlagen hervorbringen.
Diese Vorstellung macht die wahre Besonderheit des Geldes aus: Geld, außer in seiner klassischen Form von Gold (das keine Rolle mehr spielt, seit alle großen Währungen in der Zwischenkriegszeit offiziell vom Goldstandard entkoppelt wurden), hat keinen Wert an sich. Geld ist vielmehr ein Wertmaßstab, ein Preis für etwas. Diese vermittelnde Beziehung zu einem Wert führt dazu, dass der Preis flexibler als sein zugrundeliegender Wert ausfällt. Preise können schwanken, während Werte feststehen. Denken Sie daran, wie der Preis ein und desselben Hauses schwanken kann, selbst wenn Sie physisch nichts an dem Haus verändert haben, wie eine Erweiterung des Dachbodens oder das Anlegen einer Terrasse.
Fiktive Werte
Die Trennung von Preisen und Werten, und daher die Abtrennung der Preise von der Produktion, bedeutet auch, dass sich Preise an Dinge binden können, die an sich keinen Wert haben. Zum Beispiel Unternehmensaktien oder Kreditverbriefungen – ein Schlagwort der letzten Finanzkrise. Bei der Kreditverbriefung werden Privatkredite von Individuen neu verpackt und an Investoren verkauft. Der Wert dieser Finanzanlagen ist fiktiv. Sie sind erfunden und können auf dem Finanzmarkt ge- und verkauft werden. Sie sind keine Anlagen, die neue Werte erschaffen. Der Besitz von Gesellschaftsanteilen macht einen zum Teilinhaber eines Unternehmens und zum Teilhaber von potentiellen Profiten in der Zukunft, aber das Papier oder elektronische Zertifikat kann an sich nicht mehr Wert schaffen. Man kann nicht einmal mit diesem Zertifikat, mit einer Aktie, ein Unternehmensgrundstück betreten und sagen: „Ich besitze einen Teil von dieser Maschine, also gebt mir ein bisschen von dem, was sie heute produziert hat.“ Man besitzt in Wirklichkeit einen Teil des Unternehmens als Institution, aber keinen Teil des physischen Kapitals.
All diese realen Eigenschaften der Kluft zwischen Wert und Preis, und damit zwischen Produktion und Finanz, liefern der Finanzialisierung die Startgrundlage, sobald die Produktion neuer Werte in chronische Schwierigkeiten gerät. Diese Ablösung des Preises vom Wert ist in „guten“ Zeiten eine reizende, wenn auch manchmal leicht irritierende Eigenschaft der Finanzen – wenn z.B. ein Produzent oder Hauseigentümer nicht den Preis für sein Gut oder seinen Vermögenswert erhält, den er haben will. In schlechten Zeiten, wie in den 1970er-Jahren, dient sie inzwischen als Rettungsanker. Die Finanzindikatoren der Wirtschaft können auf Grundlage der aktuellen Wertschöpfung viel besser aussehen, als die Dinge in Wirklichkeit stehen.
„In Finanzkreisen ist das „Risiko einer Fehlbewertung“ bekannt“
Diese Illusion wirtschaftlicher Stärke bedeutet jedoch auch den Niedergang der Finanzialisierung. Die scheinbare Stabilität, die man geschaffen hat, führt letztlich zur Instabilität. Wie die nicht-finanzialisierte Marktwirtschaft letztlich durch einen Rückgang der Profitabilität zur Krise neigt, so neigt auch die finanzialisierte Marktwirtschaft zur Krise, aber aus einem anderen Grund. Der Grund lautet, dass die geschaffene Stabilität im Hier und Jetzt die Weiterführung der Finanzialisierungsaktivitäten ermöglicht, bis die Lücke zwischen Wert und Preis zu groß wird. Das Potenzial für Preisverzerrungen bei Finanzanlagen ist in der Finanzialisierung angelegt – in Finanzkreisen ist es als „Risiko einer Fehlbewertung“ bekannt. Solche Verzerrungen sind durch die fehlende Verankerung in der Produktion unausweichlich. Die Liquiditätsoperationen der Zentralbanken beschleunigen diesen Prozess.
Schließlich platzt die Blase – der konkrete Auslöser für diesen Vorgang ist normalerweise unvorhersehbar und könnte einer von vielen sein – und dann folgt die Implosion. Letztes Mal waren es die Hauspreise in den USA und zweitklassige Hypotheken. Es hätten aber auch andere, mit falschen Preisen versehene, zu hoch bewertete Finanzanlagen sein können. Die Implosion zieht sich für gewöhnlich durch die gesamte vernetzte Finanzwirtschaft und bringt die Welt dem Wirtschaftsdesaster ein Stück näher, dem sie nie wirklich entkommen ist.
Finanzialisierung sogar in der Industriewirtschaft
Finanzialisierung erkennt man oft an einem wachsenden Finanzsektor – besonders im Falle Englands, das als weltweiter Finanzmittelpunkt besonders betroffen war. Das wichtigere und charakteristische Merkmal der Finanzialisierung ist allerdings die Aufnahme von Finanzaktivitäten außerhalb des Finanzsektors, nämlich durch die Industriewirtschaft im weitesten Sinne.
Das Schlüsselmerkmal der Finanzialisierung ist die Verschmelzung der Produktion mit den Finanzaktivitäten: Besorgte Unternehmen außerhalb des Finanzsektors beginnen mit Finanzaktivitäten, um ihre berichtete Profitabilität und ihre Geldschöpfung zu verstärken. Diese Finanzaktivitäten reichen von der Emission der Schuldtitel zur Finanzierung der operativen Geschäftstätigkeit, die nicht profitabel genug verläuft, bis zu finanztechnischen Maßnahmen, bei der das Kaufen und Verkaufen von Gesellschaften Vorrang vor der Vermögensanlage hat. Das Ziel besteht darin, organisches Wachstum für das zugrundeliegende Unternehmen zu erschaffen.
Daraus entsteht eine symbiotische Beziehung zwischen dem Wachstum des Finanzsektors und der Aufnahme von Finanzaktivitäten durch Industrieunternehmen. Finanzinstitute erweitern ihre Dienstleistungen, um produzierende Unternehmen bei diesem Vorhaben zu unterstützen – zum Beispiel, wenn Unternehmen mit außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen Geschäftsführern beistehen, die ihre Eigentumsverhältnisse ändern wollen. Andere Finanzunternehmen haben Derivate entwickelt, um kommerziellen Unternehmen zu helfen, sich nicht nur gegen ungünstige Veränderungen im Wert ihrer Produkte abzusichern, sondern auch gegen Veränderungen ihrer Finanzindikatoren, von denen sie zunehmend abhängig sind: Zinssätze, Devisenkurse oder einfach der Preis der Finanzanlagen.
„Der Anteil der Finanzanlagen hat im Verhältnis zu den Gesamtvermögenswerten zugenommen“
Diese Phase der Finanzialisierung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich Industrieunternehmen zunehmend verhalten, als wären sie Finanzunternehmen. Wir haben bemerkt, dass der ausschlaggebende Schlüsselfaktor, warum produzierende Unternehmen immer mehr von Finanzaktivitäten abhängen, eine systematische Schwäche innerhalb der Produktion ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass die absoluten Gewinne dieser Unternehmen sinken würden. Die Verfallserscheinung besteht nicht darin, dass die Rentabilität einen bestimmten Tiefstand erreicht, sondern darin, dass zunehmend Gewinne erzeugt werden, die keinen Bezug zu einer wachsenden Produktion haben. Stattdessen fließen sie in Finanzangelegenheiten wie den Rückkauf eigener Aktien, höhere Dividenden und den direkten Kauf von Finanzanlagen. Diese Aktivitäten haben dem Börsenpreisindex einen neuen Anreiz gegeben und verdeutlichen das paradoxe Merkmal der Finanzialisierung: Boomende Finanzmärkte, von denen man glaubt, dass sie die wahre ökonomische Zukunft vorhersagen können, gehen mit einer tatsächlichen Produktionsschwäche einher.
Man gewinnt durch die Betrachtung der Unternehmensbilanzen außerhalb des Finanzsektors einen guten Eindruck von der wachsenden Finanzialisierung. Man wird feststellen, dass der Anteil der Finanzanlagen im Verhältnis zu den Gesamtvermögenswerten zugenommen hat. Daran erkennt man die relative Verschiebung innerhalb von Industrieunternehmen von der Produktion zu Finanzanlagen.
Der Anteil der Finanzanlagen an den Gesamtvermögenswerten ist in Großbritannien von ungefähr einem Drittel Anfang der 1990er-Jahre auf mehr als die Hälfte angestiegen – mit einem Höhepunkt von 58 Prozent vor dem Börsencrash, der einige dieser Anlagen abgewertet hat.
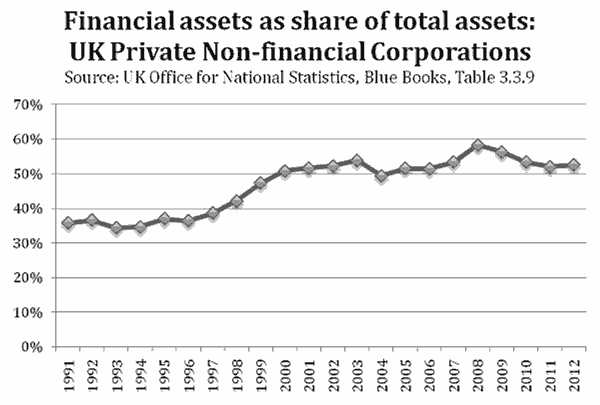
Abbildung 3: Finanzanlagen als Teil der Gesamtvermögenswerte bei britischen Privatunternehmen außerhalb des Finanzsektors. Quelle: Nationale Statistikbehörde Englands.
In den Vereinigten Staaten war die Entwicklung sehr ähnlich. Vom Ende der 1940er-Jahre bis Anfang der 1980er-Jahre blieb das Verhältnis der Finanzanlagen an den Gesamtvermögenswerten im Rahmen von 21 bis 27 Prozent. Es begann dann steil anzusteigen, um 2009 mit 49 Prozent seinen Höhepunkt zu erreichen. Daran erkennt man, dass der abrupte Anstieg der Finanzanlagen erst Anfang der 1980er-Jahre, direkt nach dem Beginn der US-Sparkassenkrise stattfand.
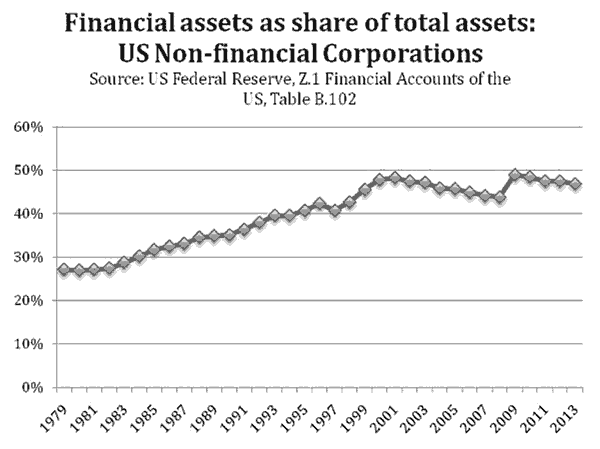
Abbildung 4: Finanzanlagen als Teil der Gesamtvermögenswerte bei US-amerikanischen Privatunternehmen außerhalb des Finanzsektors. Quelle: US-Notenbank.
Ein spezifisches Beispiel für diesen Trend ist General Electric, das führende Industriekonglomerat Amerikas. Dessen Finanzzweig GE Capital erwirtschaftet einen wachsenden Anteil am erfassten Gewinn des Unternehmens. Der Gewinn wuchs zunächst mit einem kleinen Aufschwung Anfang der 1980er-Jahre und machte Ende der 1990er-Jahre ein Drittel des Gesamtgewinnes von GE aus. Der finanzielle Gewinnanteil lieferte somit einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der restlichen betrieblichen Tätigkeiten:
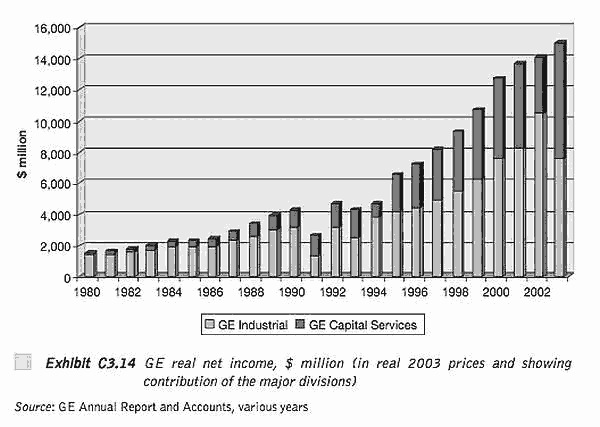
Abbildung 5: Nettogewinn von General Electric in Millionen US-Dollar (in Realpreisen von 2003 und unterteilt nach den größten Unternehmenszweigen). Quelle: G.E. Jahresberichte
Die neue Macht der Zentralbanken
Die Tendenz zur Finanzialisierung in Zeiten rückläufiger Produktion hängt mit den Eigenschaften des Geldes und der strukturellen Beziehung zwischen Finanzen und Produktion zusammen. Ein derartiges Wachstum der Finanzialisierung, wie es stattgefunden hat, war aber keine rein natürliche Entwicklung.
Die Finanzialisierung verhält sich instinktiv, wenn entwickelte Wirtschaften größere Hürden bei der erfolgreichen Produktion zu bewältigen haben. Verfügbares Kapital wird von der Finanzindustrie angezogen, die anscheinend in der Lage ist, aus Geld mehr Geld zu machen (wenigstens bis zur nächsten Finanzkrise). Und das ohne den ganzen Aufwand, tatsächlich etwas herstellen und verkaufen zu müssen. In diesem grundlegenden Sinne ist die Finanzialisierung nicht das Ergebnis einer bewussten Intervention, um die Banken auf Kosten der Produzenten zu bevorzugen. Sie ist nicht die Folge einer politischen Entscheidung.
„Die Regierungen der westlichen Welt haben die finanzialisierte Wirtschaft begünstigt und unterstützt“
Es ist dem Staat nicht gelungen, die produktiven Wirtschaftsbereiche wiederzubeleben. Er hat außerdem die finanziellen Aspekte der modernen Wirtschaft gestärkt. Dadurch hat er die spezifische Weise, wie sich die Finanzialisierung entwickelt hat und wie sie funktioniert, erschaffen. Aus diesem Grund ist es berechtigt, die Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte nicht nur als Finanzialisierung, sondern als „staatliche Finanzialisierung“ zu bezeichnen.
Die Regierungen der westlichen Welt haben die finanzialisierte Wirtschaft begünstigt und unterstützt. Sie haben zugeschaut, wie die Verschuldung wuchs und das Finanzsystem die Führung übernahm. Die englische Hauptstadt London, ein historisches Denkmal der industriellen und kommerziellen Herrschaft Großbritanniens im 19. Jahrhundert, erhielt am Ende des 20. Jahrhunderts staatliche Unterstützung, um den Produktionsrückgang auszugleichen. Dies wurde ab Anfang der 1960er-Jahre besonders deutlich, als der britische Staat London als Offshore-Handelszentrum des entstehenden Euro-Dollar-Markts etablieren wollte (dabei werden US-Dollar gehandelt, die außerhalb der Vereinigten Staaten und daher nicht unter der Aufsicht der US-Notenbank gehalten wurden). Neuen Schwung bekam die Entwicklung ab den 1980er-Jahren, als Großbritannien mit seinen „Big Bang“-Reformen des Finanzsektors von 1986 die Finanzialisierung direkt vorantrieb.
Koexistenz von Regulierung und Deregulierung
Die Geschichte von der „neoliberalen“ Deregulierung der Finanzmärkte ist von daher einseitig. Einzelne Deregulierungsmaßnahmen sind gewiss kein Zeichen für einen kleineren, passiveren Staat. Die Regulierung des Finanzsystems dient seit den 1970-Jahren dem Ziel, die Finanzialisierung auszuweiten, um die Wirtschaft zu stützen. Diese regulativen Veränderungen traten nicht einfach spontan ein, sondern sie waren das Ergebnis absichtlicher staatlicher Eingriffe. Es wurden beispielsweise einige der bestehenden Restriktionen für Finanzinstitutionen aufgehoben. Exemplarisch war die Aufhebung des amerikanischen Glass-Steagall-Gesetzes aus den 1930er-Jahren durch Präsident Clinton im Jahr 1999, das die Trennung zwischen Anlage- und Geschäftsbanken festlegte. Ergänzend wurden außerbörsliche Derivate von der Regulierung ausgenommen.
Gleichzeitig wurden neue Formen der Regulierung eingeführt, wie der Eigenkapitalkoeffizient und die verschiedenen Implementierungen der Maßnahmenpakete Basel I (1988), Basel II (2004) und nun Basel III, die unter der Aufsicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich gebilligt wurden. Trotz ihrer Unfähigkeit, die Risiken des Finanzsystems zu verringern (diese wurden durch die Finanzkrise 2007/2008 bewiesen), sind diese Maßnahmen ein Zeichen der fortgesetzten staatlichen Aufsicht und Kontrolle über das Finanzsystem.
Die Deregulierung wurde also von mehr Regulierung begleitet. Wie selbst Costa Lapavitsas, ein Vertreter des radikalen „neoliberalen“ Lagers, in seiner aktuellen und einflussreichen Untersuchung der Finanzwirtschaft hervorhebt: „Man sollte die Ausweitung der finanziellen Liberalisierung in den Jahrzehnten der Finanzialisierung nicht mit einem Mangel an Regulierungen verwechseln. Die Finanzwirtschaft wurde weiterhin stark reguliert, sowohl national als auch international. Diese Regulierungen waren allerdings von einer ganz anderen Art als die, die im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg eingeführt wurden“ [4].
„Das Problem ist, dass manche Institutionen Marktteilnehmern Anreize dafür bieten, sich auf leichtsinnige Art verantwortungslos zu verhalten“
Die staatliche Unterstützung des Finanzsektors und der Finanzialisierung war schon lange vor den verstärkten Aktivitäten nach der Wirtschaftskrise von 2007/08 etabliert. Seitdem haben Staaten so intensiv wie noch nie Vorschriften, die teilweise aus dem 19. Jahrhundert stammen, umgesetzt. Beispiele sind die staatliche Einlageversicherungsgarantie mit dem Staat als „Kreditgeber letzter Instanz“ und die Rettung von Finanzinstituten, die wirklich insolvent waren und nicht nur ein vorübergehendes Liquiditätsproblem erlebten.
Die vor kurzem veröffentlichten Memoiren von Timothy Geithner – Präsident der New-Yorker US-Notenbank und ehemaliger amerikanischer Finanzminister während der Krise 2007/08 – zeigen deutlich, mit welcher bedingungslosen Hingabe sich der Staat für den Wiederaufbau eines stabilen Finanzsektors eingesetzt hat. [5] Geithner bereut ausdrücklich, die Pleite der Lehman Brothers im Jahr 2008 hingenommen zu haben, statt sie zu retten. Im Nachhinein hätte er denjenigen entgegentreten müssen, die er als „alttestamentarische Populisten“ und „Fundamentalisten des Moral Hazard“ bezeichnet. Beim Moral Hazard geht es um das Problem, dass manche Institutionen Marktteilnehmern Anreize dafür bieten, sich auf leichtsinnige Art verantwortungslos zu verhalten. In Falle der Finanzkrise hat man argumentiert, dass Banken durch die staatlichen Rettungspakete von den Folgen ihres Handelns verschont wurden – und man sie dazu einlud, weiterhin risikoreich zu spekulieren. Der Staat würde es schon richten.
„Die Regulierungsmöglichkeiten sind letztendlich durch die Abhängigkeit der modernen Wirtschaft von der Finanzwelt begrenzt“
Nach dem Bankencrash wurde eine neue Reihe von staatlichen Reformen und Bankenregulierungen beschlossen, um den Finanzsektor zu stabilisieren und eine nächste Finanzkrise zu vermeiden. Die Notwendigkeit eines aktiveren Staates wurde, wenigstens im Falle der Finanzialisierung, offener anerkannt.
Das gestörte Verhältnis zwischen der Real- und Finanzwirtschaft erklärt die unvermeidbare Unwirksamkeit solcher Regulierungen im Kampf gegen eine zukünftige Finanzkrise. Das liegt nicht nur daran, dass sich Regulierungsbehörden immer nur an der Vergangenheit orientieren – wie alte Generäle, die ihren letzten Krieg weiterkämpfen –, während die Finanzakteure geschickt genug sind, die neuesten Regulierungen zu umgehen. Es liegt vielmehr an der flexiblen Beschaffenheit der Finanzialisierung, die in der Lage ist, sich relativ unabhängig von Realwerten zu entwickeln. Das Finanzkapital wird immer einen weniger regulierten Wirtschaftsbereich finden. Das letzte Mal ist man stärker auf das sogenannte Schattenbankensystem und die außerbilanziellen Anlagen ausgewichen. Was kommt als nächstes? Wir wissen es nicht und deswegen geht das Ab- und Überwertungen weiter, wahrscheinlich in neuen Wirtschaftsbereichen. Die Politik des leichten Geldes der Zentralbanken verstärkt diese Tendenz.
Egal, wie flächendeckend die neuen Finanzregulierungen ausfallen: Sie können finanzielle Instabilität genauso wenig beseitigen, wie sie die nächste Finanzkrise verhindern werden. Die Regulierungsmöglichkeiten sind letztendlich durch die Abhängigkeit der modernen Wirtschaft von der Finanzwelt begrenzt. Das ist ein strukturelles Problem und daher nicht leicht zu bewältigen. Deshalb werden die jüngsten Regulierungen ihr Ziel wohl kaum erfüllen, Banken, die „zu groß zum Scheitern“ sind, wieder auf eine normale Größe zurechtzustutzen.
Die staatliche Unterstützung der Finanzialisierung geht mit der oben beschriebenen Tendenz gewählter Regierungen einher, viel von ihrer wirtschaftlichen Verantwortung abzugeben. Teilweise als Folge dieser Haltung des Staates sind „unpolitische“ Zentralbanken zum wichtigsten Mittel staatlicher Interventionen geworden. In den letzten 30 Jahren sind die Zentralbanken unabhängiger geworden und sie haben zugleich breitere Maßnahmen zur Unterstützung der Finanzialisierung ergriffen.
„Um die finanzialisierte Wirtschaft zu stützen, ist die Politik des leichten Geldes zur Norm geworden“
Seit den späten 1980er-Jahren hat vor allem die Finanzialisierung den Motor des leichten Geldes angetrieben. Niedrigere Realzinssätze dienen seitdem als Schmiermittel für die Finanzwirtschaft. Die Auflockerungspolitik dient auch als Maßnahme der Zentralbanken gegen die Krise, die eintritt, wenn die instabilen Eigenschaften der Finanzialisierung zu einer Explosion führen. Jedes Mal, wenn die Finanzmärkte einen Rückschlag erleben und Preise abstürzen, werden die Zinssätze gesenkt und Liquidität in den Markt gepumpt, um Banken zu sanieren und die „guten alten Zeiten“ wieder aufblühen zu lassen.
Amerikanische Finanzmakler und Analytiker haben den Begriff des „Greenspan Put“ geprägt, um diese Praxis der US-Notenbank zu bezeichnen. Die sogenannte „Greenspan-Verkaufsoption“ leitet sich vom Namen ihres ehemaligen Präsidenten, Alan Greenspan, ab. Greenspans Nachfolger bis 2006, Ben Bernanke, wurde in „Bernanke Put“ umgetauft und Janet Yellen in „Yellen Put“.
Die erste große Maßnahme dieses neuen Credos hat Greenspan kurz nach seinem Antritt bei der US-Notenbank vorgenommen: Er reduzierte nach dem Börsencrash von 1987 die Zinssätze. Mit weiteren Kürzungen der Zinssätze folgte man der Politik des leichten Geldes. Diese Vorgehensweise wurde von den anderen großen westlichen Zentralbanken übernommen. Dann folgte die US-amerikanische Sparkassenkrise Anfang der 1990er-Jahre, die mexikanische Peso-Krise 1994, die asiatische Finanzkrise 1997–98, die Überverschuldung Russlands im Sommer 1998 und nach dem Zusammenbruch des – paradox bezeichneten – „Long Term Capital Management“-Hedgefonds das Platzen der Internetblase im Jahr 2000, das Attentat am 11. September und schließlich die erheblichen quantitativen Lockerungen und anderen EZB-Maßnahmen, die seit Anfang der Krise für die westliche Wirtschaft typisch sind.
Um die finanzialisierte Wirtschaft zu stützen, ist die Politik des leichten Geldes zur Norm geworden. Der unvermeidbare Anstieg der Zinssätze aus dem aktuellen Rekordtief wird diese Entwicklung nicht beenden. Der aktuelle Vorschlag, die Zinssätze allmählich zu erhöhen – d.h. ein schrittweiser Anstieg um ein viertel Prozent oder ein halbes Prozent – steht in Einklang mit der „Niedriger für länger“-Strategie Yellens. Sie zielt darauf ab, den Zins lange Zeit niedrig zu halten. Alle wichtigen Banken sind der Meinung, der Nominalzinssatz werde wohl kaum wieder auf das Niveau ansteigen, das vorher als normal galt.
Seit den 1970er-Jahren hat der Staat den Einfluss der Finanzialisierung ausgeweitet – sei es durch Gesetze, öffentlich-private Hybridorganisationen oder durch Zentralbankmechanismen. Die finanzialisierte Beschaffenheit der heutigen Volkswirtschaften erklärt die größere Rolle der Zentralbanken in den westlichen Wirtschaften. Die Art und Weise, wie Bankenanalytiker und Finanzmakler Janet Yellen, Mark Carney, Haruko Kuroda und Mario Draghi an den Lippen hängen, bestätigt, dass der Markt nicht frei ist und nie frei war. Wie Lapavitsas folgert, wäre „die Finanzialisierung ohne die regelmäßigen staatlichen Interventionen in die Wirtschaft unmöglich gewesen. Diese Interventionen sind durch die staatliche Herrschaft über nationale Währungen, welche die Zentralbank steuert, effektiver geworden […]. Es besteht kein Zweifel, dass die Zentralbank unter den Bedingungen des finanzialisierten Kapitalismus eine grundlegende Rolle bei den staatlichen Interventionen spielt.“ [6] Die Rolle der Zentralbanken bei der Begünstigung einer entschiedenen Lockerung der Geldmarktpolitik seit den 1980er-Jahren – vor der Krise 2007/08 – ist ein Zeichen für einen aktiveren Staat und einen immer stärker finanzialisierten Kapitalismus im Westen.
Die Illusionen der staatlichen Finanzialisierung
Die staatliche Finanzialisierung hat in den vergangenen Jahrzehnten die Illusion erweckt, dass die wirtschaftliche Lage gar nicht so schlecht wäre. Selbst nachdem die Folgen der Finanzkrise offensichtlich wurden, ging man weiterhin davon aus, dass sich die Probleme mit der Zeit von selbst erledigen würden. Zwar werden wir wohl nicht zu einem fünfprozentigen Wachstum zurückkehren wie in den Zeiten, als sich der Kapitalismus ausgebreitet hat, aber es wird schon wieder bergauf gehen. Wir nähern uns tatsächlich langsam einem Zustand der Stagnation und des Vergessens an, aber sicher keinem auf einem bescheidenen Niveau stabilen, sicheren Nirvana.
Die Debatten konzentrieren sich auf die Rolle der Zentralbanken und auf die Geldpolitik. Das bedeutet: Die Gesellschaft ist weit von der Erkenntnis entfernt, dass ein gesunder Wohlstand nur durch die Wiederbelebung der Produktion und eine neue Verpflichtung zur wirtschaftlichen Entwicklung erreicht werden kann. Der relative Erfolg der Finanzialisierung hat die Produktion weit in den Hintergrund der Debatten gerückt. Ohne eine erneuerte intellektuelle Beachtung der Produktion werden wir keine solide Grundlage für unseren zukünftigen Wohlstand errichten können. Wir werden darum nur auf Kosten anderer oder von unserer eigenen Zukunft leben können, die begrenzt und unvorhersehbar ist.
Wegen der Bedeutung von Zentralbanken versucht der Staat nicht mehr, die Produktion unmittelbar wiederzubeleben. Er hat praktisch aufgehört, in Bereiche einzugreifen, in denen die staatliche Unterstützung eine wichtige Rolle spielt. Dazu zählen die Förderung der Forschung, der Innovation und Investitionen in die Infrastruktur. Das Pumpen von Liquidität in die Wirtschaft kann Finanzanlagen ankurbeln und ihre Preise erhöhen, aber sie kann nicht die Wirtschaft wiederbeleben und Kapitalinvestitionen in der Produktion ersetzen.
Die Rolle der Zentralbanken
Die industrielle Produktion gilt inzwischen beinahe als anachronistisch und von gestern. Warum noch Dinge herstellen? Die Wirtschaftsdebatte dreht sich stattdessen um zwei Auffassungen bezüglich der Rolle der Zentralbanken: Die Banken sind demnach entweder gut oder schlecht. Von der einen Seite werden die Zentralbanken als ökonomische Weltenretter angesehen, die entschieden handeln, um den Weltuntergang aufgrund der westlichen Finanzkrise zu verhindern. Seit Beginn der Krise vor sieben Jahren haben die Zentralbanken ihr großes geldpolitisches Arsenal eingesetzt, um deflationäre Kräfte zurückzudrängen und die westlichen Wirtschaften auf den Weg zurück zur Erholung zu navigieren.
Die andere Seite ist der Meinung, dass die Zentralbanken von verantwortungslosen Inkompetenten geführt werden. Diese Unfähigen haben erst mit ihrer Politik des leichten Geldes die Saat der Finanzkrise gesät, dann sind ihnen die Warnhinweise nicht aufgefallen, als die Katastrophe drohte. Nun, so sagt man, stehen die Handlungen der Banken einer echten Erholung im Weg. Ihre losen und unkonventionellen geldpolitischen Aktionen wie die quantitative Lockerung sind sich aufblähende Blasen. Letztlich werden die Aktionen der Zentralbanken den nächsten Finanzcrash herbeiführen, weiterhin Kapital falsch zuteilen und die richtige Funktionsweise des Marktes verzerren.
Die beiden gegensätzlichen Auffassungen stützen sich auf eine Reihe von Indizienbeweisen. Ein gemeinsamer inhaltlicher Fehler entkräftet allerdings beide: Sie neigen gleichermaßen zur Überbewertung der wirtschaftlichen Rolle und des Einflusses der Zentralbanken und der Geldpolitik. Beide Auffassungen spiegeln das Dilemma der Aufgabe der Zentralbanken in unserer Gesellschaft wider: Die Banken spielen die Hauptrolle in der Finanzpolitik, haben aber letztlich nur einen geringen wirtschaftlichen Einfluss.
„Die Finanzwirtschaft kann einen sterbenden Produktionssektor nicht wiederbeleben“
Die Geldpolitik als „einzige Option“ ist nicht darum ein beschränktes Mittel, weil sie eine einzigartige Form des staatlichen Eingriffs darstellt. Vielmehr ist der Horizont dieser Option auf die Finanzwirtschaft beschränkt. Da Finanzaktivitäten keine Werte erzeugen können, sind sie nicht in der Lage, Produktionsschwächen auszugleichen. Eine staatliche Politik, die lediglich finanzielle Variablen und Indikatoren manipuliert, wird darum das Werterzeugungspotenzial nicht wiederbeleben können. Die Manipulationen in der Finanzwirtschaft sind ohnehin nicht die Ursache unserer Probleme in der übrigen Wirtschaft. Deren Ursachen gehen dem Aufstieg der staatlichen Finanzialisierung voraus.
Das Problem der staatlichen Finanzialisierung besteht nicht darin, dass sie allgemein unwirksam wäre, sondern dass sie nur in Bereichen wirksam ist, die einen geringen und nur beiläufigen Einfluss auf den zukünftigen Wohlstand haben. Einerseits verbreitet sie den falschen Eindruck von einem unveränderlichen Wohlstand. Die Politik des leichten Geldes kann Immobilienpreise aufrechterhalten, was Leute freut, die bereits ein Haus besitzen. Diese Politik kann aber nicht den Bau neuer Häuser finanzieren, die gesellschaftliche Wohnstandards erhöhen würden. Vielmehr könnte die Erhöhung des Leitzinses in Zukunft einen erneuten Absturz des Immobilienmarkts provozieren. Das hätte schwerwiegende Folgen für diejenigen, die ihre Hypotheken abzahlen müssen. Daran wären nicht die Zentralbanken schuld. Es wäre ein Versäumnis seitens der Gesellschaft, auf den Bau von mehr Häusern mit günstigen, innovativen Produktionstechniken zu verzichten. Insofern sind die Zentralbanken weder die Helden, noch die Bösewichter der Geschichte.
Man spricht von den Zentralbanken, als hätten sie einen großen Einfluss auf die moderne Wirtschaft. Sie haben angeblich die Inflation der 1980er- und 90er-Jahre überwunden und dadurch die Bedingungen für ein moderates Wachstum geschaffen. Man nennt es „Great Moderation“ („große Mäßigung“), ein Ausdruck, den Bernd Bernanke im Jahr 2004 – zwei Jahre vor seinem Amtstritt in der US-Notenbank – geprägt hat. Heutzutage werden Zentralbanken häufig für die Überwindung der allgemeinen Trägheit nach der Krise als notwendig empfunden. Man glaubt, dass ohne ihre expansiven Maßnahmen die schwerfällige Erholung noch schwerfälliger gewesen wäre. Der Anschein und die Hoffnungen werden von einer einfachen Tatsache untergraben: Wie aktiv sich der Staat auch in der Finanzwirtschaft einbringen mag – die Finanzwirtschaft kann einen sterbenden Produktionssektor nicht wiederbeleben.
„Dauerhaft kann die Finanzialisierung nicht funktionieren“
Der Erfolg der Great Moderation hängt auf lange Sicht von ihrer Anziehungskraft für Werte von außerhalb des Westens ab, vor allem aus China und aus anderen Teilen Asiens. Die staatliche Finanzialisierung begünstigte die Verschiebung von Werten aus dem Ausland und aus unserer Zukunft ins Hier und Heute. Dieser Vorgang ersetzte die Wiederbelebung der Werteproduktion Zuhause im Westen. Die Finanzialisierung hat es Politikern und Ökonomen ermöglicht, einer Diskussion über das Problem aus dem Weg zu gehen. Dauerhaft kann die Finanzialisierung aber nicht funktionieren.
Wie viel Autorität die Zentralbanken als Aufseher über die Geldpolitik auch beanspruchen mögen, sie haben im Grunde wenig Einfluss auf die Wiederbelebung der Wirtschaft. Ihre Macht ist auf die Finanzwelt begrenzt.
Das ist das Paradoxon von Geldpolitik und Zentralbanken: Vor allem im Vergleich zur politischen Klasse sind die Zentralbanken hochangesehene Institutionen. Im Gegensatz zu Regierungen können sie allerdings nicht einmal Steuern erheben und ausgeben – etwa für Investitionen in produktive Tätigkeiten wie Wissenschaft und Forschung. Alles, was die Zentralbanken tun können, ist Kosten und Verfügbarkeit von Geld anzupassen.
Die Kluft zwischen Real- und Finanzwirtschaft, die der Geldpolitik ihren Wirkungsraum eröffnet, die ihr erlaubt, ein Werkzeug des Staates zu sein, führt auch dazu, dass sie einen ziemlich unbestimmten Einfluss auf die Produktion ausübt. Viele andere Faktoren können die Beziehungen zwischen diesen beiden Bereichen der Wirtschaft fördern oder behindern. Der Einfluss, den eine Veränderung der Zinssätze auf die Produktion ausübt, kann in ihrer Wirkung von anderen Faktoren verfälscht werden: Wie beeinflusst eine Veränderung des Wechselkurses die Exportmärkte? Wütet gerade irgendwo auf der Welt eine Naturkatastrophe oder ein Krieg, die die Lieferkette unterbrechen und die Kosten erhöhen könnten? In diesem Bereich werden die Intentionen von staatlichen Eingriffen also mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen wie in anderen.
Man geht davon aus, dass Eingriffe der Politik in den Markt erst nach einer unbekannten Zeit, aber in der Regel nach sechs bis 24 Monaten ihre Wirkung entfalten. Die Existenz solcher Verzögerungen führt zu Unsicherheiten, wann man die geldpolitische Maßnahme einleiten soll und vor allem, ob man wieder rechtzeitig zur „Normalisierung“ der Politik zurückkehrt. Die Verzögerungen sind auch eine bequeme Ausrede, warum eine geldpolitische Maßnahme nicht funktioniert: „Die Verzögerungen scheinen im Moment etwas länger zu dauern.“
„Zentralbanken können keinen neuen Wohlstand erschaffen“
Solche Ausreden können die intrinsischen Grenzen der Geldpolitik nicht überwinden. Zentralbanken können keinen neuen Wohlstand erschaffen und sie haben auch keinen großen Einfluss darauf, wie andere Wohlstand erschaffen. Die Zentralbanken stehen an der Spitze des Finanzsystems – aber das ist ein System, das alleine keinen neuen Wert erschaffen kann und darum eine untergeordnete Rolle in der Wirtschaft spielt. In der Wirtschaft ist das Streben nach Werten und Profit bestimmend. Diese abgeleitete und zweitrangige Stellung der Finanzwirtschaft begrenzt also ihre Kapazitäten, die Probleme im produktiven Sektor anzugehen und zu lösen. Auf dem Weg von den Zentral- zu den Geschäftsbanken kann sich das Geld zwar vermehren, aber das wird die Produktion von Gütern und Dienstleistungen nur beeinflussen, wenn Unternehmen einiges von diesem Geld für ihre Expansion oder Investitionen nutzen. Fehlen die Bedingungen und der Antrieb für ein profitables Wachstum, können die Banken den produktiven Einsatz des Geldes nicht erzwingen. Die Konzentration mancher auf die fehlende Bereitschaft der Banken, Geld zu verleihen, stellt das Problem auf den Kopf.
Vor langer Zeit brachte der prominenteste Kapitalismuskritiker des 19. Jahrhunderts dieses Paradoxon sehr gut auf den Punkt: „Das Banksystem ist, der formellen Organisation und Zentralisation nach, wie schon 1697 in Some Thoughts of the Interests of England [vom britischen Philosophen John Locke; Anm. d. Red.] ausgesprochen, das künstlichste und ausgebildetste Produkt, wozu es die kapitalistische Produktionsweise überhaupt bringt. Daher die ungeheure Macht eines Instituts wie die Bank v. E. auf Handel und Industrie, obgleich deren wirkliche Bewegung ganz außerhalb ihres Bereichs bleibt und sie sich passiv dazu verhält.“ [7] „Ungeheure Macht“, aber letztlich machtlos.
Das Umlegen geldpolitischer Hebel dringt nicht zur Wurzel des Problems vor: Unternehmen investieren nicht und das Produktionswachstum stagniert oder ist sogar rückläufig. Es ist nicht einmal der Fall, dass Investitionen von der Verfügbarkeit billiger Kredite abhängen. Historisch gesehen stammen in entwickelten Volkswirtschaften 80 bis 100 Prozent des Investitionskapitals aus erwirtschaftetem Gewinn und nicht aus externen Finanzquellen. Die natürliche Beziehung zwischen Investitionen und verfügbarem Geld sollte heute eigentlich noch enger ausfallen. Schließlich haben Unternehmen heute größere Geldreserven als jemals zuvor [8] – und müssen sich darum eigentlich gar kein Geld leihen. Sie investieren dennoch nicht in eine produktivere Zukunft. Offensichtlich hält etwas Größeres als Preis und Verfügbarkeit von Krediten Innovationen und Investitionen zurück.
Schlussfolgerungen
Die beispiellose und konsequente Auflockerung der Geldpolitik im vergangenen Vierteljahrhundert hat sehr effektiv den falschen Eindruck erweckt, wir hätten einen angemessenen, stabilen Wohlstand erreicht. Zugleich verstärkt sie unausweichlich die in der Finanzialisierung angelegten Tendenzen zu einer weiteren Finanzkrise. Die Politik des leichten Geldes hat außerdem nichts getan, um die Probleme der westlichen Wirtschaften zu lösen, die sie in das aktuelle Schlamassel gestürzt haben.
Das Paradoxon der Geldpolitik besteht darin, dass so viele Hoffnungen auf ihr ruhen, obwohl sie wenig Einfluss auf den Werte-schaffenden Teil der Wirtschaft hat. Die quantitative Lockerung und andere unkonventionelle Maßnahmen der Europäischen Zentralbank können nichts an dieser Tatsache ändern. Die Dänische Zentralbank hat das von EZB-Präsident Mario Draghi vorgeschlagene Experiment negativer Einlagezinsen als eine der wenigen Zentralbanken mitgemacht. Ein Vertreter der Dänischen Zentralbank hat die mangelnde Wirksamkeit des Experiments klar ausgesprochen: „Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft waren praktisch gleich null.“
„Die Gesellschaft braucht keine Kultur, die die Produktion aufgegeben hat“
Heute versucht man, einen Aufschwung der westlichen und vor allem der britischen Wirtschaft herbeizureden. Solche Versuche werden von unbeugsamen wirtschaftlichen Indikatoren Lügen gestraft, laut denen die historisch bislang entschiedenste Politik des leichten Geldes so gut wie gar nichts gebracht hat. Unternehmensinvestitionen bleiben im historischen Vergleich weiterhin schwach, das Produktivitätswachstum ist vernachlässigbar und ungleichmäßig, der Beschäftigungsanteil in der Produktion ist niedrig und viele westliche Nationen importieren noch immer einen rekordverdächtigen Anteil an Fertigerzeugnissen.
Die Hyperaktivität der Zentralbanken verbreitet eine falsche Ruhe vor dem Sturm. Die Auffassung, das leichte Geld würde eine anderweitig stabile Wirtschaft durcheinanderbringen, überschätzt ebenso den Einfluss der Finanzwirtschaft. Wir müssen unsere Beurteilung der Lage grundlegend verändern, bevor wir auch nur ansatzweise aus unserem ökonomischen Abgrund herausfinden können. Der erste Schritt in Richtung einer wirtschaftlichen Wiederbelebung ist die Anerkennung einer entscheidenden Tatsache: Eine Gesellschaft braucht keine Kultur, die die Produktion aufgegeben hat – eine Kultur, die von irgendeinem geldpolitischen Blödsinn besessen ist, statt neue Werte zu schaffen.
