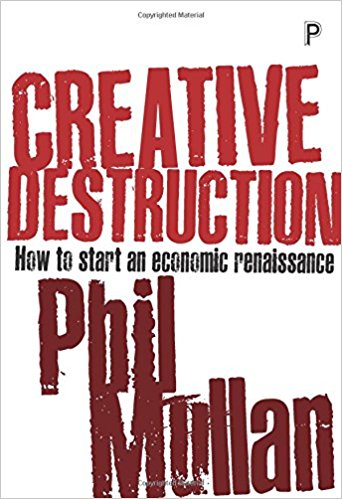22.09.2017
Rezepte gegen den Zombiekapitalismus
Rezension von Alexander Horn
Ein neues Buch des Ökonomen Phil Mullan analysiert die Ursachen der aktuellen Produktivitätsschwäche und fordert eine Politik der „kreativen Zerstörung“.
Seit den 1970er-Jahren ist das Wirtschaftswachstum in westlichen Gesellschaften rückläufig. Vorbei sind die Zeiten der 1950er- und 1960er-Jahre, als sich die Westdeutschen an bis zu zweistelligen jährlichen Wachstumsraten erfreuten. Verschwunden sind auch die Ambitionen, die der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard in seinem Buch „Wohlstand für Alle“ selbstbewusst formulierte, nämlich „immer weitere und breitere Schichten unseres Volkes zu Wohlstand“ zu führen. Bis in die 1970er-Jahre ist dieses Versprechen zweifellos erfüllt worden. Danach gab es bis in die 1990er-Jahre bei rückläufigem Wirtschaftswachstum nur noch moderate Reallohnsteigerungen. Seitdem stagnieren die Reallöhne weitgehend bei einem durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstum von kaum mehr als einem Prozent.
Diese Tatsachen werden kaum als Problem wahrgenommen, denn es gibt im Hinblick auf das Wachstum keine wirklichen Ambitionen mehr. Im Gleichklang mit dem rückläufigen Wachstum haben sich auch die Erwartungen der Menschen nach unten bewegt. Dafür haben die dominierenden intellektuellen Strömungen gesorgt, die niedriges Wachstum oder gar Stagnation als tugendhaft verklären. Die Gesellschaft müsse angesichts von Ressourcengrenzen und Klimawandel besser früher als später lernen, ohne Wachstum auszukommen. Daneben gibt es weitere Faktoren, die vermeintlich erklären, warum starkes Wirtschaftswachstum ausgeschlossen ist. Diese reichen von der demographischen Alterung bis zur Behauptung, dass das Potenzialwachstum in Deutschland nur noch 1 bis 1,5 Prozent hergibt.
„Es gibt im Hinblick auf das Wachstum keine wirklichen Ambitionen mehr.“
Da sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland aktuell auf zwei Prozent zubewegt, treten die ersten Ökonomen auf den Plan, die vor einer Überhitzung der Wirtschaft warnen. Gegenüber der Welt betonte der Leiter für Konjunkturprognosen des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths: „der sanfte Aufschwung ist das Beste, das unserem Land passieren kann.“ Damit implizierte er, dass ein stärkeres Wachstum zu unerwünschten Anpassungskrisen führen würde. Diese Sichtweise ist symptomatisch. Ein kontinuierliches, moderates Wachstum gilt als erstrebenswert. Allzu dynamisches Wachstum könnte außer Kontrolle geraten, vielleicht sogar Blasen bilden und eine zerstörerische Dynamik auslösen. Der Kontrollverlust während der Finanzkrise hat die verantwortlichen Eliten in ihrem Bestreben, Krisen um fast jeden Preis zu vermeiden, nochmals bestärkt. Erst kürzlich hat sich etwa Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel für „Transformation statt Disruption“ ausgesprochen. Bahnbrechende neue Technologien könnten ganze Unternehmen oder gar Wirtschaftszweige zerstören und damit letztlich auch die gesellschaftliche Stabilität bedrohen.
Subjektive Wachstumsbarrieren
Im völligen Gegensatz zu diesem Zeitgeist hält der britische Ökonom und langjährige IT-Manager Phil Mullan eine „kreative Zerstörung“ für unabdingbar. Nur so könnten die dem westlichen Kapitalismus anhaftenden Wohlstandsbremsen gelöst und die Basis für eine vierte industrielle Revolution geschaffen werden. Letztlich, so Mullan in seinem aktuellen Buch „Creative Destruction“, gehe es darum, die Bedingungen für massive Investitionen in die werterzeugendende Wirtschaft zu schaffen. Die Herausforderungen, die sich dabei stellen, sieht er hauptsächlich auf der intellektuellen, politischen Ebene, aber auch in der Wirtschaft selbst.
Die größte Barriere ist laut Mullan die intellektuelle Krise des Kapitalismus. Diese Krise ist für den Autor vor allem deshalb so tiefgreifend, weil die historische Entwicklung des Kapitalismus untrennbar mit der Aufklärung verbunden ist. Deren universalistische Konzepte der Vernunft, Freiheit und Humanismus lieferten die intellektuellen Ressourcen des liberalen Bürgertums. Sie legitimierten ein Wirtschaftssystem, das bis dahin ungeahnte Produktivitätssprünge möglich machte und in krassem Gegensatz zu den fast statischen Gesellschaftsformen der vorangegangenen Jahrhunderte stand. Als im Laufe des 20. Jahrhunderts die Werte der Aufklärung zunehmend in Frage gestellt wurden, hatte dies laut Mullan eine unmittelbare Auswirkung auf die gesellschaftliche Bewertung des Kapitalismus. Nicht nur die kapitalistischen Eliten verloren über den Ersten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs ihre Selbstüberzeugung und ihr Vertrauen in den Kapitalismus. Das gesamte politische Spektrum einschließlich der Linken verlor das Vertrauen in die Werte der Aufklärung und damit auch das Vertrauen in den vom Menschen gemachten Fortschritt.
„Die historische Entwicklung des Kapitalismus ist untrennbar mit der Aufklärung verbunden.“
Ein wesentlicher Aspekt dieses intellektuellen Rückzugs ist das kulturell verinnerlichte Unbehagen gegenüber Veränderung. In der Welt der Ökonomen und Manager hat sich die ursprüngliche Bewertung von Unsicherheit umgekehrt. Unsicherheit gilt heute als wirtschaftliches Hemmnis, das gerne als Begründung für wenig Wachstum oder geringe Investitionen herhalten muss. Früher wurde Unsicherheit hingegen eher neutral gesehen oder gar als Chance gewertet, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, sich durch geschickte Strategien gegenüber Wettbewerbern durchzusetzen. Mullan verweist auch darauf, dass die letzten drei industriellen Revolutionen vor dem Hintergrund enormer sozialer und politischer Spannungen und Umwälzungen voranschritten. Dampfmaschinen und industrielle Spinnmaschinen („Spinning Jenny“) waren Zeitgenossen des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs und der Französischen Revolution. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war von der Entwicklung der chemischen Industrie, der Elektrotechnik und des Verbrennungsmotors geprägt, aber auch vom amerikanischen Sezessionskrieg, dem Deutsch-Französischen Krieg und der Pariser Kommune. In die 1930er-Jahre fielen nicht nur die Weltwirtschaftskrise und der 2. Weltkrieg, sondern auch bedeutende Durchbrüche in der Chemie, Pharmazie, Nuklearenergie und Raketentechnologie. Nicht die Verhältnisse sind objektiv unsicherer geworden, sondern unsere Wahrnehmung hat sich geändert.
Das Unbehagen gegenüber Veränderung wurde in den letzten Jahrzehnten permanent durch neue Ideen und Bewegungen bestätigt, die sich sehr direkt auf die Unternehmen auswirken. Mullan analysiert in diesem Kontext die Fixierung der Unternehmen auf Risiko, die gestiegene Furcht vor neuen Technologien sowie den Einfluss des Nachhaltigkeitsdenkens als Unternehmensprinzip. Der Autor zeigt, wie der traditionell von den Unternehmen geriebene Fortschritt durch diese Faktoren zunehmend eingeschränkt wird. Die negative Einstellung zur Veränderung ist laut Mullan inzwischen kulturell tief verankert. Sie ist für ihn ein „subjektives Merkmal der heutigen Zeit, eine objektive Barriere für Erneuerung und Fortschritt“.
Der „konservierende Staat“
Die diskutierten intellektuellen Barrieren wirken sich seit den 1970er-Jahren auch auf politisches und staatliches Handeln aus. Wirtschaftliche Stabilisierung wurde bereits mit der ersten schweren Nachkriegsrezession Anfang der 70er-Jahre zum dominierenden politischen Ansatz, der sich bis heute mehr und mehr verstärkt hat. Trotz dieser Grundtendenz wirkte die Geldpolitik bis Anfang der 1980er-Jahre noch verstärkend in den Konjunkturzyklus ein, um die weniger profitablen Unternehmen aus dem Markt zu drängen und die Aufschwungsphasen zu verstärken.
„Nicht die Verhältnisse sind objektiv unsicherer geworden, sondern unsere Wahrnehmung hat sich geändert.“
Dies hat sich mit dem Finanzmarkt-Crash 1987 verändert. Seitdem reagieren die westlichen Zentralbanken bei den ersten Krisenanzeichen mit einer sofortigen Lockerung der Geldpolitik. Rezessionen haben jedoch einen wichtigen Sanierungseffekt, da die Bereinigung zumindest zeitweise eine neue Dynamik durch verstärkte Investitionen, Produktivitätssteigerungen und neue Jobs ermöglicht. Dieser Sanierungseffekt wurde durch die immer expansivere Geldpolitik zunehmend ausgehebelt. Mullan erklärt, dass der internationale Kapitalfluss sowie die Finanzialisierung der Ökonomie zu wichtigen Faktoren geworden sind, die den Trend zu wirtschaftlicher Stagnation verschleiern und einen fälschlichen Eindruck von Wohlstand vermitteln.
Im Hinblick auf den internationalen Kapitalfluss analysiert Mullan ausführlich, wie der wirtschaftliche Aufstieg insbesondere Chinas dem westlichen Kapitalismus über den Berg geholfen hat. Er geht aber auch auf viele andere meist staatlich initiierte oder geförderte Entwicklungen ein. Eine entscheidende Rolle spielt laut Mullan die Beendigung des Bretton-Woods-Abkommens 1970, das die Verbindung zwischen Dollar und Gold sowie die Bindung anderer Währungen an den Dollar aufgelöst hat. Seitdem benutzen wir ungedecktes Fiat-Geld. Die Folge war eine kontinuierliche Entfesselung des Finanzsystems. Mullan analysiert ausführlich den staatlichen Beitrag zur Finanzialisierung. Dabei wird klar, wie abhängig der westliche Kapitalismus von der kontinuierlichen Ausweitung der Verschuldung und der Expansion von fiktivem Kapital geworden ist. Die Kombination aus marktwirtschaftlichen Automatismen und staatlichen Eingriffen hat mächtige Instrumente geschaffen, mit denen die sich verfestigende Stagnation der werterzeugenden Wirtschaft zwar nicht aufgehoben, aber kompensiert werden kann.
Die Fähigkeit des westlichen Kapitalismus, neuen Wohlstand zu schaffen, hält Mullan für so sehr beeinträchtigt, dass er die Phase seit den 70er-Jahren in Analogie zur „Großen Depression“ der 30er-Jahre als „Lange Depression“ beschreibt. Den entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Depressionen sieht Mullan in der erfolgreichen Eindämmung der letzten Jahrzehnte. „Der Aufstieg der Finanzialisierung verdeutlicht ein Hauptmerkmal der Langen Depression, das sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet hat. In den westlichen Staaten wurden Marktmechanismen, die dem Niedergang der Produktion entgegenwirken, durch mächtige Durchwurstel-Strategien ergänzt. Seit den 1970er Jahren haben staatliche Institutionen – oft unbeabsichtigt – Wege gefunden, sich an den Niedergang anzupassen oder ihm zeitweise entgegenzuwirken.“
„Der Staat ist heute darauf ausgerichtet, Unternehmen oder ganze Wirtschaftsbereiche wieder aufzupäppeln, was eine Abhängigkeitskultur schafft.“
Die einseitig auf Eindämmung des Niedergangs ausgerichtete politische Orientierung hat laut Mullan einen konservierenden Staat („conservator state“) entstehen lassen. Ein wesentlicher Faktor in dieser Entwicklung sind für ihn die intellektuellen und kulturellen Trends, die politisches und staatliches Handeln prägen. Denn „wenn es grundsätzlich so scheint, als ob Veränderung die Dinge schlechter statt besser macht, wird das Ziel attraktiv, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Diese Ängste reflektierend, hat sich der Staat zu einem konservierenden Staat entwickelt. Einem Staat, der die Dinge so erhalten will, wie sie sind und der weniger Energie in die Finanzierung und Forcierung von langfristigem Wachstum steckt.“ Der Staat sei heute darauf ausgerichtet, Unternehmen oder ganze Wirtschaftsbereiche wieder aufzupäppeln, was eine Abhängigkeitskultur schafft. Während es so gelingt, den Niedergang der produktiven Basis zu kompensieren, hat dieser konservierende Ansatz laut Mullan die schleichende Entstehung einer Zombie-Ökonomie begünstigt.
Plädoyer für politische Erneuerung
Mullans Analyse des konservierenden Staates bringt die politischen Barrieren, die uns daran hindern, die Lange Depression zu überwinden, hervorragend auf den Punkt. Auf der einen Seite legt er die problematischen intellektuellen Überzeugungen und kulturellen Prägungen der Eliten offen. Sie schrecken vor einer von Marktmechanismen und der Kreativität der Menschen getriebenen, risikobehafteten Entwicklung zurück. Andererseits zeigt Mullan, wie sehr sich die Politik aus wirtschaftlichen Fragestellungen heraushält. Die wirtschaftliche Verantwortung ist in den letzten Jahrzehnten sukzessiv an staatliche und in der EU sogar an supranationale Institutionen abgegeben worden, die sich weitgehend oder vollkommen dem politischen Einfluss entziehen. Es ist zu einer fast vollständigen Entpolitisierung wirtschaftlicher Fragestellungen gekommen; der politische Diskurs ist von der Erörterung wirtschaftspolitische Alternativen völlig befreit. Wirtschaftliche Fragen sind zu einer staatlichen Verwaltungsaufgabe degeneriert. Die für eine demokratische Gesellschaft relevante Frage, wie sie ihre produktive Basis entfalten kann, spielt in der Politik kaum noch eine Rolle.
Im Vergleich zu den intellektuellen und politischen Barrieren zur Überwindung der Langen Depression hält Mullan die wirtschaftlichen Hürden für weniger kritisch. Die westlichen Volkswirtschaften leiden an einem seit den 1970er-Jahren rückläufigen Produktivitätswachstum. Im historischen Mittel hat der Kapitalismus die Arbeitsproduktivität so gesteigert, dass sich der Wohlstand alle 30 Jahre verdoppeln konnte. Inzwischen ist die Produktivitätssteigerung jedoch so sehr zurückgegangen, dass die Wohlstandsverdopplung 70 Jahre dauert. Die Ursache hierfür sieht Mullan in den notorisch schwachen Investitionen in die produktive Basis, denn nur dadurch kommen technologische Innovationen auch tatsächlich in die Umsetzung. Obwohl Forschung und Entwicklung eine wichtige Grundlage für den technologischen Fortschritt bilden, müssen die gewonnenen Erkenntnisse erst noch eine industrielle Anwendung finden. Erst Investitionen in neue Ausrüstungen und Maschinen, die Produkte oder Prozesse so verändern, dass mit weniger Arbeit ein besseres Produkt entsteht, bewirken deutliche Produktivitätssteigerungen. Die Bedeutung dieser Investitionen wird, wie Mullan ausführlich analysiert, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung systematisch unterschätzt.
„Es ist zu einer fast vollständigen Entpolitisierung wirtschaftlicher Fragestellungen gekommen.“
Warum aber wird zu wenig investiert? Die bereits angesprochenen subjektiven Barrieren spielen die Hauptrolle. Hinzu kommt aber eine dem Kapitalismus anhaftende Eigenart. Im historischen Verlauf verliert er die Innovationsdynamik und die daraus resultierende wohlstandssteigernde Kraft, die sich während der vergangenen industriellen Revolutionen immer wieder zeigte. Mit Rückgriff auf Marx’ Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate erklärt Mullan die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus. In der Krise kommt es zu einer Vernichtung von Kapital. Diese Zerstörung ermöglicht einen neuen Aufschwung, in dem der Kapitalismus sein kreatives Potenzial entfalten kann. Aufgrund der inneren Gesetzmäßigkeiten des Systems ist dieser Aufschwung in der Regel schwächer als die vorangegangenen Erholungsphasen. Die beschriebene Vereitelung und Eindämmung derartiger Krisen seit dem Ende des Nachkriegsbooms und die inhärent nachlassende Dynamik haben nun eine Situation geschaffen, die eine enorme Restrukturierung erfordert, um der Wirtschaft zu neuer Dynamik zu verhelfen. Mullan hält es für ausgeschlossen, dass diese Restrukturierung, die eine enorme Vernichtung unproduktiver Unternehmen bedeuten würde, von den privaten Unternehmen alleine durchgeführt oder initiiert werden kann. Die entscheidende Rolle kommt daher den Staaten zu, die diese Restrukturierung anführen müssen. Dies bedeutet, die Zerstörung unproduktiver Unternehmen oder ganzer Wirtschaftsbereiche anzuschieben, anderseits aber auch kreative Entfaltung zu ermöglichen. Auch hier muss der Staat laut Mullan eine entscheidende Rolle spielen. Als Beispiel nennt er die Grundlagenforschung, zu der Unternehmen, die profitorientiert handeln müssen, praktisch nicht in der Lage sind. Zu groß sind die Risiken, trotz enormer Aufwendungen kein industriell verwertbares Ergebnis zu erzielen.
Mullan glaubt, dass die heutigen Eliten diesen Aufgaben nicht gewachsen sind. Daher spricht er sich für eine „politische Restrukturierung“ als Voraussetzung einer staatlich angetriebenen Restrukturierung der Wirtschaft aus. Dies bedeute nichts Geringeres als eine „Erneuerung der demokratischen Politik“ aus einer aufklärerisch-humanistischen Perspektive. Menschen müssten gemeinsame Ideen entwickeln und erkennen, „dass wir unsere kollektiven Geschicke selbst bestimmen können.“ Das ist nichts anderes als der Appell für eine politische Bewegung, der es gelingt, die humanistischen Ideale der Aufklärung zur revitalisieren: „Die Beförderung einer intellektuellen Alternative beginnt damit, wirtschaftliche Angelegenheiten in die Sphäre der Politik zurückzubringen. Dies bedeutet, die heute vorherrschende Skepsis bezüglich der Machbarkeit und sogar der Erwünschtheit weiteren wirtschaftlichen Wachstums herauszufordern. Und es bedeutet, die hohen persönlichen und gesellschaftlichen Kosten der Zombie-Wirtschaft aufzuzeigen.“