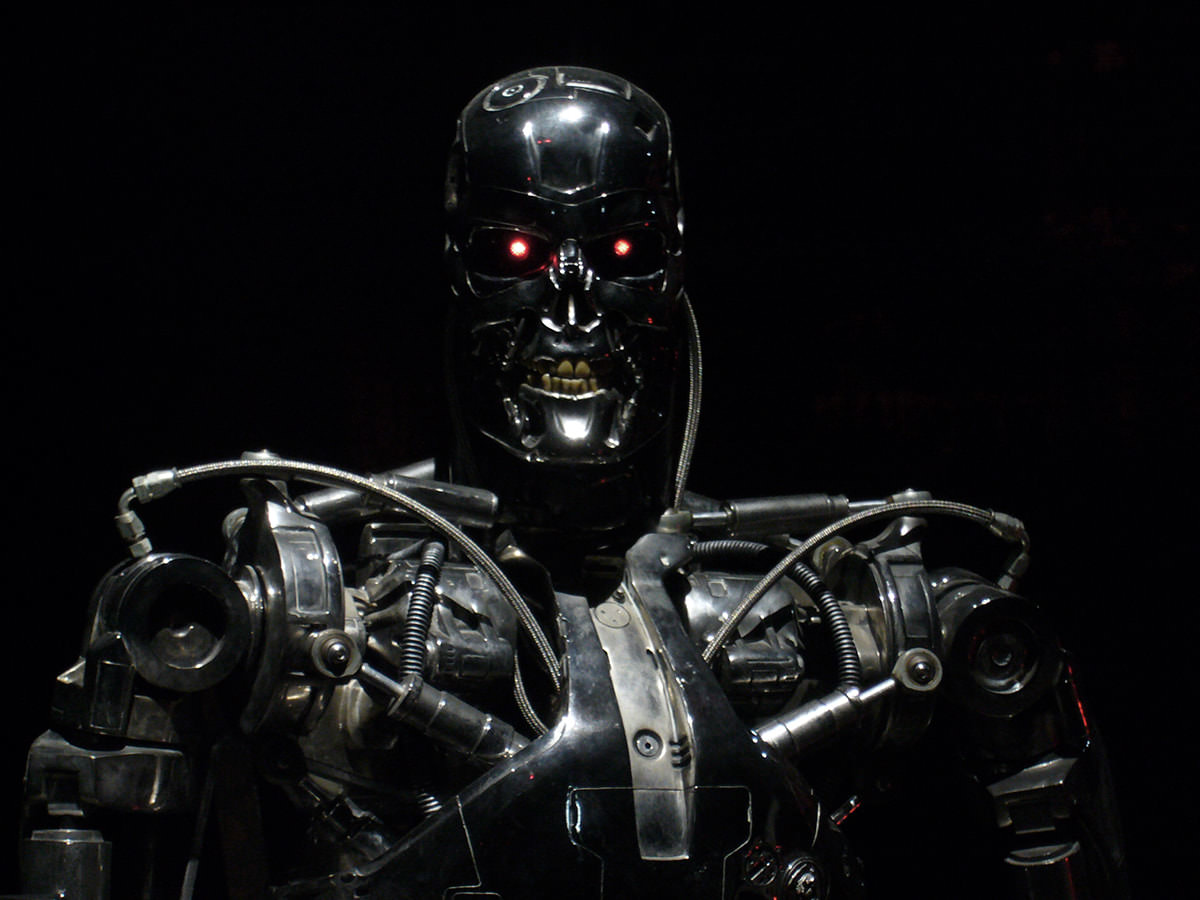20.08.2025
Wenn der Mensch verschwindet
Von Stephan Schmider
Auch in der Sozialarbeit stellt die Postmoderne den Humanismus in Frage. Statt blinder Dekonstruktion ist gesunde Skepsis gefragt.
Was bleibt vom Menschen, wenn alles am Menschen zur Disposition steht? Diese Frage begegnete mir bereits während meines Studiums der Erziehungswissenschaften oft, wenn wir Texte und Artikel von bekannten Philosophen wie Michel Foucault, Ludwig Fleck oder Judith Butler gelesen und diskutiert haben. Was als philosophisches Gedankenexperiment begann, ist heute zum gesellschaftlichen Mainstream geworden. Der Mensch sei keine feste Größe mehr, sondern ein soziales Konstrukt.
Viele reagieren heute fast befremdet, wenn noch von „dem Menschen“ gesprochen wird und nicht von Identitäten, Subjekten oder „sozialen Konstrukten“. Konstruktivistische Denkmuster, einst eher radikale Theorie, sind heute zur scheinbar unhinterfragten Praxis geworden. Und doch bleiben die Grundfragen: Was macht den Menschen aus? Und wie gestalten wir unser gemeinsames Miteinander?
Diese Fragen begleiten die Soziale Arbeit, eine Profession die von immer mehr Menschen studiert wird, seit es sie gibt. Mal leise im Hintergrund, mal als lauter Ruf inmitten aktuell gesellschaftlicher Turbulenzen. Und wahrscheinlich sind sie in Zeiten von zunehmender künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und dauerhafter Erreichbarkeit drängender denn je. Denn wer heute versucht, sozial zu arbeiten, bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen humanistischen Idealen und posthumanistischer Skepsis, zwischen Humboldtschem Bildungsideal und der Machtkritik Foucaults.
Der Humanismus hat die Soziale Arbeit von Anfang an geprägt und sie beeinflusst. Seine Vorstellung vom Menschen als vernunftbegabtem, zur Freiheit und Würde fähigem Wesen ist nicht nur ein ethisches Ideal, sondern auch beruflicher Anspruch von vielen Sozialpädagogen in der Praxis. Man unterstützt, berät, begleitet – stets mit dem Blick auf den Menschen und dessen Bedürfnisse und Potenziale.
Im Zentrum dieses Denkens standen lange der Mensch und seine Beziehung zur Welt. Bildung wurde demnach als eine Konfrontation vom Ich mit der Welt verstanden – ein Prozess, der lebenslang andauert und zweckfrei sein soll. Die Soziale Arbeit versteht sich als Profession, die bei Problemen in diesem Bildungsprozess unterstützt, hilft und den Menschen auf diesem Weg begleitet.
„Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir immer weiter in einen Transhumanismus hineingleiten.“
Doch diese Vorstellungen stehen bereits seit längerem unter Druck. Posthumanistische Perspektiven, wie sie vor allem in den so genannten Postcolonial Studies formuliert werden, stellen genau diese Prämissen kritisch infrage: Was, wenn das Subjekt nicht autonom ist, sondern Produkt von Diskursen und Machtverhältnissen, wie es bereits in den 1970er Jahren Foucault kritisch analysierte? Was, wenn Werte wie Freiheit, Würde oder Selbstverantwortung selbst Teil eines Diskurses sind, der nur bestimmten Gruppen dient? Was, wenn die Soziale Arbeit selbst zur Agentin gesellschaftlicher Disziplinierung wird?
Dies sind alles Fragen postmoderner Kritiker, die nicht nur in der Sozialen Arbeit, sondern überall in der Gesellschaft zu finden sind. Während der Humanismus den Menschen als rationales, autonomes Subjekt in den Mittelpunkt stellt, hinterfragt der Posthumanismus diese Annahme und betont die Rolle von gesellschaftlichen Machtstrukturen. Diese Fragen sind nicht unberechtigt. Kritik an Normen, an Reproduktion von Macht, an unreflektierten Helferhaltungen, das alles kann wertvoll sein. Gerade in einem Beruf, der sich zwischen Nähe und Distanz bewegt, zwischen Begleitung und Kontrolle. Denn wer zu idealistisch startet, tut gut daran, sich selbst und seine Vorstellungen vom „Guten“ kritisch zu hinterfragen. Diese Selbstreflexion ist kein Verrat an der Profession, sondern Ausdruck beruflicher Reifung. Nur wer bereit ist, das eigene Helferethos zu prüfen, kann es auch glaubwürdig leben. Unhinterfragte Normvorstellungen, Helfersyndrome oder vorschnelle Zuordnungen könnten reflektiert und verbessert werden.
Doch was bleibt, wenn die Kritik so weit geht, dass sie den Menschen selbst auflöst? Wer bleibt übrig, wenn der Mensch als handelndes, empfindendes und denkendes Wesen vollständig dekonstruiert wird? Foucault deutete dies bereits 1966 in „Die Ordnung der Dinge“ an: Der Mensch, so schrieb er, könne verschwinden „wie ein Gesicht im Sand am Meeresufer“. Ein Satz, der damals noch wie ein Paradox klang, wirkt heute geradezu prophetisch.
Und tatsächlich: Wir leben in einer Zeit, in der der Mensch zunehmend in Frage gestellt wird und zwar nicht nur philosophisch, sondern ganz praktisch. Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir immer weiter in einen Transhumanismus hineingleiten. In einen Zustand, in dem Sinne, Urteilskraft und Körperlichkeit zunehmend durch Algorithmen, Schnittstellen und künstliche Intelligenzen ersetzt werden.
Ohne Navi durch eine fremde Stadt fahren, Kontakt zu Freunden ohne Smartphone zu halten oder ein Studium ohne Tablet und ChatGPT zu absolvieren – all das ist bereits heute fast unmöglich. Was früher als dystopische Zukunft galt, rückt offenbar immer näher: totale Kontrolle durch künstliche Systeme und die kybernetische Steuerung der Demokratie. Allerdings weniger als lauter Schock wie in Filmen wie „Terminator“, sondern vielmehr leise, eingebettet in Komfort und Bequemlichkeit.
„Problematisch wird es, wenn der Mensch nicht mehr als fühlendes, leibliches, denkendes Wesen verstanden wird, sondern nur noch als Konstrukt, als Code, als beliebig umprogrammierbares System.“
Posthumanismus ist längst keine akademische Strömung mehr. Er hat sich zur kulturellen Bewegung entwickelt, die eng mit den Agenden großer Tech-Unternehmen und globalen Akteuren verbunden zu sein scheint. Was einst als ambitionierter Denkansatz begann, wird heute oft technokratisch und entmenschlichend umgesetzt. Posthumanistische Theorie sägt an den Grundpfeilern unserer menschlichen Orientierung. Sie zweifelt, wo früher Gewissheiten waren. Sie fordert, dass wir unsere Begriffe bis zur Bedeutungslosigkeit dekonstruieren und erkennt dabei oft in allem nur noch Machtstrukturen und Opferrollen.
Technologie wird dabei zur Heilslehre: Der Mensch soll mit Hilfe von KI, Neuroimplantaten oder digitaler Interfaces „verbessert“ werden. Sprache wird zum Unterdrückungsinstrument und zum Medium der Cancel Culture. Selbst klassische Werte wie Mitgefühl und Vertrauen erscheinen plötzlich als Mechanismen subtiler Kontrolle und technischer Manipulation.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich habe Foucault, Butler und Co. mit großem Gewinn gelesen. Ihre Texte haben mir geholfen, einen produktiven Skeptizismus zu entwickeln, einen Blick zu wahren, der Widersprüche ernst nimmt und scheinbare Selbstverständlichkeiten hinterfragt. Gerade dadurch wurden neue, kreative Denkwege und Lösungsideen für mich möglich. Genau das ist es, was Wissenschaft, Soziale Arbeit und die Gesellschaft insgesamt dringender brauchen denn je.
Problematisch wird es, wenn der Mensch nicht mehr als fühlendes, leibliches, denkendes Wesen verstanden wird, sondern nur noch als Konstrukt, als Code, als beliebig umprogrammierbares System. Wenn die Einheit von Leib, Geist und Gefühl zerfällt und nur noch als sprachlich konstruierte Projektionsfläche wahrgenommen wird. Dann wird der notwendige Zweifel zu Zynismus. Dann wird aus der Aufforderung zur Reflexion des eigenen Handelns ein dogmatischer Wahrheitsersatz.
Die eigentliche Gefahr liegt nicht in der Theorie selbst, sondern im Glauben, dass es nur noch Konstruktion gebe und keine Wahrheit a priori mehr. In der Vorstellung, dass das nur als wahr gelten darf, was gesagt, beschrieben und dekonstruiert werden kann. Diese Einseitigkeit, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist das eigentliche Problem. Es beraubt uns einer stillen, aber vielleicht unserer wichtigsten Ressource: unserer inneren Orientierung, dem Vertrauen auf das eigene Selbst, die eigene Wahrnehmung, die Fähigkeit, auch ohne Anleitung durch den Alltag zu navigieren. Eben genau das, was wir brauchen um uns in einer fremden Stadt alleine zurechtzufinden oder tiefere Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. Es sind genau diese Fähigkeiten – Orientierung, Beziehungsfähigkeit, Selbstvertrauen – die Soziale Arbeit stärken und fördern will.
„Die Zukunft der Sozialen Arbeit liegt vermutlich weder im naiven Humanismus noch im destruktiv-pessimistischem Posthumanismus.“
Wie also umgehen mit dieser Spannung? Wie lässt sich der humanistische Anspruch mit posthumanistischer Kritik verbinden? Vielleicht ist die Zukunft der Sozialen Arbeit weder im naiven Glauben an das Gute im Menschen noch in der zynischen Totaldekonstruktion zu finden, sondern eher in einer reflektierten Haltung des Dazwischen. Es wird darauf ankommen, das Beste beider Welten zu integrieren. Den humanistischen Blick auf das Menschliche, die Würde und das Empfinden – und zugleich die posthumanistische Skepsis gegenüber Macht und Normen. Wir brauchen eine Praxis, die kritisch ist, ohne destruktiv und ideologisch zu werden. Eine Haltung, die Skepsis gegenüber Macht mit Vertrauen in das Entwicklungspotenzial des Menschen verbindet.
Dies wird notwendig sein, will man weiter als Sozialarbeiter mit Herz und Verstand tätig bleiben. Wir müssen erziehen, begleiten, betreuen und Mitgefühl zeigen, versuchen, die Orientierung zu unserem Inneren aufrecht zu halten. Denn so können auch Dogmen, Normen und Werte kritisch hinterfragt und wahre Verbesserungen initiiert werden.
Die Zukunft der Sozialen Arbeit liegt vermutlich weder im naiven Humanismus noch im destruktiv-pessimistischem Posthumanismus. Sondern in einer Haltung des bewussten Dazwischen. Einer Balance zwischen einer gesunden Skepsis für Herrschaft und Macht, die nicht alles nur per se dekonstruiert, aber alles kritisch hinterfragt. Einer Praxis, die nicht ideologisch blind agiert, sondern reflektiert begleitet und berät.
Denn Soziale Arbeit heißt nicht, andere zu retten. Sondern Räume zu schaffen, in denen Menschen sich selbst verstehen können – jenseits von Normen und Erwartungen. Und genau dort beginnt das Menschliche. Nicht in der Rechthaberei identitätspolitischer Lager, sondern in der Bereitschaft, Dualitäten auszuhalten und sich seiner eigenen Schatten bewusst zu werden.