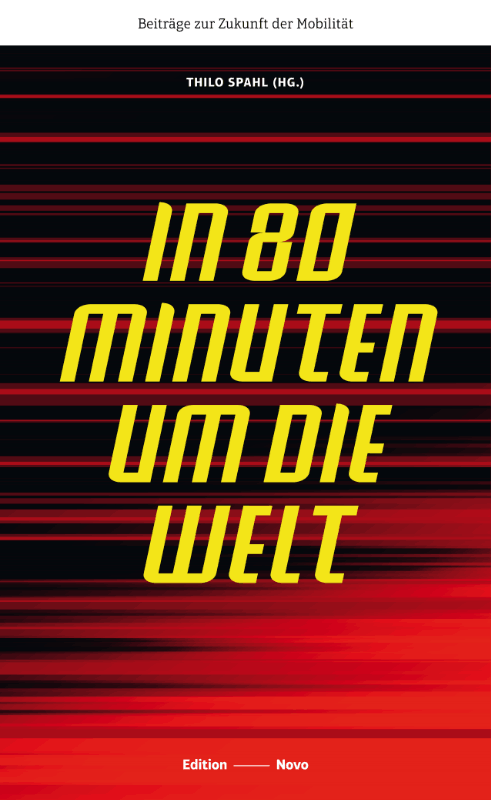27.06.2025
Unkritisch Reisen: Südkorea
Von Niels Hipp
Kürzlich überwand Südkorea eine Verfassungskrise, nach Krieg und Teilung konnte das Land einen beachtlichen Wirtschaftsaufschwung für sich verbuchen. Es bietet auch Touristen etwas.
Heute begeben wir uns nach Südkorea, offiziell Republik Korea, einen Staat in Ostasien, den ich im Mai 2025 bereist habe.
Südkorea ist für Deutsche allein schon deshalb interessant, weil es – wie Deutschland – aufgrund des Kalten Krieges geteilt wurde. Ein Teil war demokratisch-kapitalistisch (BRD, Südkorea), ein Teil diktatorisch-planwirtschaftlich (DDR, Nordkorea). Es gibt allerdings Unterschiede zu Deutschland: Erstens ist Korea noch immer geteilt, während dies bei Deutschland schon seit 35 Jahren nicht mehr der Fall ist. Die Fortexistenz des Kommunismus in Nordkorea (und auch im „unkritisch bereisten“ Kuba) auch jenseits der historischen Zeitwende 1989 bis 1991 zeigt wieder einmal, dass man mit der Annahme historischer Zwangsläufigkeiten oder Gesetzmäßigkeiten sehr vorsichtig sein muss. Auch für die Bevölkerung desaströse Regime wie dasjenige in Pjöngjang können über viele Jahrzehnte ohne Aussicht auf Besserung existieren, übrigens existierte auch die UdSSR –rechnet man ab der Russischen Revolution – 74 Jahre, Kuba bringt es auch schon auf 66 Jahre, ohne dass Veränderung in Sicht wäre.
Zweitens war die Teilung bei Deutschland gewissermaßen ‚verdient‘, bei Korea ‚unverdient‘: Deutschland war der Aggressor in Mitteleuropa, in Ostasien war es Japan, aber dort wurde nicht Japan geteilt, sondern Korea. Das wäre, als wenn man in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg – wie schon 1772, 1793, 1795 und 1939 – Polen geteilt hätte. Drittens fällt auf, dass Südkorea kleiner ist als Nordkorea: Während Nordkorea 120.450 Quadratkilometer an Fläche aufweist, kommt Südkorea nur auf 100.210 Quadratkilometer, wohingegen die BRD vor 1990 mehr als doppelt so groß war wie die DDR. Von der Bevölkerungszahl ist es dann wieder anders, dort hat Südkorea etwa doppelt so viele Einwohner (52 Millionen) wie Nordkorea (26 Mio.), also ein Verhältnis 2 zu 1, wohingegen das Verhältnis BRD zu DDR 1989 bei etwa 4 zu 1 lag. Der vierte Punkt betrifft die Wirtschaftskraft: Hier gab es zwar 1989 bezogen auf die DDR deutlich zu optimistische Annahmen (oder Selbsttäuschungen?) westlicher Ökonomen, allerdings ist es im Verhältnis Nordkorea zu Südkorea heute viel extremer als damals bei Deutschland. Exakte Zahlen zu Nordkorea fehlen zwar, aber realistisch betrachtet geht man davon aus, dass das Verhältnis der Wirtschaftskraft pro Kopf von Süd- zu Nordkorea bei mindestens 50 zu 1 liegt, während das Verhältnis West- zu Ostdeutschland 1989 ca. 2,5 zu 1 betrug.
Befand sich Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg noch auf dem Niveau armer afrikanischer Staaten, liegt es heute beim BIP pro Kopf weltweit auf Rang 32 (Deutschland Rang 18), nach Kaufkraftparitäten auf Rang 30 (Deutschland Rang 20). Südkorea zählt – wie Hongkong, Taiwan und Singapur – zu den asiatischen Tigerstaaten, deren rasante wirtschaftliche Entwicklung erst in den 1950er/1960er Jahren begann. Es gibt dort Weltkonzerne wie Samsung, auch Autohersteller wie Hyundai und Kia, deren Fahrzeuge auch in Europa beliebt sind. Man ist dort auch nicht so verblendet wie in Deutschland/ Europa, diesen Unternehmen mit CO2-Flottengrenzwerten und Verbrennerverbot massiv zu schaden.
„Der Internetempfang unterscheidet sich von dem in Deutschland: In kilometerlangen U- und S-Bahntunneln ist das Handynetz exzellent, es gibt dort keine Funklöcher.“
Technisch zeigt sich Südkorea aufgeschlossener als Deutschland, man sieht permanent, auch in Museen und Einkaufszentren, Roboter; in der Altenpflege soll es – ähnlich wie in Japan – Pflegeroboter geben. Dazu muss man wissen, dass Südkorea mit deutlich unter 1 Kind pro Frau die niedrigste Geburtenrate der Welt hat – zur Bestanderhaltung einer Bevölkerung sind 2,07 Kinder pro Frau nötig. Dieses enorme Defizit versucht man anders als in Europa nicht durch Migration, sondern durch Technologie auszugleichen. Auch der Internetempfang unterscheidet sich von dem in Deutschland: In kilometerlangen U- und S-Bahntunneln ist das Handynetz exzellent, es gibt dort keine Funklöcher. Wenn man arm ist, hilft es wenig, die Schuld bei anderen zu suchen, wobei die (Süd-)Koreaner Grund dazu gehabt hätten – ähnlich wie die Vietnamesen – anderen die Verantwortung zuzuweisen, das Land war immerhin von 1910 bis 1945 japanisch besetzt. Und dann kam auch noch der sehr verlustreiche Koreakrieg (1950 bis 1953) hinzu. Außerdem waren die Bedingungen im Norden besser, er war vor 1945 schon weiter entwickelt.
Durch die Einführung der sozialistischen Planwirtschaft unter Kim Il Sung in Nordkorea wurde dieser Vorteil schnell verspielt, Ende der 1960er Jahre überholte Südkorea den Norden. In diesem Kontext muss man dann schmunzeln, wenn man im Nationalmuseum erfährt, dass im Jahr 427 König Jangsu die Hauptstadt in die – so heißt es im Museum – reiche und fruchtbare Ebene von Pjöngjang verlegte. Unter Park Chung-Hee, der von 1962 bis 1979 Präsident Südkoreas war, kam es dann mit dem „Wunder am Han-Fluss“ zu einem exportgetriebenen Wirtschaftsboom, wobei anfänglich v.a. Billigwaren wie Textilien und günstige Autos ausgeführt wurden. Dabei spielten von Familien geleitete Mischkonzerne eine große Rolle. Es war sicherlich kein Modell freier Marktwirtschaft, sondern hatte viel mit staatlicher Lenkung zu tun, aber man nutzte auch die Kräfte des Unternehmertuns dazu, die bittere Armut zu überwinden.
Zum Aufschwung beigetragen hat in dem historisch von China und seinem Konfuzianismus beeinflussten Land eine sehr lern- und arbeitswillige Bevölkerung: In den Pisa-Tests erreicht das Land oft Spitzenergebnisse, etwa 2022 bei Mathematik und Naturwissenschaften den dritten Platz hinter Singapur und Japan. In Südkorea wird viel mehr gearbeitet als in Deutschland: 2021 wurden in 1915 Arbeitsstunden pro Jahr und Erwerbstätigen geleistet, in Deutschland nur 1349 Stunden – was bei uns auch an den vielen Urlaubs- und Feiertagen liegt. Südkorea liegt dabei sogar ein ganzes Stück über dem OECD-Durchschnitt (1716 Stunden).
„Wer in den Königspalästen die klassisch koreanische Kleidung trägt, erhält freien Eintritt. Das gilt auch für Ausländer. Sogenannte ‚kulturelle Aneignung‘ scheint dort richtigerweise nicht als Problem angesehen zu werden.“
Da mit steigendem Wohlstand die Empfindlichkeit in verschiedenen Bereichen tendenziell zunimmt, fällt auf, dass Südkoreaner in gewissen Punkten empfindlicher reagieren als Deutsche, in anderen weniger: So wird noch sehr viel Maske (meistens medizinische Maske) getragen, an den Flughäfen gibt es Quarantäne-Mitarbeiter und eine eigene Quarantäne-Station. Häufig wird am Straßenrand in den Großstädten auf großen Tafeln die Luftqualität exakt angezeigt (Feinstaub, Stickoxid usw.) – ein Thema, welches gerade deutschen Dieselfahrern in leidvoller Erinnerung sein dürfte, was bei uns aber eher Abmahnvereine wie die Deutsche Umwelthilfe interessiert. Auch findet man in allen Hotels Seile, um sich im Brandfall abseilen zu können. Außerdem scheint dort sogenannter „Overtourism" teilweise als Problem gesehen zu werden. So ist das touristisch beliebte, aber bewohnte Hanok-Dorf Bukchon (s.u.) in gewissen Bereichen täglich zwischen 17 und 10 Uhr für touristische Zwecke tabu. Bei Nichtbeachtung droht eine Geldbuße von umgerechnet gut 60 Euro.
Weniger empfindlich ist man bezüglich der eigenen Kultur. Wer in den Königspalästen (s.u.) die klassisch koreanische Kleidung (Hanbok) trägt, erhält freien Eintritt. Das gilt auch für Ausländer. Sogenannte „kulturelle Aneignung“ scheint dort richtigerweise nicht als Problem angesehen zu werden, auch nicht bei den Eliten. Die Verdrängung der traditionellen Religion (Buddhismus) durch das Christentum scheint ebenso wenig problematisiert zu werden, dominieren doch im Stadtbild – jenseits der Wolkenkratzer in den Großstädten – oft christliche Kirchen, nicht etwa buddhistische Tempel, die man meist an eher versteckten Stellen suchen muss.
Politisch waren die vergangenen Monate turbulent in Südkorea: Im Dezember 2024 warf der seit Mai 2022 amtierende Präsident Yoon Suk-Yeol in einer nächtlichen Rede der größten Oppositionspartei, der Demokratischen Partei, Sympathien für Nordkorea und staatsfeindliche Aktivitäten vor. Das erinnert an Deutschland, wo die mittlerweile zweitstärkste Kraft AfD mit Putin-Nähe und der Abschaffung der Demokratie in Verbindung gebracht wird. Es folgte die Ausrufung des Kriegsrechts durch den Präsidenten, also des Ausnahmezustands jenseits der normalerweise gültigen Verfassung. Ähnliches kennen wir in Deutschland seit der Corona-Zeit auch, wo die Grundrechte de facto „anders“ galten, wie es der Präsident des Bundeverfassungsgerichts, Stephan Harbarth (CDU), formulierte.
Dann kam es in Seoul zu größeren Protesten gegen die Ausrufung des Kriegsrechts, wohlgemerkt gegen den Staat, nicht Proteste für die Regierung wie bei unseren „Demos gegen rechts“. Daraufhin schickte der Präsident Soldaten, um das Parlament abriegeln zu lassen. Trotzdem gelangten die Abgeordneten ins Parlamentsgebäude und die Nationalversammlung verabschiedete wenige Stunden nach der Verhängung des Kriegsrechts einen Antrag auf dessen Aufhebung. In der Folge kam es im zweiten Anlauf zu einem Antrag auf Amtsenthebung des Präsidenten beim Verfassungsgericht Südkoreas; währenddessen war Yoon Suk-Yeol suspendiert. Am 04. April 2025 wurde er durch ein Urteil des Verfassungsgerichts seines Amtes enthoben.
„Die Einstufung Deutschlands als ‚vollständige Demokratie‘ gegenüber der Südkoreas als ‚unvollständige Demokratie‘ im Demokratie-Index des Economist sollte dringend überprüft werden.“
Das zeigt: Zwar hat der Präsident die Spielregeln der Verfassung missachten wollen, ist dabei aber an Parlament, Gesellschaft und Gericht gescheitert. Die demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen in Südkorea funktionieren also, im Gegensatz zu Deutschland, wo sie schon ziemlich ausgehöhlt sind, die Regeln etwa zu Lasten der AfD immer wieder geändert werden und massive Grundrechtsverstöße z.B. in der Corona-Zeit vom Bundesverfassungsgericht nicht gerügt werden. Die Einstufung Deutschlands als „vollständige Demokratie“ (Rang 13) gegenüber der Südkoreas als „unvollständige Demokratie“ (Rang 32) im Demokratie-Index des Economist sollte daher dringend überprüft werden.
Was kann man in Südkorea besuchen? Zunächst sei da die Hauptstadt Seoul genannt, in der man mehrere Tage verbringen kann. Neben dem Nationalmuseum und der Koreanischen Kriegsgedenkstätte sind v.a. die ehemaligen Königspaläste Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeongung, und Deoksung aus der Zeit der Joseon-Dynastie (1392-1910) sehr sehenswert, insbesondere die beiden erstgenannten. Darüber hinaus finden sich u.a. mit Namsangol und Bukchon klassisch koreanische Dörfer (Hanok) mitten in Seoul. Ebenfalls interessant sind buddhistische Tempel wie Jogyesa und Bongeunsa. Das moderne Korea findet sich oft südlich des Han-Flusses, etwa in Form des Lotte World Tower, v.a. aber im Bezirk Gangnam, wo sich die COEX-Mall mit der Starfield Library, aber auch ein Monument zur Erinnerung an den K-Pop-Hit „Gangnam Style“ von 2012 befindet.
Etwas außerhalb von Seoul liegen die Festung Namhansanseong und die Festungsstadt Suwon. Sehr sehenswert ist die im Südosten Südkoreas gelegene Stadt Gyeongju, die Hauptstadt des Silla-Königreichs (57 v. Chr. bis 935 n. Chr.), wohingegen die zweitgrößte Stadt des Landes, Busan, touristisch wenig bietet. Gyeongju gibt auch historisch am meisten her, etwa die Seokguram-Grotte, den Bulguksa-Tempel, die Teichanlage Wolji, das Cheomseongdae-Observatorium oder den Bunhwangsa-Tempel. Auf dem Land finden sich viele alte buddhistische Tempel, etwa Magoksa und Unjusa und – besonders empfehlenswert – Haeinsa und Tongdosa.