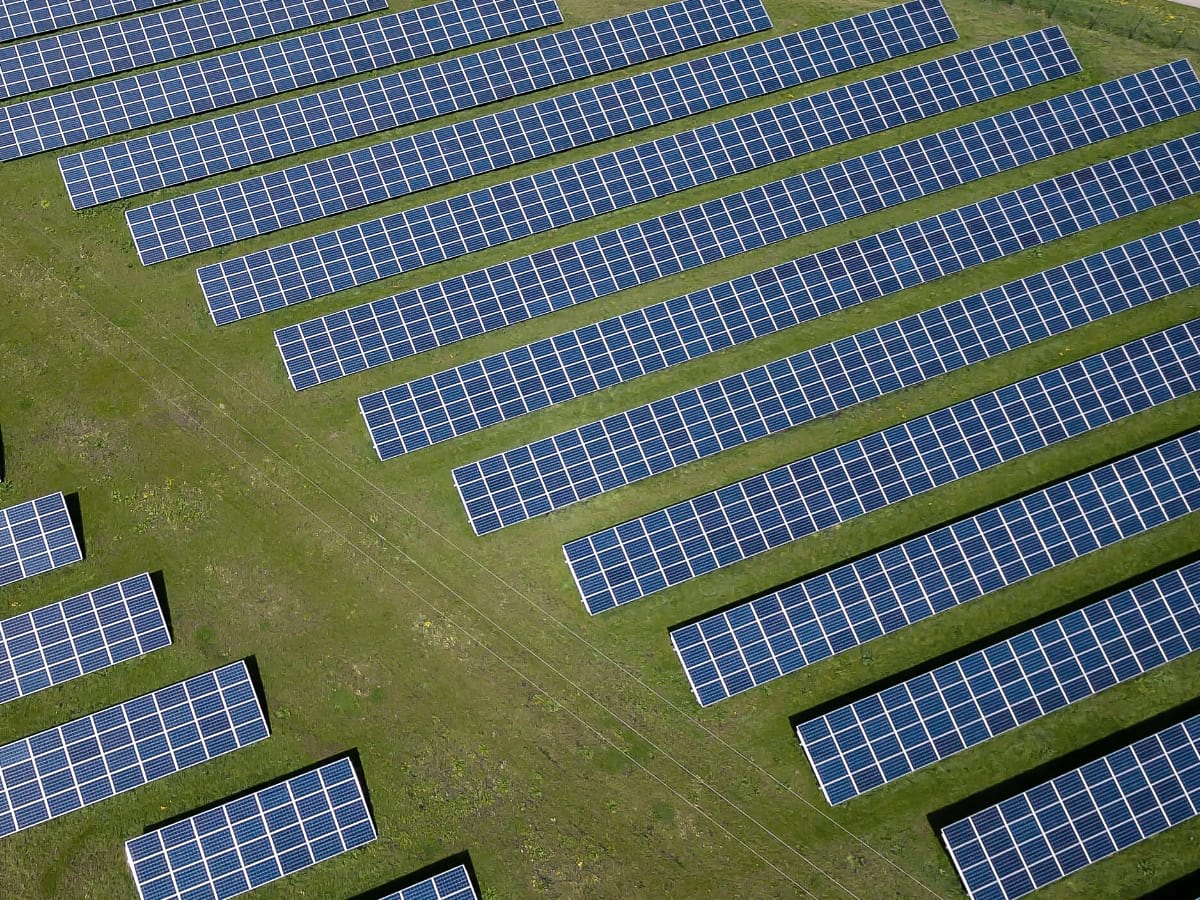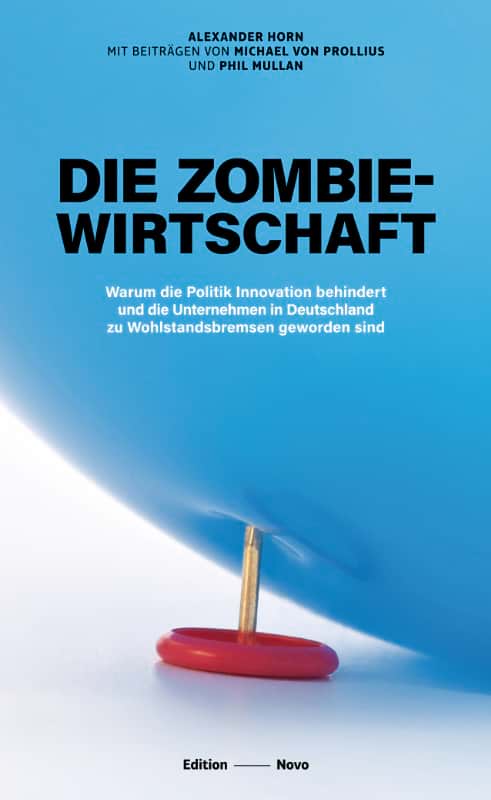13.06.2025
Subventionen lähmen die Produktivitätsentwicklung
Von Alexander Horn
Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist im Sinkflug. Die Bundesregierung hält mit Subventionen dagegen, was jedoch das zugrundeliegende Problem stagnierender Arbeitsproduktivität verschärft.
Die Wettbewerbsposition des deutschen Verarbeitenden Gewerbes hat sich nach Analysen des ifo-Instituts in den vergangenen beiden Jahren „so stark verschlechtert wie noch nie zuvor seit Beginn der Erhebung im Jahr 1994“. In den Jahren 2023 und 2024 berichteten jeden Monat mehr als zehn Prozent der Industrieunternehmen, dass sich die eigene Wettbewerbsposition im Vergleich zu Wettbewerbern aus anderen EU-Ländern in den vergangenen drei Monaten verschlechtert habe. Noch gravierender ist der Einbruch der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu weltweiten Wettbewerbern. In den Jahren 2023 und 2024 beklagten etwa 20 Prozent der deutschen Unternehmen eine Verschlechterung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, bis April 2025 stieg der Wert auf knapp 25 Prozent.
Besonders auffällig sei in den vergangenen beiden Jahren die negative Entwicklung in den energieintensiven Industriebranchen, was das ifo-Institut darauf zurückführt, dass die hohen Energiepreise „einen der Hauptgründe für die als schlecht bewertete Wettbewerbsposition“ darstellten. So berichteten im April dieses Jahres 43,3 Prozent der metallerzeugenden und -bearbeitenden Unternehmen eine Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition.[4] In der weniger energieintensiven Automobilbranche, die dennoch von der klimapolitischen Agenda in der EU stark betroffen ist, beklagten dies 33 Prozent der Unternehmen. Inzwischen melden auch Branchen, die weniger stark von steigenden Energiekosten betroffen sind, wie etwa Elektroindustrie und Maschinenbau „weitere Rückschläge“, so das ifo-Institut.
Schon vor der Bundestagswahl hatte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz deutlich gemacht, dass die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums die zentrale Aufgabe einer von ihm geführten Bundesregierung sein werde. Auf dem Bundesparteitag im Februar verkündete er, dass er im Fall eines Wahlsiegs vor jeder Entscheidung die Frage stellen werde, ob diese der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie diene. Es sei keine Zeit mehr für „Schönfärberei“, Deutschland stecke „in der tiefsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten“, so Merz an anderer Stelle.
Das Ansinnen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, durchzieht auch den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Inzwischen hat die neue Bundesregierung mit dem „Wachstumsbooster“ ihr erstes wegweisendes Steuergesetz vorgelegt. Der „Booster“ setzt mit verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten für Ausrüstungen und Elektrofahrzeuge, erweiterten Finanzhilfen für Forschung sowie der Senkung der Körperschaftssteuer vollständig auf Steuererleichterungen und Finanzhilfen, die den Unternehmen finanzielle Entlastungen bringen sollen. Dies, so Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mache den „Standort Deutschland […] international wettbewerbsfähiger“.
Klimapolitik zerstört Geschäftsgrundlage
Diese wirtschaftspolitische Herangehensweise der neuen Bundesregierung, die im Kern darauf abzielt, neben der im Koalitionsvertrag vereinbarten Verminderung bürokratischer Lasten vor allem mit finanziellen Entlastungsmaßnahmen und Subventionen die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, wird jedoch den vielschichtigen Ursachen der sich verschlechternden Wettbewerbsposition der hiesigen Unternehmen nicht gerecht.
Zwar sehen Unternehmen und Verbände die steigenden bürokratischen Lasten als eine der wichtigsten Beeinträchtigungen und tatsächlich sind in den vergangenen Jahren einschneidende Gesetze – wie etwa das deutsche Lieferkettengesetz, die EU-Lieferkettenrichtlinie, die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und das deutsche Energieeffizienzgesetz – auf den Weg gebracht worden, die das Fass bei vielen zum Überlaufen gebracht haben. Diese bürokratischen Lasten sind jedoch kein qualitativ neues, sondern ein seit Jahrzehnten vielbeklagtes Phänomen. Es dürfte zur sich verschlechterndem Wettbewerbsposition beitragen, aber den rapiden Rückgang in den vergangenen Jahren kann es nicht hinreichend erklären.
„Die Kehrseite staatlicher Protektion ist, dass die Unternehmen weniger Anreiz haben, kapitalintensive und risikoreiche Produkt- und Prozessinnovationen einzuführen."
Die Analyse des ifo-Instituts liefert den sehr eindeutigen Befund, dass die rapide Erosion der Wettbewerbsposition deutscher Industriebetriebe – deren Beginn das Institut auf das Jahr 2019 datiert und die erst nach der weitgehenden Überwindung der Belastungen durch Coronakrise und Ukrainekrieg zum Durchbruch gekommen ist – in erster Linie auf die hohen Energiekosten zurückzuführen ist. Denn offenbar ist vor allem die Industrie betroffen, deren Wertschöpfung im Durchschnitt sehr viel energieintensiver ist als die der Dienstleistungsunternehmen, und dort trifft es hauptsächlich die energieintensiveren Betriebe.
Die Ursache der steigenden Energiekosten liegt in der härteren klimapolitischen Gangart mit der Ausweitung sowie der Verschärfung des EU-Emissionshandels, mit stark steigenden CO2-Abgaben auf nationaler Ebene, der härteren Regulierung zur Vermeidung von CO2-Emissionen bis hin zur Erzwingung technologischer Umstellungen wie etwa in der Automobilindustrie und in der Stahlindustrie. Hinzu kommen die in Deutschland exorbitant hohen und seit einigen Jahren immer schneller steigenden Strompreise, die durch den stark steigenden Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energie- und Stromverbrauch versursacht werden.
Schon seit Mitte der 2000er Jahre reagieren die energieintensiven Branchen der Stahl-, Chemie-, Papier-, Pappe-, Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie nicht etwa mit verstärkten Investitionen, um die Produktivität und Effizienz ihre Wertschöpfungsprozesse so zu verbessern, dass sie die steigenden Energiekosten und den Investitionsaufwand kompensieren können. Stattdessen desinvestieren die Unternehmen, um aufgrund des dadurch verminderten Investitionsaufwands die Betriebskosten zu senken. Die unmittelbare Folge des dadurch sinkenden Kapitalstocks der energieintensiven Branchen ist die bereits seit Mitte der 2000er Jahre sogar sinkende Arbeitsproduktivität fast aller energieintensiven Branchen in Deutschland.
Solange die Unternehmen mit dieser Strategie die steigenden Energiekosten ausgleichen oder sogar überkompensieren, können sie zumindest vorübergehend ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Bei weiter steigenden Energiekosten oder wenn Konkurrenten die entgegengesetzte Strategie verfolgen, indem sie nämlich durch technologischen Fortschritt produktivere und effizientere Wertschöpfungsprozesse oder innovative Produkte einführen und infolgedessen sogar Preissenkungen erreichen, erodiert jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der desinvestierenden Unternehmen zunehmend.
Die Kombination aus den in Deutschland weiter steigenden Energiekosten und dem steigenden Druck, von fossilen Brennstoffen auf den viel teureren Strom oder Wasserstoff aus Erneuerbaren umsteigen sowie in vielen Fällen obendrein einen Technologiewechsel durchführen zu müssen, greift die Geschäftsgrundlage vieler vor allem energieintensiver Unternehmen an oder zerstört sie sogar. Viele energieintensive Unternehmen haben aufgrund des relativ hohen Anteils der Energiekosten an der eigenen Wertschöpfung schlichtweg keine Chance, die hohen und weiter steigenden Energiekosten durch eigene Anstrengungen, also Investitionen in produktivere und effizientere Wertschöpfungsprozesse oder innovative Produkte auszugleichen. In der Metallerzeugung- und -bearbeitung, bei chemischen Grundstoffen und in der Papierindustrie liegt der Anteil der Energiekosten an der eigenen Wertschöpfung der Unternehmen bei etwa 25 Prozent und selbst in der als nicht energieintensiv geltenden Nahrungsmittelindustrie erreichen viele Unternehmen 10 Prozent. Den Unternehmen verbleibt realistischerweise nur die Wahl zwischen einer Desinvestitionsstrategie, die ein möglichst verlustfreies Ausphasen der Produktion in Deutschland ermöglicht, oder der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit durch staatliche Protektion.
Wettbewerbsschwäche wegsubventionieren
Anstatt die zentrale Ursache für die Erosion der Geschäftsgrundlage energieintensiver Wertschöpfung in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben anzugehen, die in der einseitig auf erneuerbare Energien und Klimaneutralität ausgerichteten Klima- und Energiepolitik liegt, setzt die neue Bundesregierung den seit Jahrzehnten in Deutschland verfolgten klimapolitischen Kurs unverdrossen fort. Sie setzt auf die vom ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eingeleitete Industriepolitik, die einerseits den hochsubventionierten Sektor der erneuerbaren Energien stützt und massive Subventionen in den ansonsten unwirtschaftlichen Clean-Tech-Bereich pumpt – etwa zum Aufbau einer klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft oder zur Förderung der E-Mobilität. Andererseits sollen die ihrer Geschäftsgrundlage durch steigende Energiekosten beraubten energieintensiven Unternehmen hinreichend entlastet und geschützt werden, so dass sie auf diesem Weg ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Um zu überleben sind sie nicht mehr auf die Verbesserung ihrer Wertschöpfungsprozesse angewiesen.
„Viele energieintensive Unternehmen können aufgrund des relativ hohen Anteils der Energiekosten an der eigenen Wertschöpfung die hohen Energiekosten nicht durch eigene Anstrengungen, also Investitionen in produktivere und effizientere Wertschöpfungsprozesse oder innovative Produkte, ausgleichen."
Ganz im Einklang mit den Forderungen vieler Wirtschaftsverbände beabsichtigt die neue Bundesregierung nun jedoch, nicht nur die von steigenden Energiekosten überforderten Betriebe zu retten. Vielmehr soll auch die generelle Wettbewerbsschwäche der deutschen Wirtschaft mit Finanzhilfen und Steuervergünstigungen wegsubventioniert werden. Denn die meisten Unternehmen in Deutschland verlieren lange schon – und weitgehend unabhängig von steigenden Energiekosten – an Wettbewerbsfähigkeit, weil sie seit Jahrzehnten rückläufige Produktivitätsfortschritte erzielen, so dass die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität pro Erwerbstätigenstunde in Deutschland bereits seit drei Jahren sogar sinkt.
Dieser Maxime folgend wurde im Koalitionsvertrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit eine dauerhafte Senkung der Strompreise für Unternehmen „um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde“ versprochen. Um in Anbetracht der inzwischen angedachten Maßnahmen zu verhindern, dass energieintensive Unternehmen nicht im gleichen Umfang profitieren, sei ein vergünstigter Industriestrompreis „in Erarbeitung“, der bei 5 Cent/kWh liegen könne, wie die F.A.Z. kürzlich unter Verweis auf Regierungskreise berichtete.
Um die strauchelnden energieintensiven Betriebe wie auch die von harter Regulierung zur Verminderung der CO2-Emissionen betroffenen Branchen wie die Automobilindustrie zu retten, wurde im Koalitionsvertrag ein umfangreiches Paket zur Subventionierung der Elektromobilität und zur Fortsetzung der bestehenden „Förderprogramme zur Dekarbonisierung der Industrie“ vereinbart darunter auch die von Habeck eingeführten „Klimaschutzverträge“, die energieintensive Betriebe bei der Umstellung auf erneuerbare Energie zu jahrzehntelangen Subventionsempfängern machen. Auch die erneuerbare Energiewirtschaft und die Clean-Tech-Unternehmen dürften durch den im Koalitionsvertrag festgelegten beschleunigten Aufbau der Wasserstoffwirtschaft viel Wasser auf die Mühlen ihrer subventionsbasierten Geschäftsmodelle erhalten.
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zielt die Bundesregierung jedoch nicht nur darauf ab, die Folgen steigender Energiekosten durch Subventionen auszugleichen, hinzu kommen weitere Finanzhilfen und Steuervergünstigungen, die die Unternehmen anderweitig unterstützen sollen. Dies soll nun unter anderem das bereits oben erwähnte erste „Wachstumsbooster“-Steuerpaket mit Sonderabschreibungen für Ausrüstungsinvestitionen und E-Mobilität sowie zur Forschungsförderung und Unternehmenssteuersenkungen leisten. Allein die steuerlichen Investitionshilfen haben bis einschließlich 2029 ein Volumen von insgesamt 46 Milliarden Euro.
Durch die anvisierten Subventionen dürfte der Anteil der staatlichen Subventionen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), der 2019 bereits 5,6 Prozent erreicht hatte und 2023 und 2024 nach Berechnungen des IfW Kiel 7,7 beziehungsweise 6,6 Prozent angestiegen sein dürfte, nochmals deutlich steigen.
Subventionitis beschleunigt die Zombifizierung
Um zu verhindern, dass die Betriebe bei steigenden Energiekosten und obendrein stagnierender oder sogar sinkender Arbeitsproduktivität ihre Wettbewerbsfähigkeit einbüßen, spielen nicht nur Subventionen eine immer entscheidendere Rolle. Sie sind nur eine Spielart zunehmender staatlicher Protektion mit der – aus Angst vor den destabilisierenden Auswirkungen wirtschaftlicher Krisen und Restrukturierungen – darauf abgezielt wird, wirtschafts- und geldpolitische Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen es sogar den wettbewerbs- und produktivitätsschwächsten Unternehmen gelingt, dauerhaft zu überleben.
Anstatt den Wettbewerb um exzellente und hochproduktive Geschäftsprozesse anzutreiben und die Verdrängung weniger produktiver Betriebe zu ermöglichen, hat die ausschließlich auf wirtschaftliche Stabilisierung ausgerichtete Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte die Wirtschaft zunehmend zombifiziert. Der wirtschaftliche Erfolg und das Überleben der Unternehmen sowie Wohl und Wehe ganzer Branchen hängen immer stärker von förderlicher staatlicher Regulierung, Niedrigzinsen, Protektionismus und ausufernden Subventionen ab – und immer weniger von einer hohen Wettbewerbsfähigkeit durch hochproduktive Wertschöpfungsprozesse. Daher sind die Interessensvertreter der Unternehmen in Berlin, Brüssel oder in den Bundesländern längst hervorragend verdrahtet, so dass sich produktivitätsschwache Unternehmen und ganze Branchen aufgrund der staatlichen Stabilitätsorientierung darauf verlassen können, dass sie im Zweifel durch staatliche oder EU-Maßnahmen vor innovativen und hochproduktiven Wettbewerbern geschützt werden, die sie ansonsten verdrängen könnten.
Die Kehrseite staatlicher Protektion ist, dass die Unternehmen weniger Anreiz haben, kapitalintensive und risikoreiche Produkt- und Prozessinnovationen einzuführen. Sie müssen davon ausgehen, dass sie staatlicherseits daran gehindert werden, sich im Markt wettbewerblich durchzusetzen, so dass sich Investitionen in die Verbesserung von Produkten und Prozessen leicht als wirtschaftlicher Fehlschlag erweisen können. Die Hürden bei der Einführung produktivitätssteigernden Technologien werden für innovative Unternehmen umso größer, je weniger die wettbewerbliche Verdrängung schwacher Konkurrenten zugelassen wird. Denn innovative Unternehmen benötigen in aller Regel wachsende Märkte, da die typischerweise mit hohen Risiken und Investitionsaufwand verbundenen Produkt- oder Prozessinnovationen erst bei hohen Stückzahlen die erforderliche Rentabilität erreichen.
„Weder Wirtschaftswachstum noch Wettbewerbsfähigkeit lassen sich kaufen, obwohl dies die neue Bundesregierung – in Fortsetzung der seit Jahrzehnten verfolgten wirtschaftspolitischen Orientierung – offenbar glaubt."
Diese wirtschaftspolitisch verursachte Zombifizierung wird durch die energiekostentreibende Klimapolitik erheblich verschärft. Denn immer mehr Unternehmen sind nicht in der Lage, den Energiekostendruck mit Hilfe von Investitionen in produktivere und effizientere Wertschöpfungsprozesse auszugleichen. So werden vormals hochproduktive und international wettbewerbsfähige Betriebe energieintensiverer Branchen, durch die Zerstörung ihrer Geschäftsmodelle zu Zombieunternehmen. Ihre Wettbewerbsfähigkeit beruht nicht mehr auf technologischen Innovationen und hochproduktiver Wertschöpfung, sie investieren kaum und erreichen daher keine Produktivitätszuwächse. Ihre Profitabilität und nun auch die ganzer Branchen hängen ausschließlich von der Gewährung der für sie förderlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Subventionen ab.
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland zu stärken, müsste die Bundesregierung nichts Geringeres tun, als ihre wirtschafts- und klimapolitische Agenda grundlegend zu hinterfragen und sie anschließend vom Kopf auf die Füße stellen. Denn auf lange Sicht lässt sich Wettbewerbsfähigkeit nur durch Produktivitäts- und Effizienzgewinne erreichen, die die Unternehmen durch eigene Anstrengungen zur Verbesserung ihrer Wertschöpfungsprozesse bewerkstelligen. Dazu müssen wettbewerbliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Unternehmen Marktchancen eröffnen, dies sie durch exzellente Produkte und Prozesse nutzen können, anstatt eine Klima- und Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die die Geschäftsmodelle energieintensiver Unternehmen zerstört und sich in allen Bereichen am Erhalt der schwächsten Unternehmen ausrichtet.
Weder Wirtschaftswachstum noch Wettbewerbsfähigkeit lassen sich kaufen, obwohl dies die neue Bundesregierung – in Fortsetzung der seit Jahrzehnten verfolgten wirtschaftspolitischen Orientierung – offenbar glaubt. Letztlich macht diese Wirtschaftspolitik aufgrund der inzwischen manifesten Produktivitätskrise die Unternehmen zu Zombies, da sie nicht mehr die Rolle gesellschaftlicher Wohlstandsproduktion und -steigerung übernehmen, sondern umgekehrt diesen Wohlstand durch immer mehr Subventionen sogar selbst verfrühstücken.