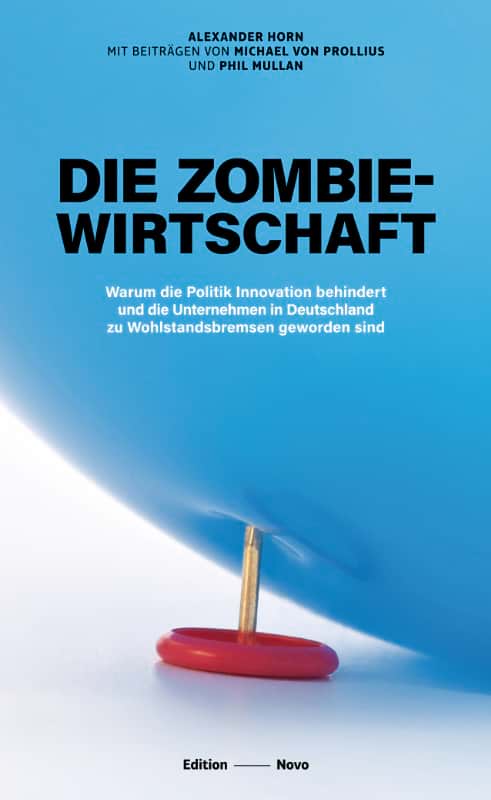23.05.2025
Mit Nebelkerzen gegen die Wohlstandserosion
Von Alexander Horn
Die Ursache der Rentenprobleme ist die Produktivitätsstagnation. Bundessozialministerin Bärbel Bas ignoriert das und will die Rentenversicherung zu Lasten von Beamten und Selbständigen sanieren.
In den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD wurde keine Lösung für die langfristige Sicherung des Rentensystems gefunden. Daher hat man sich auf die Einberufung einer Kommission verständigt, die dazu Vorschläge machen soll. Im Koalitionsvertrag steht zwar, dass am 2005 eingeführten Nachhaltigkeitsfaktor, der die steigenden Lasten der demographischen Alterung zwischen Beitragszahlern und Rentnern verteilt, „grundsätzlich“ festgehalten werde. Im direkten Widerspruch dazu jedoch auch, dass das Rentenniveau, das das Verhältnis zwischen der Höhe der Renten und der Erwerbseinkommen widerspiegelt, bis 2031 auf 48 Prozent abgesichert wird. Die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors wird demnach bis 2031 vollkommen ausgehebelt, denn aufgrund der demographischen Alterung würde sich das Rentenniveau in den nächsten Jahren erheblich absenken.
Die Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors führt zu Mehrausgaben der Rentenversicherung, die bis 2031 auf einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr anschwellen dürften. Sie sollen gemäß dem Koalitionsvertrag nicht auf die Beitragszahler abgewälzt, sondern mit Steuermitteln ausgeglichen werden. Da sich CDU/CSU und SPD offensichtlich auf nichts einigen konnten, musste Bundeskanzler Friedrich Merz zwischenzeitlich einräumen, dass man in der Rentenfrage „ziemlich unklar und vage geblieben“ sei.
Rentengerechtigkeit hilft nicht
Diese Leerstelle hat die neue SPD-Bundesarbeits- und -sozialministerin Bärbel Bas postwendend genutzt, um die Richtung vorzugeben, wie nach ihrer Auffassung eine sozial gerechte Reform des Rentensystems auszusehen hat. Gegengenüber der Presse erklärte sie, dass zukünftig auch „Beamte, Abgeordnete und Selbständige“ in die Rentenkasse einzahlen sollten. Dies würde die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung steigern, Verteilungsspielräume schaffen und die finanzielle Tragfähigkeit der gesetzlichen Rente verbessern. Mit ihrem Vorschlag gehe es „auch um die gesellschaftliche Tragfähigkeit – um Akzeptanz, um ein gerechtes System“, so Bas im Bundestag.
Die Einbeziehung der Beamten in das gesetzliche Rentensystem ist ein Vorschlag aus der Mottenkiste. Denn schon 2018 hatte die damals von CDU/CSU und SPD geführte Bundesregierung diese Idee verworfen, nachdem die damals einberufene Rentenkommission zu dem Ergebnis kam, dass kurzfristig kaum Entlastungen zu erwarten seien und im Gegenteil die Rentenkasse - unter anderem wegen der höheren Lebenserwartung der Beamten – auf lange Sicht sogar zusätzlich belastet werde. Zum gleichen Ergebnis kam der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten 2023.
„Das Renten- und Sozialversicherungssystem steht jedoch weder wegen vermeintlicher Gerechtigkeitsdefizite – wie Bas behauptet – noch wegen der tatsächlich wachsenden Belastung durch die demographische Alterung unter steigendem Druck."
Um mit der nun dennoch geforderten Eingliederung von Beamten, Abgeordneten und Selbständigen die Rentenkassen entlassen zu können, zielt Bas offenbar auf Leistungskürzungen zu deren Lasten ab. Es geht ihr jedoch um viel mehr, wie sie selbst sagt. Sie will deutlich machen, dass die drohende Erosion des Rentensystems eine unmittelbare Folge mangelnder sozialer Gerechtigkeit sei und dass es daher einer Reformagenda bedürfe, die durch Umverteilung „ein gerechtes System“ erzeuge.
Zum Verteilen: Wohlstandsverluste
Das Renten- und Sozialversicherungssystem steht jedoch weder wegen vermeintlicher Gerechtigkeitsdefizite – wie Bas behauptet – noch wegen der tatsächlich wachsenden Belastung durch die demographische Alterung unter steigendem Druck. Die drohende Erosion resultiert daraus, dass in Deutschland aufgrund des seit Jahrzehnten rückläufigen Produktivitätswachstums immer geringere Wohlstandszuwächse erreicht werden. Durch die seit drei Jahren sogar sinkende Arbeitsproduktivität drohen nun sogar fortgesetzte Wohlstandsverluste, sofern es nicht gelingt, diesen Trend umzukehren. Denn bei stagnierender oder sogar sinkender Arbeitsproduktivität wird in der gleichen Arbeitszeit eine sinkende Menge an Gütern erzeugt, so dass die Realeinkommen entgegen dem historischen Trend nicht mehr steigen.
Dieser Wohlstandsverlust hat sich in den vergangenen Jahren bereits durchgesetzt und sich auf das Rentensystem ausgewirkt. Denn obwohl die Anzahl der Rentenbeitragszahler im Verhältnis zu den Rentenbeziehern in den vergangenen Jahren sogar leicht gestiegen ist und daher das Rentenniveau stabil bei über 48 Prozent lag, sind die realen Renten gesunken. In Westdeutschland lagen sie 2024 real 4 Prozent niedriger als noch 2020, in Ostdeutschland kam es wegen der vereinigungsbedingt höheren Rentenanpassung zu einer Stagnation. Die Ursache für die verminderte Kaufkraft der Renten lag in den Reallohnverlusten, die im Zeitraum von 2019 bis 2024 etwa 2,5 Prozent ausmachten und über die Rentenformel auf die Renten übertragen wurden.
Auch im historischen Rückblick lässt sich erkennen, dass weder ein vermeintlicher oder tatsächlicher Mangel an sozialer Gerechtigkeit noch die demographische Alterung steigenden Renten und dem kontinuierlichen Ausbau des Sozialversicherungssystems im Weg stand. Denn seit der im frühen 19. Jahrhundert in Deutschland einsetzenden Industrialisierung wurde mit jährlichen Produktivitätszuwächsen von durchschnittlich etwa 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr ein so erheblicher Wohlstandszuwachs erreicht, dass die von einer steigenden Lebenserwartung und der seitdem sinkenden Reproduktionsrate ausgehende demographische Alterung ohne reale Einkommenseinbußen der Erwerbstätigen aufgefangen werden konnte. Ganz im Gegenteil gelang es sogar, das Renten- und Sozialversicherungssystem – bei zudem enorm steigendem Wohlstand der Erwerbstätigen – auf das heute im internationalen Vergleich sogar besonders hohe Niveau auszubauen.
„Aufgrund ausbleibender Produktivitätsgewinne steht die Sozialpolitik inzwischen vor dem Dilemma, bei nun bis voraussichtlich Ende der 2030er Jahre deutlich steigenden demographischen Lasten Wohlstandsverluste verteilen zu müssen."
Aufgrund ausbleibender Produktivitätsgewinne steht die Sozialpolitik inzwischen vor dem Dilemma, bei nun bis voraussichtlich Ende der 2030er Jahre deutlich steigenden demographischen Lasten Wohlstandsverluste verteilen zu müssen. Die Ursache dieses Dilemmas wird jedoch von Sozial- und Wirtschaftspolitikern aller Couleur beiseitegeschoben. Sie fokussieren sich vollkommen auf die demographische Entwicklung sowie auf soziale Gerechtigkeit und setzen ausschließlich die Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstands auf die Agenda. Diese Herangehensweise findet auch daher ungeteilten Zuspruch, da die meisten Protagonisten in der Vergangenheit leben. Sie gehen von der falschen Prämisse eines in Deutschland noch immer steigenden Wohlstands aus. Dies führt jedoch dazu, dass ihre Agenda für mehr soziale Gerechtigkeit und Umverteilung nun zur Legitimierung von Sozialabbau und Realeinkommensverlusten beiträgt.
So verkaufte der seinerzeitige Bundesminister Hubertus Heil (SPD) den von ihm und dem damaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der vergangenen Legislaturperiode vorgelegten Vorschlag zur Rentenreform als wichtigen Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit, weil damit auf lange Sicht die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent gelinge. Um jedoch das Rentenniveau auf diesem Niveau stabilisieren zu können, hätten die Rentenversicherungsbeiträge nach Heil und Lindners Berechnungen von derzeit 18,6 Prozent auf zunächst 22,3 Prozent bis 2030 steigen müssen. Bei stagnierenden Reallöhnen hätte sich das verfügbare Einkommen der Erwerbstätigen allein aufgrund der steigenden Rentenbeiträge, also auch ohne die ebenfalls anstehende Erhöhung der Kranken- und Pflegversicherungsbeiträge, spürbar vermindert.
Um dieses Manko zu beschönigen, erklärte Heil seinerzeit, dass die Stabilisierung des Rentenniveaus primär den heutigen und zukünftigen Beitragszahlern zugutekomme. Mit dieser Reform gehe es ihm „vor allen Dingen auch um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute, um die Menschen, die jeden Tag aufstehen und hart arbeiten“, also um mehr soziale Gerechtigkeit, erklärte er im Bundestag. Durch die Rentenreform seien auch sie, wie die heutigen Rentner, „am Ende ihres Erwerbslebens auch ordentlich abgesichert“. Aber auch dies ist nur ein frommer Wunsch, sofern es in Deutschland nicht gelingt, wieder zu steigender Arbeitsproduktivität und Realeinkommensgewinnen zurückzukehren. Denn selbst bei einem stabilen Rentenniveau würden – wie in den vergangenen Jahren geschehen – Reallohnverluste 1:1 an die Rentner durchgereicht, so dass sich die heutigen Betragszahler mit einem noch niedrigeren Lebensstandard als die heutigen Rentner zufriedengeben müssten.
„Da inzwischen Wohlstandsverluste verteilt werden müssen, trägt Bas' Agenda für mehr soziale Gerechtigkeit dazu bei, Realeinkommenseinbußen durchzudrücken."
Mit ihrem polarisierenden Vorstoß versucht Bas die Diskussion um die Sicherung der Renten in die ihr politisch genehme Richtung zu lenken. Offenbar soll die Debatte auf die Frage sozialer Gerechtigkeit und sozialpolitischer Umverteilung verkürzt bleiben. So lässt sich das Problem stagnierenden Wohlstands auch weiterhin aus der Diskussion heraushalten und Bas dürfte darauf spekulieren, dass sie durch umso beherzteres sozialpolitisches Umverteilungsmanagement politischen Zuspruch und Legitimität erhält.
Ob diese Rechnung aufgeht, ist fraglich. Da inzwischen Wohlstandsverluste verteilt werden müssen, trägt ihre Agenda für mehr soziale Gerechtigkeit nun dazu bei, Realeinkommenseinbußen durchzudrücken. Zunächst geht es um vermeintlich privilegierte Beamte und Selbständige, die ihren solidarischen Beitrag leisten sollen, „um Akzeptanz, um ein gerechtes System“ zu schaffen, wie sie behauptet. Unter ihrer Regie dürfte die Sanierung des Rentensystems demnach zu Lasten der Erwerbstätigen erfolgen, sei es durch höhere Steuern, höhere Rentenbeiträge oder sinkende Renten.
Wachstumsorientierte Sozialpolitik
Mit dieser Agenda fällt die neue Arbeits- und Sozialministerin weit hinter den Koalitionsvertrag zurück. Denn obwohl dort die Frage, wie die Renten langfristig gesichert werden sollen, vollkommen offen bleibt, ist eine Erkenntnis eingeflossen, die die Rentendiskussion endlich auf eine neue Ebene hieven könnte. Im Kapitel über die Rente wird ausgeführt: „Nur eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik“ ermöglicht es, die „Alterssicherung für alle Generationen auf verlässliche Füße zu stellen“ und „dies dauerhaft zu finanzieren“.
An anderer Stelle im Koalitionsvertrag wird erklärt, dass man das Potenzialwachstum, also das durchschnittlich erwartbare Wirtschaftswachstum, das Ökonomen für Deutschland auf nur noch 0,4 Prozent pro Jahr schätzen, auf „deutlich über ein Prozent“ steigern wolle. Dies würde eine Umkehrung des Trends in Richtung rückläufiger Arbeitsproduktivität erfordern und ist eine große wirtschaftspolitische Herausforderung, die sicherlich nur gemeistert werden kann, wenn die gesamte Bundesregierung dieses Ziel ins Zentrum ihrer gemeinsamen Agenda rückt. Bas sollte sich besser an dieser im Koalitionsvertrag formulierten Herausforderung orientieren und eine auf Produktivitätsfortschritte ausgerichtete Sozial- und Arbeitspolitik verfolgen. Nur wenn es gelingt, zum Produktivitätswachstum zurückzukehren, kann sie Wohlstand wieder gerecht verteilen, anstatt Mangel zu verwalten.