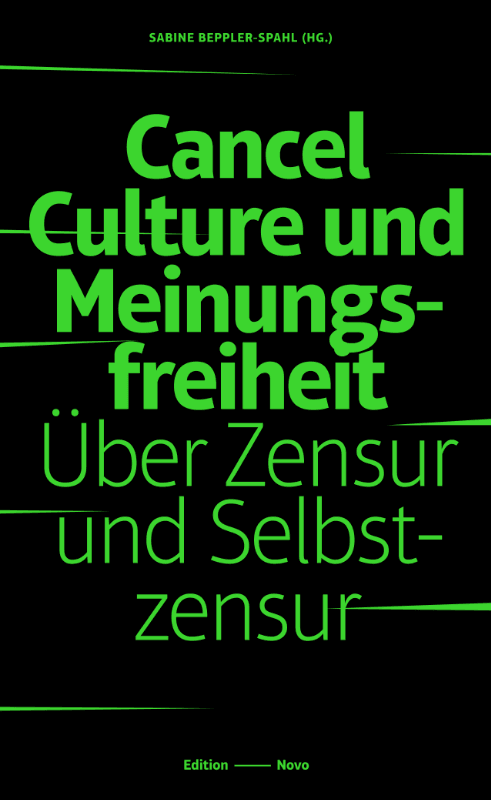04.06.2025
Kulturkampf um den Bauernkrieg
Vor 500 Jahren tobte der Bauernkrieg. Heute prägt die Angst vor dem Populismus die Erinnerung an das historische Ereignis in Deutschland.
Was vor fünfhundert Jahren geschah, war ein Volksaufstand, heißt es in einem Beitrag in der F.A.Z. zum Bauernkrieg von 1525. Im selben Atemzug, stellt der Autor Andreas Kilb mit einiger Verwunderung fest, wie still es um den Jahrestag dieses Ereignisses geblieben ist. Keine große Ausstellung in Berlin, München oder Stuttgart. Kein Gedenken in den großen Häusern der Geschichtsschreibung.
Dabei war dieser Aufstand, dem sich nicht nur Bauern, sondern auch Bergleute (es ging um Eisenerz) und städtische, plebejische Schichten sowie auch einige Ritter anschlossen, eines der einschneidendsten Ereignisse der deutschen Geschichte. Hunderttausende beteiligten sich. Die australische Historikerin Lyndal Roper spricht vom größten Volksaufstand in Westeuropa vor der Französischen Revolution. In Memmingen formulierten aufständische Bauern die berühmten Zwölf Artikel, in denen sie – nichts weniger – als „Freyheit“ forderten.
Zugegeben, es gab kleinere Veranstaltungen. In Bad Frankenhausen und Mühlhausen, den Wirkungsorten Thomas Müntzers, wurde z.B. des Aufstands gedacht. Aber im Vergleich zum Reformationsjubiläum 2017 mit seinen unzähligen Festakten ist das Schweigen auffällig. Es ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines tiefen Unbehagens, das die Ereignisse von 1525 bis heute in Politik und Medien auslösen. Ein Unbehagen, das im Zeichen wachsender populistischer Bewegungen noch zugenommen hat.
Besonders seit den Bauernprotesten des letzten Jahres, als plötzlich Gummistiefel an Ortsschildern, Traktoren und Zäunen im ländlichen Raum auftauchten – Symbole, die schnell als Zeichen des Aufbegehrens gelesen wurden. Eine bewusste Anspielung auf den historischen Bundschuh, eines der bekanntesten Embleme der aufständischen Bauern im frühen 16. Jahrhundert.
„Der Bauernkrieg wurde nun zum Schauplatz eines ideologischen Stellvertreterkriegs.“
Plötzlich bekam ein 500 Jahre altes Ereignis eine beunruhigende Gegenwartsbedeutung. Der Bauernkrieg – bislang vor allem Mythos der politischen Linken (Friedrich Engels schrieb seine berühmte Schrift darüber 1850, unter dem Eindruck der gescheiterten 1848er-Revolution; in der DDR wurde der Aufstand zum Gründungsmythos erhoben) – wurde nun zum Schauplatz eines ideologischen Stellvertreterkriegs. Und die Warnungen folgten prompt.
„Seit mehreren hundert Jahren begleiten Bauernproteste die deutsche Geschichte. An den jüngsten Protesten von Landwirt:innen versuchte die extreme Rechte zu partizipieren“, schrieb etwa die linke Wochenzeitung Kontext im September 2024. Auch Mirko Gutjahr, Historiker und Leiter der Luther-Museen in Eisleben und Mansfeld, warnte in einem Podcast vor einer „rechten Instrumentalisierung“. Er erinnerte daran, wie Robert Habeck nach seinem Weihnachtsurlaub von aufgebrachten Bauern empfangen wurde – eine Szene, die, so Gutjahr, „zurecht“ die Stimmung gegen die Protestierenden verschärft habe.
Der Theologe Michael Haspel schrieb über den Bauernkrieg, „Freiheit zielt auf die Gleichheit aller. Freiheit muss durch das Recht bewahrt werden“. Deshalb, so sein Argument, unterscheide sich die damalige Bewegung von denen der Populisten, die auf Ausgrenzung und Abwertung anderer setzten.
Der öffentlich-rechtliche Sender SWR Kultur sah im Bauernkrieg gar einen Kampf um „Teilhabe“ – und eine frühe Formulierung universeller Menschenrechte. Eine historisch gewagte Zuschreibung, wenn nicht gar Projektion: Modische Begrifflichkeiten wie „universelle Menschenrechte“ oder „Teilhabe“ wären den Akteuren von 1525 vollkommen fremd gewesen.
„Hinter dem Unbehagen gegenüber der historischen Erinnerung steht die Angst des Establishments vor der Masse.“
Dass die Erinnerung an den Bauernkrieg heute umkämpft ist, verwundert wenig. Jede Seite bezichtigt die andere der Instrumentalisierung. Tatsächlich ist der Bauernkrieg zu einem neuralgischen Punkt im deutschen Erinnerungskanon geworden – einem Spiegel, in dem sich die aktuellen Kulturkämpfe brechen.
Hinter dem Unbehagen gegenüber der historischen Erinnerung steht die Angst des Establishments vor der Masse. In Wahrheit gibt es keine direkte Linie von 1525 in die Gegenwart. Die Welt war damals eine andere und noch vom Feudalismus geprägt. Die Anführer der Aufstände wurden gevierteilt, verbrannt, enthauptet. Weder die Herrschenden von heute noch die protestierenden Landwirte lassen sich eins zu eins mit ihren historischen Vorgängern vergleichen.
Doch genau das ist der Punkt. Es geht nicht um historische Genauigkeit, sondern um moralische Legitimität. Die bloße Möglichkeit, dass die heutigen Populisten sich auf die Seite der „Freyheit“ und Gerechtigkeit schlagen könnten, erschreckt ihre Gegner. Es ist diese Vorstellung, nicht die Geschichte selbst, die den Ton der Debatte bestimmt.
Oder, wie Marx schrieb: „Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden.“ Der Versuch des Establishments, die Deutungshoheit über den Bauernkrieg zu behalten, spricht Bände über seine eigene Unsicherheit – über die Angst vor der einen, immer wiederkehrenden Frage: Was wäre, wenn große Teile des Volkes es doch einmal ernst meinten mit der Forderung nach Veränderung und dem Aufstand?