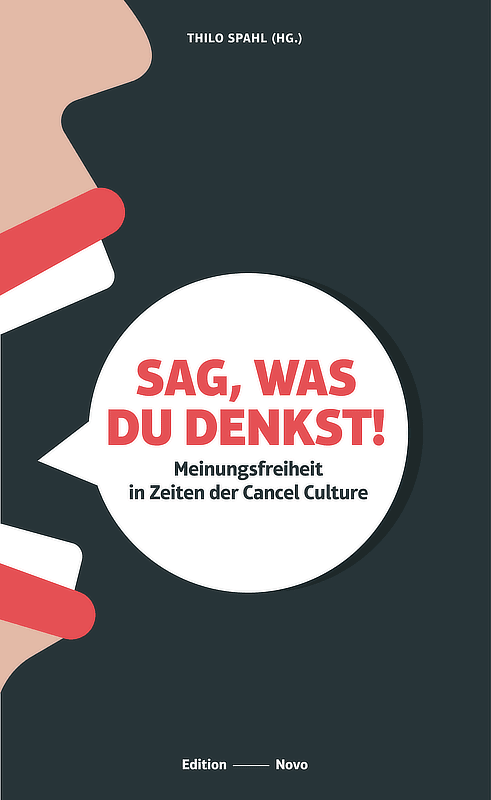11.02.2022
Ich fordere Deinungsfreiheit!
Tastendes Denken braucht Spielräume. Einschränkungen der Meinungsäußerung machen die Gesellschaft anfälliger für Irrtümer.
Nein, es ist kein Schreibfehler! Mein Plädoyer hier zielt nicht auf Meinungsfreiheit. Es geht mir tatsächlich um Deinungsfreiheit. Die gibt es zwar – noch – nicht. Aber was sollte dagegensprechen, sich für einen neuen Begriff zu begeistern? Ich möchte das, was ich über den Begriff der Deinungsfreiheit meine, in neun kleinen Schritten vorstellen.
1.
Grundrechtliche Freiheitsräume werden bekanntlich in Begriffen erfasst und mit Worten beschrieben. Der in terminologischer Hinsicht unproblematischste Schutzbereich eines solchen Raumes ist wohl der, den der 13. Artikel unseres Grundgesetzes benennt: die Wohnung. Bei ihr mag man über Angrenzungsfragen diskutieren („Gehört eine Garage mit zur Wohnung, wenn sie baulich nicht mit dem Gebäude verbunden ist?“). Im Kern aber ist unzweifelhaft: Wo ein Mensch lebt, schläft, isst und also wohnt, da ist seine Wohnung.
Schwieriger schon, aber immerhin doch noch an Äußerlichkeiten erkennbar, ist die Bestimmung des Begriffsinhaltes anderer Grundrechte: Was ist das religiöse Bekenntnis eines Menschen? Wann ist etwas eine Demonstration? Wer gehört zu einer Familie? In diesen Fällen lässt sich von Umständen, die der Jurist bisweilen „Hilfstatsachen“ nennt, auf den Kern des Schutzgutes rückschließen. Die Definition dessen, worum es geht, erhält damit wenigstens einen ersten argumentativen Ankerpunkt.
Ganz anders ist das mit der Meinungsfreiheit. Das zugehörige Grundrecht will das „Meinen“ schützen. Was aber, fragen sich nicht nur Juristen, ist überhaupt das „Meinen“? Wodurch ist es gekennzeichnet? Was macht das „Meinen“ aus? Versucht man, den Begriffsinhalt dieser Bezeichnung zu bestimmen, stößt man sehr schnell an Grenzen. Oder, besser gesagt: Man stellt fest, schon nach nur wenigen Gedankenschritten außerhalb aller Geländer in leerem Gelände zu stehen. Insbesondere der Versuch, sich dem mit „Meinen“ gemeinten Meinungsinhalt wortlautinterpretatorisch nähern zu wollen, führt sofort ins Leere. Will sagen: Etymologisch meint es dieser Ansatz gar nicht gut mit uns. Die Suche nach Synonymen verrennt sich bald ohne substantielle Ergebnisse in der Trias aus Meinen, Denken und Fühlen. Definitorisch gewonnen ist damit nichts.
„Die Rechtsprechung weist auf das offenkundig Subjektive des Meinens hin: Das, worum es beim Meinen geht, spielt sich offenbar ganz wesentlich im Inneren des Einzelnen ab.“
Dies spiegeln Gerichtsentscheidungen zu Streitigkeiten über Meinungsfragen üblicherweise wider, wenn sie betonen, das „Meinen“ sei durch ein subjektives Element des Dafürhaltens gekennzeichnet. Dies rückt zwar die Vokabel der „Haltung“ in die Nähe der Meinung, konturiert aber insoweit augenscheinlich nicht wirklich eine Antwort auf die Frage: Was genau tut einer, der etwas „meint“? Immerhin weist die Rechtsprechung hier auf das offenkundig Subjektive des Meinens hin: Das, worum es beim Meinen geht, spielt sich offenbar ganz wesentlich im Inneren des Einzelnen ab. Ich kann etwas meinen, ohne dass es irgendjemand bemerkt. Anders gesagt: Einer, der nur dasitzt, sich schweigend seinen Teil denkt und irgendetwas dabei meint, der verlässt sein Inneres überhaupt nicht. Warum aber sollte er dann dazu eines einklagbaren Grundrechtes bedürfen?
Meinung muss man äußern dürfen
2.
Diese Frage zu stellen, führt zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass es im Kern nicht die Freiheit einer (unmerklichen) Meinung ist, die des verfassungsrechtlichen Schutzes bedarf. Was geschützt werden soll und muss, ist tatsächlich die Freiheit, eine Meinung zu äußern. Denn nur dann, wenn die Meinung eines einzelnen nach außen tritt, kann sie für einen Disput – und dann: einen Dissens – überhaupt erst bedeutsam werden. Anders gesagt: Einer jeden Abgrenzung von individuellen Befugnissen gegeneinander bedarf es nur dort, wo Interaktionen zwischen Beteiligten mindestens theoretisch möglich sind. Wer schweigend meint, der interagiert nicht. Und selbst der, der seine Meinung lautstark äußert, der sie schallend herausschmettert, kollidiert nicht mit irgendwelchen Sphären anderer, wenn die dies gar nicht zur Kenntnis nehmen. Robinson Crusoe konnte alles sagen, was er wollte. Es hatte keine Bedeutung für andere. Denn sie bemerkten es nicht.
Für die Bestimmung des Begriffs der „Meinungsäußerungsfreiheit“ ist damit zumindest schon einmal die Erkenntnis gewonnen, dass das wahre Schutzgut für alles subjektive Meinen irgendwo in der äußeren, objektiven Welt liegen muss. Meinungsfreiheit als solche hat also kein fassbares Substrat, weil das bloße Meinen allen anderen unentdeckt bleibt. Interessant (und potentiell problematisch) wird es gesellschaftlich und rechtlich und systematisch erst, wenn das Element der Interaktion zum dann offengelegten Meinen hinzutritt.
3.
Damit sind zwar zwei abgrenzbare Sphären für die Betrachtung konturiert: eine (für Interessenkonflikte prinzipiell irrelevante) Sphäre der unbemerkten individuellen Subjektivität hier und eine in der objektiven Realität bemerkbare Sphäre von individuellen Äußerungen dort. Diese Differenzierung führt aber nicht weiter bei dem Versuch, die Frage zu beantworten, was genau eine „Meinung“ sein kann, die äußern zu können Schutz verdiene.
„Was geschützt werden soll und muss, ist tatsächlich die Freiheit, eine Meinung zu äußern.“
An dieser Stelle dürfte sich empfehlen, den Blick der Betrachtung kurz vom Gegenstand der „Meinung“ auf einen anderen Gegenstand zu wenden: Ebenso wie das Meinen hat nämlich auch das Wissen eine primär subjektive Komponente. Was ein Mensch weiß (und was er nicht weiß), ist zuallererst eine Frage nach dem, was er in seinem Kopf hat. Sagt er nicht, was er weiß, kann also auch sein Wissen nicht in der Interaktion mit anderen kollidieren.
Anders als im Kontext des „Meinens“ (wo man oft sagen hört, es gehe um „Meinungsfreiheit“ statt – wie beschrieben – um „Meinungsäußerungsfreiheit“) geht Rednern hier offenbar nie durch den Kopf, ein Grundrecht der „Wissensfreiheit“ einfordern zu müssen. Ohne hier psycholinguistisch zu spekulativ werden zu wollen, könnte die Vermutung naheliegen, dass all jenen, die zwar „Meinungsfreiheit“ verteidigen, nicht aber auch „Wissensfreiheit“, dabei unausgesprochen ein gewichtiger Unterschied zwischen Meinen und Wissen bewusst ist: Ob das, was einer zu wissen glaubt, und was er deswegen vernehmlich äußert, auch tatsächlich zutrifft, das lässt sich in der äußeren, realen Welt auf seinen Wahrheitsgehalt überprüfen.
Die Äußerung eines Umstandes, von dem ein Mensch weiß, dass er zutrifft, ist daher im Wesentlichen risikolos. Das subjektive Wissen kann nach außen treten und sich gefahrlos in den harten Wind der intersubjektiven Überprüfung wagen. Solange der Wissende sich nur zuvor selbst kritisch geprüft und dabei sichergestellt hat, seine Behauptung nötigenfalls objektivierbar beweisen zu können, muss er die Konsequenzen seines Heraustretens unter den Bedingungen eines funktionsfähigen Rechtsstaates nicht fürchten. Wer insoweit also unangreifbar ist, der braucht auch keine rechtlichen Schutzräume. Das Kollisionspotential seiner Erklärung in der öffentlichen Interaktion ist vernachlässigbar.
Ganz anders aber steht es – um nun wieder das „Meinen“ in den Blick zu nehmen – um dasjenige Etwas, das unter den Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit fallen soll. Was jemand nur meint, das kann er nicht als falsch oder richtig beweisen. Die Äußerung einer Meinung ist also gegenüber der Erklärung eines Wissens der weit riskantere kommunikative Akt. Wäre das, was der Meinende sagt, tauglicher Gegenstand eines Wissens, müsste seine Äußerung nicht mit dem subjektiven Gefühl eines Unbestimmtseins abgegeben werden. Anders als beim Wissen bietet das Meinen demjenigen, der meint, weder selbst kognitive, noch gar kommunikativ akzeptierte Sicherheit. Gegenüber der Sicherheit des Wissens ist das Meinen daher stets mindestens vorübergehend noch eher unbestimmt. Wer etwas meint, der fragt sich also eher noch selbst, als dass er sich schon eine Antwort gäbe.
„Die Äußerung einer Meinung ist gegenüber der Erklärung eines Wissens der weit riskantere kommunikative Akt.“
Die Fühler ausstrecken
4.
Da sich sowohl das noch ungeäußerte Meinen als auch das nicht erklärte Wissen nur im Bereich des individuellen Denkens abspielen, ließe sich konstatieren: Wissen ist die Art von Denken, die auf größerer individueller Sicherheit beruht als das Meinen. Denn der Inhalt erklärten Wissens lässt sich – sobald es geäußert ist – nötigenfalls als zutreffend beweisen. Der Inhalt des Gemeinten ist einem solchen Wahrheitsbeweis dagegen mindestens vorübergehend noch nicht zugänglich.
Bei Gericht erklären Zeugen, die ihre Wahrheitspflicht ernst nehmen, deshalb manchmal klarstellend: „Ich meine, mich zu erinnern, dass …“. Denken, das noch keine eigene Sicherheit gefunden (oder sie durch Zeitablauf wieder verloren) hat, verunklart sich mit solchen Erklärungen in die sicherere, unangreifbare Sphäre des unverbindlichen Meinens. Insoweit ist alles Meinen dem bloßen Vermuten oder reinen Mutmaßen nahe: Ihm fehlt die Sicherheit, Gewusstes oder Bewusstes zu sein. All dies dürfte hier die definitorische Hypothese legitimieren: Meinen ist tastendes Denken.
Die Gedanken des Meinenden versuchen, sich tastend an einen Gegenstand heranzufühlen. Der Meinende will dabei durchaus positiv sagen, was er für richtig hält. Sein Meinen ist also mehr als nur die bloße Negation. Ein Zeuge, der vollends im Unbestimmten bleiben will, sagt dagegen nicht, was er aktuell noch über Früheres meint, sondern er erklärt stattdessen: „Ich weiß nicht, ob ich das damals wusste.“ Die Erklärung eines solchen Unwissens ist – ebenso wie ein prozesstaktisch vorsorgliches Bestreiten unliebsamen gegnerischen Vortrages mit Nichtwissen – die Verweigerung aller Versuche, sich tastend an der interaktiven Wahrheitsfindung zu beteiligen. Und weil Irren für das Denken dasselbe ist wie das Stolpern für das Gehen, verweigert der sein Wissen so verschließende Zeuge selbst den vorsichtig tastenden Gang nach vorn.
„Meinen ist tastendes Denken. Die Gedanken des Meinenden versuchen, sich tastend an einen Gegenstand heranzufühlen.“
5.
Ganz anders als ein solcher Zeuge, der sein subjektives Inneres von der Welt abkapselt, verhalten sich Menschen, die einander ihre Meinungen äußernd offenlegen. Im intersubjektiven Dialog wagen sich die tastend Denkenden aus ihrer Subjektivität hinaus in die Außenwelt, um ihr je eigenes inneres Erwägen in der Außenwelt gemeinsam mit anderen zu erproben und sich der gedanklichen Folgerichtigkeit ihrer eigenen Überlegungen zu vergewissern.
Einander zu erklären, was man meint, erfordert daher einen Raum des wechselseitigen Vertrauens. Denn das, was man meint, kann man dem anderen – wie gezeigt – nicht beweisen. Das Gemeinte ist dem Nachweis nicht ebenso zugängig wie ein Gewusstes. Gleichwohl ist alles Meinen des Einzelnen auf diese Erprobung seines Überlegens im Dialog mit anderen, die möglicherweise etwas Abweichendes meinen oder vermuten oder mutmaßen, elementar angewiesen. Denn gerade weil der Meinende sein Meinen nicht insgeheim in der objektiven Welt einem experimentellen Wahrheitsbeweis unterziehen kann, um es dann – bei dessen Gelingen – interaktiv als erweisliches Wissen zu äußern, ist er auf einen Abgleich mit anderen unausweichlich angewiesen. Insofern ist es die Besonderheit allen Meinens, gerade wegen seiner wesensmäßigen Unbestimmtheit auf einen gedanklichen Abgleich mit einem ebenso wenig konturenscharfen Meinen anderer angewiesen zu sein.
Das bedeutet aber auch: Je weniger das eigene subjektive Meinen auf sich selbst zurückgeworfen ist, je mehr es sich also durch freie Äußerung in den Dialog mit anderen hervorwagen darf, desto weniger irrtumsanfällig ist und bleibt es. Wer nicht alleine denkt, sondern sich in seinem Meinen an anderen ausbalancieren kann, dessen Denken steht weniger in der Gefahr, ins Stolpern zu geraten. Auf diese Weise wirkt die Freiheit der Meinungsäußerung auf die Qualität des unmerklichen Meinens zurück. Die Balancen, die Gegengewichte, die Widerstände auch des geäußerten Meinens anderer konturieren das eigene Meinen und führen es dadurch vielleicht sogar in die Richtung des belastbaren, einem Beweis als richtig zugänglichen Wissens.
Weniger Freiheit und schlechte Gedanken
6.
Der Schutzraum, in dem sich ein solcher Diskurs der Meinungen ereignen kann, vergrößert sich erheblich, wenn er nicht nur auf die Sphären des privaten Vertrauens konkreter Beteiligter zueinander beschränkt bleibt, sondern wenn er durch entsprechende verfassungsrechtliche Garantien im gesamten öffentlichen Raum ermöglicht wird. Je mehr Beteiligte risikolos wagen können, ihr noch nicht objektiv beweisbares Meinen oder auch ihr noch nicht gefestigtes moralisches Urteil mit anderen zu erörtern, desto größer wird der Diskursbereich für alle. Das angstlose Heraustreten des Einzelnen mit seinem Meinen in den offenen Dialog bereichert alle Diskursteilnehmer um die Möglichkeit, sich zu seinen Meinungsäußerungen zu positionieren, sei es zustimmend oder ablehnend.
„Je weniger das eigene subjektive Meinen auf sich selbst zurückgeworfen ist, je mehr es sich also durch freie Äußerung in den Dialog mit anderen hervorwagen darf, desto weniger irrtumsanfällig ist und bleibt es.“
Schneidet man die Möglichkeiten der Meinungsäußerungsfreiheit hingegen zurück, indem man sie den tastend Denkenden ganz oder teilweise entzieht oder indem man ihre Äußerungen durch die Androhung von Sanktionen nur faktisch eingrenzt, dann ergeben sich gleich mehrere Folgen. Man verkleinert nicht nur den Bereich, in dem eine intersubjektive Erörterung des individuellen Meinens stattfindet und aus dem heraus sich künftig für jedermann fruchtbares Wissen ergeben könnte. Man minimiert auch – wie vorstehend beschrieben – die Chancen für jeden Einzelnen, seine eigenen Irrtümer im Dialog mit anderen zu bereinigen. Die Qualität des individuellen Meinens lässt nach, wenn es sich nicht im Diskurs mit anderen bewähren kann oder muss. Das Potential folgerichtigen, subjektiven Denkens wird reduziert. Dies beraubt die Gesellschaft nicht nur ihrer Möglichkeiten, durch die intellektuellen Kapazitäten Einzelner gedeihliche Fortschritte zu erzielen. Es führt im Gegenteil sogar dazu, dass sich der Pool aus möglichen guten Gedanken verkleinert, da gute Gedanken nicht im Dialog geschärft und verbessert werden können. Mehr noch: In der erzwungenen Absonderung von anderen wächst die Wahrscheinlichkeit individueller Irrtümer. Wer alleine denkt und meint, wird durch andere nicht ausbalanciert. Kurz: Wo die Freiheit, eigenes Meinen nicht gefahrlos äußern zu können, begrenzt wird, da wächst die Wahrscheinlichkeit für schlechtere Gedanken.
7.
Es gehört zu den empirisch erfahrbaren Tatsachen, dass Meinungsverschiedenheiten unter Menschen regelmäßig mit höherer Emotionalität und – daraus abgeleitet – mit größerer Aggressivität oder gar Destruktivität ausgetragen werden als bloße Wissensverschiedenheiten. Die Erklärung für dieses Phänomen liegt auf der Hand, wenn man sich vergegenwärtigt, was den Unterschied zwischen meinendem Denken und wissendem Denken kennzeichnet: Die Äußerung einer nachweisbar unzutreffenden Wissenserklärung lässt sich experimentell vergleichsweise einfach aus der Welt schaffen: Man stellt die unrichtige These des Kontrahenten auf die praktische Probe, führt vor, dass sie dysfunktional ist, und hat damit sein Argument effektiv widerlegt. Genau das ist aber – wie erläutert – mit einer Meinungsäußerung nicht möglich. Das lediglich Gemeinte ist dem Experiment nicht zugänglich.
Stimmt X der von Y geäußerten Meinung also nicht zu, vertritt er eine andere Meinung oder tritt er dieser Meinung sogar robust argumentierend entgegen, dann hat Y keine greifbare Handhabe, einen effektiven Gegenbeweis anzutreten, um X zu kontern. In der Nichterweislichkeit der kollidierenden Mutmaßungen und in der Unwiderlegbarkeit der widerstreitenden Vermutungen liegt daher ein hohes Konfliktpotential. Die Meinungsäußerung des anderen zu ertragen, obwohl sie der eigenen Meinung diametral entgegensteht, ist daher eine erhebliche emotionale Zumutung. Und diese Zumutung stammt in aller Regel aus derjenigen Hirnhälfte, die das eigene Meinen nicht rational konturiert hat.
Derartige Zumutungen des geäußerten fremden, denkenden Tastens zu ertragen, ist aber die nicht hinweg zu denkende Bedingung dafür, einen allseits gesellschaftlich gedeihlichen Diskurs ermöglichen zu können. Denn nur weil der einzelne diese Zumutung des Dissenses erträgt, hat er auch selbst ein Recht darauf, von dem anderen verlangen zu können, ihm sein eigenes denkendes Tasten zumuten zu dürfen. Wo ein Wahrheitsbeweis (noch) nicht möglich ist, da haben alle unwiderlegten Meinungen denselben Status.
„Nur weil der einzelne diese Zumutung des Dissenses erträgt, hat er auch selbst ein Recht darauf, von dem anderen verlangen zu können, ihm sein eigenes denkendes Tasten zumuten zu dürfen.“
Toleranz als Geben und Nehmen
8.
Das Erfordernis der wechselseitigen Toleranz als unverzichtbare Bedingung der Möglichkeit für die Existenz eines solchen Diskursraumes beschreibt zudem eine weitere, geradezu architektonische Voraussetzung für die dauerhaft tragfähige Statik solcher Räume: Wer fremde, dissentierende Meinungsäußerungen nicht mit eigener, duldsamer Stabilität ausbalanciert, der stellt die Standfestigkeit dieses Modells für einen allseitigen Wissenserwerb durch denkendes Tasten insgesamt in Frage. Ein Dialog über das Meinen kann nicht nur dadurch gefährdet oder gar zerstört werden, dass ein Beteiligter die gesellschaftlich akzeptierten Toleranzbereiche vorsätzlich ignoriert und überdehnt.
Unbotmäßige Schwäche und Verletzlichkeit gefährden (insbesondere dann, wenn sie nur vorgeschützt sind) die wesentliche intellektuelle Konstruktionsbedingung jeder auf gedeihliche Dialoge angewiesenen Gesellschaft in gleicher Weise. Gäbe es nicht das Phänomen der Zumutungen, bedürfte es keiner Toleranzen ihnen gegenüber. Gerade weil das, was X als seine Meinung äußert, für Y eine Belastung ist, muss Y diese Last tragen, will er nicht seine Möglichkeit verlieren, seine Lasten bei X abzuladen. Do ut des – ich gebe, damit du gibst.
9.
Um nach allem nicht nur die wesentliche Bedeutung der eigenen Meinung, sondern auch die der Meinung des anderen terminologisch zu unterstreichen, plädiere ich für die Einführung des Wortes „Deinungsfreiheit“ als der Freiheit jedes anderen, mir und allen anderen sein Meinen offenzulegen.
Ein solcher Neologismus ist wie eingangs gezeigt auch ohne jede Kollision mit semantischen Eingrenzungen aus der etablierten Bezeichnung des „Meinens“ möglich. Das Wort „Meinen“ hat keinen beschreibenden Charakter hinsichtlich seines Begriffsinhaltes, der dieser neuen Bezeichnung sprachlich Gewalt antäte.
Und was besonders bedeutsam ist: Anders als bei der „Meinung“ bedarf es bei der „Deinung“ auch keiner Klarstellung, dass nicht lediglich die Freiheit des unmerklichen Meinens gemeint ist. Denn an alles das, was ein anderer als seine „Deinung“ tastend denkt, kommt man schon zwangsläufig nur dadurch heran, dass man ihm gestattet, es auch tatsächlich offen zu äußern. Für den Fall, dass sich mein terminologischer Vorschlag zur Einführung der Deinungsfreiheit gesamtsprachlich nicht durchsetzen sollte, bleibt hoffentlich die Erkenntnis: Nur wo das offene Reden frei ist, kann es auf Dauer auch sinnvolles, freies Denken geben.