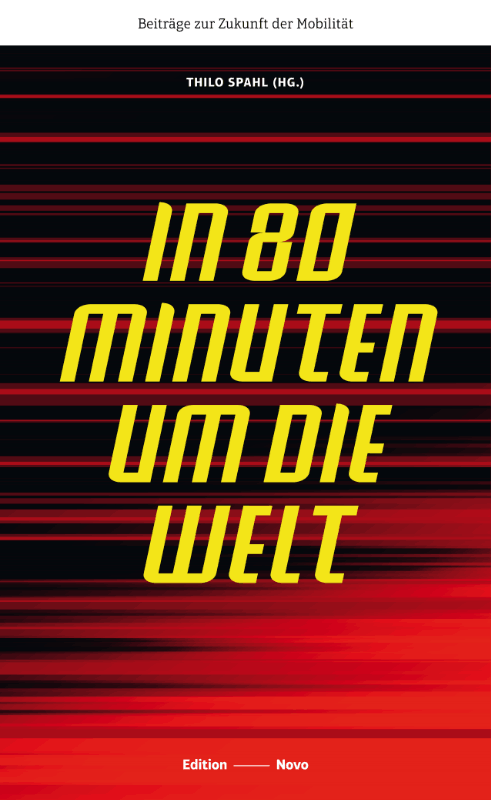08.09.2025
Flugreisen und ihre Feinde
Von Niels Hipp
Flugverkehr wird in Ländern wie Deutschland zunehmend verteufelt, nicht nur durch Klimadogmatismus. Die Argumente für den Verzicht stehen auf tönernen Füßen.
Wer heute ab oder bis Deutschland (und erst recht innerdeutsch) fliegen will, der hat mit diversen Problemen zu kämpfen. Durch die staatlich verursachten hohen Standortkosten gibt es weniger Billigflieger, überhaupt weniger Flüge zu vielen Orten und höhere Kosten sowie der Zwang zu mehr Umsteigeverbindungen. Aber was steckt dahinter?
Der Ansatzpunkt für die staatliche Regulierung ist, dass beim Fliegen neben diversen anderen Emissionen wie langlebigen Kondensstreifen CO2-Emissionen, die beide zur Erderwärmung beitragen, entstehen – wobei sich die ablehnende Haltung gegenüber dem Flugverkehr mehr auf den CO2-Ausstoß fokussiert. Dass CO2 auch durch Verbrennen fossiler Brennstoffe zur Erderwärmung beiträgt, ist durchaus plausibel. Aber schon die Annahme, dass die Erderwärmung allein auf den menschlichen Einfluss zurückzuführen sei, ist mehr als fragwürdig. Völlig abwegig ist die Annahme einer Klimakatastrophe, eine solche zu erwarten ist – wie bei Corona – blanke Panikmache und erinnert an endzeitliche Sekten.
Klimadogmatisierung
Vieles im Detail ist umstritten. Ein Phänomen ist aber wichtig zu erkennen: In der Klimawissenschaft ist genau das passiert, was wir nicht nur bei Corona gesehen haben, sondern auch im späten 19. und ins 20. Jahrhundert hinein bei der Eugenik, unter dem Deckmantel „Follow the science“ fand nämlich eine Dogmatisierung statt. Es ist ein Dogma entstanden, also ein Glaubenssatz, der nicht hinterfragt werden darf, hier derjenige vom rein menschengemachten, durch CO2 verursachten Klimawandel in Form von Erderwärmung, der alle bedrohe und daher unbedingt aufgehalten werden müsse. Hinterfragt man solche Dogmen oder auch nur Teilannahmen dann doch, stürzt das ganze Konstrukt schnell in sich zusammen.
Dogmen kennt man traditionell aus dem religiösen Bereich: Wer etwa nicht an Gott (oder Allah) glaubt, kann nicht als Christ oder Muslim bezeichnet werden. In einem von solchen Glaubenssätzen dominierten gesellschaftlichen Umfeld ist Intoleranz dann nicht weit weg. Der Ketzer der Klimareligion ist der „Klimaleugner“, der auf verschiedene Weisen verfolgt wird. Das trifft auch auf Leute zu, die auf positive Wirkungen von CO2 etwa für das Pflanzenwachstum hinweisen. Buße kann durch den Erwerb von Emissionsrechten, v.a. aber durch Verzicht getan werden. Fragen der Verhältnismäßigkeit stellen sich nicht, Fragen nach Kosten und Nutzen und jedwede ökonomischen Überlegungen gelten als inakzeptabel. Auch sehr weitgehende Grundrechtseinschränkungen können nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten sein, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimaschutzbeschluss von 2021 verkündete.
„In diesem manichäischen Weltbild gibt es gute und böse Verkehrsmittel.“
Beim Klimadogma ist aber neben der Dogmatisierung noch der totalitäre Charakter ein wichtiger Punkt, was keineswegs eine Übertreibung darstellt: Totalitäre Ideologien streben die vollständige ideologische Durchdringung der Gesellschaft an, was natürlich nie ganz gelingt. Beim Klima ist es die CO2-neutrale Gesellschaft, nicht die reinrassige der NS-Ideologie oder die klassenlose des Kommunismus, was aber einen ebenso großen ideologischen Wahnsinn bedeutet. Wer die Bezeichnung „totalitär“ für überzeichnet hält, der sollte nicht nur an den „Testballon“ Corona zurückdenken, sondern einmal überlegen, was politisch geplant ist oder schon umgesetzt wurde: Verbrennerverbot, Kohleausstieg, Ausbau erneuerbarer Energien, Heizungsverbot mit Öl und Gas, Emissionshandel, Erschwerung des Fliegens durch hohe Abgaben und Betankungspflicht mit SAF (Sustainable Aviation Fuel), Erschwerung von Fleischkonsum, EU-Taxonomie usw. Alle Lebensbereiche werden erfasst.
Solche totalitären Ideologien stehen stets auf Kriegsfuß mit der individuellen Freiheit und sind daher auch sehr kollektivistisch angelegt, entsprechend argumentieren ihre Protagonisten auch, etwa mit „wir als Gesellschaft“. Mit Formulierungen wie von einem „falschen Freiheitsverständnis“ vernebelt man seine Freiheitsfeindlichkeit. Nach alledem wundert es dann auch nicht, dass Fliegen als böse gilt, denn in diesem manichäischen Weltbild gibt es gute und böse Verkehrsmittel: Bahnfahren, Busfahren, Fahrradfahren und Zu-Fuß-Gehen sind gut, Fliegen ist böse, beim Autofahren variiert es je nach Radikalität: Während Fahren mit dem Verbrennerauto stets böse ist, wird das Elektroauto von manchen Vertretern akzeptiert.
In diesem Zusammenhang nicht zu vergessen sind auch Bemühungen von NGOs wie Stay Grounded oder Transport & Environment, den Flugverkehr zurückzudrängen. Deren „Experten“ – es sind oft die immer selben Personen – kommen dann im ÖRR oder in der Mainstream-Presse zu Wort.
Gegen das Fliegen
Was aber genau sind dort die Argumente gegen das Fliegen? Vorab muss man wissen, dass manche Vertreter – nicht alle – vorab den Entschluss gefasst haben, gegen das Fliegen zu sein. Das Motto „Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe“ gilt auch hier. Dementsprechend überzeugen die Argumente – auch beim CO2 – oft nicht bzw. wirken vorgeschoben. Als Exempel dient hier ein Artikel aus der Feder von Kathrin Boehme und Carolin Maaßen, der vor wenigen Monaten bei den Blättern für deutsche und internationale Politik erschien.
Geradezu anachronistisch erscheint etwa der Hinweis auf die begrenzten Ressourcen, was an den Club of Rome mit seinem Werk „Grenzen des Wachstums“ von 1972 erinnert. Die Voraussage, dass die Erdölvorräte binnen weniger Jahrzehnte zur Neige gehen würde, erfüllte sich bis heute nicht, im Gegenteil: Man findet immer wieder neue Ölfelder und durch bessere Technologie (etwa Fracking) kann man heute auch Öl in Schichten gewinnen, wo das früher nicht gelang. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass das Erdöl bald ausgeht: Die bekannten Ölreserven waren noch nie so groß wie heute. Bei Erdgas gilt das Gleiche. Es ist daher unsinnig zu argumentieren, dass irgendwann vielleicht – das lässt sich schlichtweg nicht prognostizieren – im, sagen wir, 22. Jahrhundert das Erdöl ausgeht. Man muss dann schauen, auf dieser spekulativen Basis kann man schlichtweg heute keine Entscheidungen treffen. Dass das Ressourcenargument trotzdem verwendet wird, zeigt von der Dogmatisierung des Denkens.
„Deutschland erhebt eine ziemlich hohe Luftverkehrssteuer, die zuletzt zum 1. Mai 2024 erhöht wurde und die nach Distanz gestaffelt ist.“
Auch ein verräterisches Argument ist, dass angeblich nur (weniger als) 10 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung jemals geflogen seien und eine Minderheit für die „Klimakrise“ verantwortlich sei. Da würde ich sagen: Aus dieser Minderheit soll ruhig langfristig eine Mehrheit werden! Dass die Klimadogmatiker umgekehrt diesem gewachsenen Anteil an der Weltbevölkerung das Fliegen auch noch erschweren wollen, zeigt, dass es ihnen gerade nicht um die Verbesserung der Lebensverhältnisse geht. Außerdem ist es merkwürdig, das Argument, das Fliegen sei nur die Angelegenheit einer Minderheit, zu benutzen: Oft sind es doch dieselben Kreise, die die angeblichen Anliegen allerkleinster Minderheiten groß und breit problematisieren: Während man etwa bei Stellenausschreibungen permanent mit „Divers“ genervt wird, waren beim Zensus 2022 etwa nur 969 von 82.728.306 Einwohnern Deutschlands divers.
Steuern aufs Fliegen
Das Thema Besteuerung ist immer so eine Frage. Richtig ist, dass es keine Kerosinsteuer gibt und für internationale Flüge auch keine Umsatzsteuer. Dafür erhebt Deutschland eine ziemlich hohe Luftverkehrssteuer, die zuletzt zum 1. Mai 2024 erhöht wurde und die nach Distanz gestaffelt ist: 15,53 Euro in Distanzklasse 1 (z.B. die Türkei), 39,34 Euro in Distanzklasse 2 (z.B. die Vereinigten Arabischen Emirate) und 70,83 Euro in Distanzklasse 3 (z.B. die USA). Dazu kommen noch diverse Gebühren, etwa die Luftsicherheitsgebühr. Und für innerdeutsche Flüge tritt noch die Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent hinzu. Allein im Rahmen der Luftverkehrssteuer nahm der Staat 2024 1,9 Milliarden Euro ein. Natürlich mag es prinzipiell schon diskussionswürdig sein, allgemein 19 Prozent auf alle Flüge ab Deutschland zu erheben. Das ist aber für internationale Flüge bisher nach den Regeln der UN-Luftfahrtorganisation Icao verboten, es sei denn, man würde bei jedem internationalen Flug die Teilstrecke vom deutschen Flughafen zur Staatsgrenze berechnen und dann besteuern, was einen enormen Aufwand bedeuten würde. Erhöbe man eine Umsatzsteuer auf internationale Flüge erheben, dann müsste aber im Gegenzug die Luftverkehrssteuer entfallen, was nach den Erfahrungen nicht nur mit der Regierung Merz nicht zu erwarten ist, so dass – wie im Inlandsflugverkehr – die Gefahr der Doppelbesteuerung bestünde.
Neben diesen steuertechnischen Details ist es natürlich auch verräterisch, wenn argumentiert wird, dem Staat würde durch die fehlende Kerosinsteuer ein Milliardenbetrag entgehen. Das ist wieder ein sehr etatistisches Denken in einer Zeit, in der die Steuer- und Abgabenquote ohnehin schon sehr hoch liegt. Manche wollen die Steuereinnahmen auch für die „Förderung“ von SAF, also sogenanntem Nachhaltigem Luftfahrttreibstoff nutzen. Aber warum muss SAF überhaupt „gefördert“ werden? Weil es sich am Markt – ähnlich wie Wasserstoff und in weiten Teilen Deutschlands auch Windkraft und Solar – schon aus Kostengründen nie durchsetzen würde. Ein Liter Kerosin kostet ungefähr 50 Eurocent, ein Liter SAF ist drei bis fünf Mal teurer. Mit dem Tanken von SAF statt Kerosin erfolgt dasselbe, was bei der Energiewende passiert ist: Man verabschiedet sich aus ideologischen Gründen vom wohlstandssteigernden Effekt billiger Energie.
„Für alle innereuropäischen Flüge müssen die Fluggesellschaften CO2-Emissionszertifikate kaufen, wobei es ab 2026 keine kostenfreien Zertifikate mehr gibt.“
Die Beimischungspflicht von SAF beruht auf der EU-Initiative ReFuelEU Aviation, gemäß derer im Zeitablauf (2025 bis 2050) steigende Quoten des SAF-Einsatzes bei Flügen ab EU-Flughäfen vorgesehen sind. Zusätzlich kostentreibend wirkt die Teilnahme am Emissionshandelssystem (EU-ETS). Für alle innereuropäischen Flüge müssen die Fluggesellschaften CO2-Emissionszertifikate kaufen, wobei es ab 2026 keine kostenfreien Zertifikate mehr gibt. Bei nicht-europäischen Flügen existiert CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) als Emissionshandelssystem, das sich von 2021 bis 2023 in einer Pilotphase befand, momentan (bis 2026) in Phase Eins steckt und ab 2027 – erst dann ist es verpflichtend – für alle Staaten ab 0,5 Prozent der globalen Luftverkehrsleistung (bezogen auf 2018) gilt.
Seit 2025 müssen Fluggesellschaften ab EU-Flughäfen zwei Prozent SAF tanken, dieser Anteil steigt sukzessive an. Während zwei Prozent noch einen eher symbolischer Wert bedeuten, führt aber schon dieser dazu, dass Air France für Flüge von Westeuropa etwa nach Rio de Janeiro eine SAF-Gebühr von zehn Euro berechnet, obwohl nur für die Langstreckenflug von Paris nach Südamerika, nicht aber für den Rückflug SAF zu tanken ist. Wie soll das aussehen, wenn im Jahr 2050 70 Prozent SAF getankt werden müssen? Außerdem: Kann man dann so viel Treibstoff überhaupt herstellen? Die Lufthansa hat mit den derzeitigen zwei Prozent schon ihre Probleme.
Andere Einwände
Gegen den Flugverkehr wird dann noch die Lärmbelästigung eingewandt, ein gerade in Deutschland altes Thema, was uns schon seit den 1970er Jahren begleitet.
Es wird behauptet, dass „Menschen, die in der Nähe von Flughäfen wohnen, durch Partikel und Lärmbelästigung einem höheren Risiko für Krankheiten wie Demenz, Bluthochdruck und Diabetes ausgesetzt sind. Allein in Deutschland sterben jährlich rund 43 000 Menschen aufgrund von Luftverschmutzung.“ Nicht nur die Zahl scheint willkürlich. Was heißt schon „aufgrund“? Als Hauptursache? Als alleinige Ursache? Oder „nur“ als Mitursache? An oder mit, wie bei Corona? Außerdem sind Lärm und ähnliches in einer modernen Gesellschaft unvermeidlich, neben der Tatsache, dass die Flugzeuge seit Jahrzehnten immer leiser werden. Außerdem: Wer nicht in der Einflugschneise eines Flughafens wohnen will, der kann ja umziehen.
„Lassen Sie sich vom Klimadenken nicht behindern. Fliegen Sie, ruhig weit weg, gerne mehrfach im Jahr.“
Manchmal findet man gegen den Flugverkehr auch Einwände in Form von schlechten Arbeitsbedingungen für das Personal. Natürlich sind im Fernreiseverkehr oft Zeitverschiebungen und – damit verbunden – das Problem des Jet-Lag zu beachten. Aber insgesamt kann man nicht von problematischen Arbeitsbedingungen sprechen. Ein Pilot bei Lufthansa verdient zwischen 70.000 und 260.000 Euro brutto pro Jahr, ein Flugbegleiter dort knapp 2400 Euro Grundgehalt plus Schichtzulage, beide in Vollzeit. Bei Billigfliegern wie Ryanair sind die Arbeitsbedingungen dann schon schlechter, das Gehalt basiert auch mehr auf Provisionen aus dem Bordverkauf. Das Argument mit den Arbeitsbedingungen steht in merkwürdigem Kontrast zum Verzichtsdenken des Klimadogmas: Wenn man weniger Wohlstand anstrebt – und das ist ja das Ziel –, dann bedeutet das auch geringere Arbeits- und Sozialstandards einschließlich niedrigerer Löhne. Das weiß jeder, der schon einmal in einem viel ärmeren Land war. Zu glauben, bei einem wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands könnten etwa die Sozialleistungen mittel- bis langfristig auf dem heutigen Niveau bleiben, zeugt schon sehr vom fehlenden ökonomischen Denken.
Mein Tipp nach alledem: Lassen Sie sich vom Klimadenken nicht behindern. Fliegen Sie, ruhig weit weg, gerne mehrfach im Jahr. Und denken Sie bei jedem Flug ab einem deutschen Flughafen: Die Bundesregierung, die EU, diverse NGOs, sog. „Experten“ usw. wollten Sie wieder am Fliegen hindern. Und Sie fliegen trotzdem! Gegen alle Widerstände!