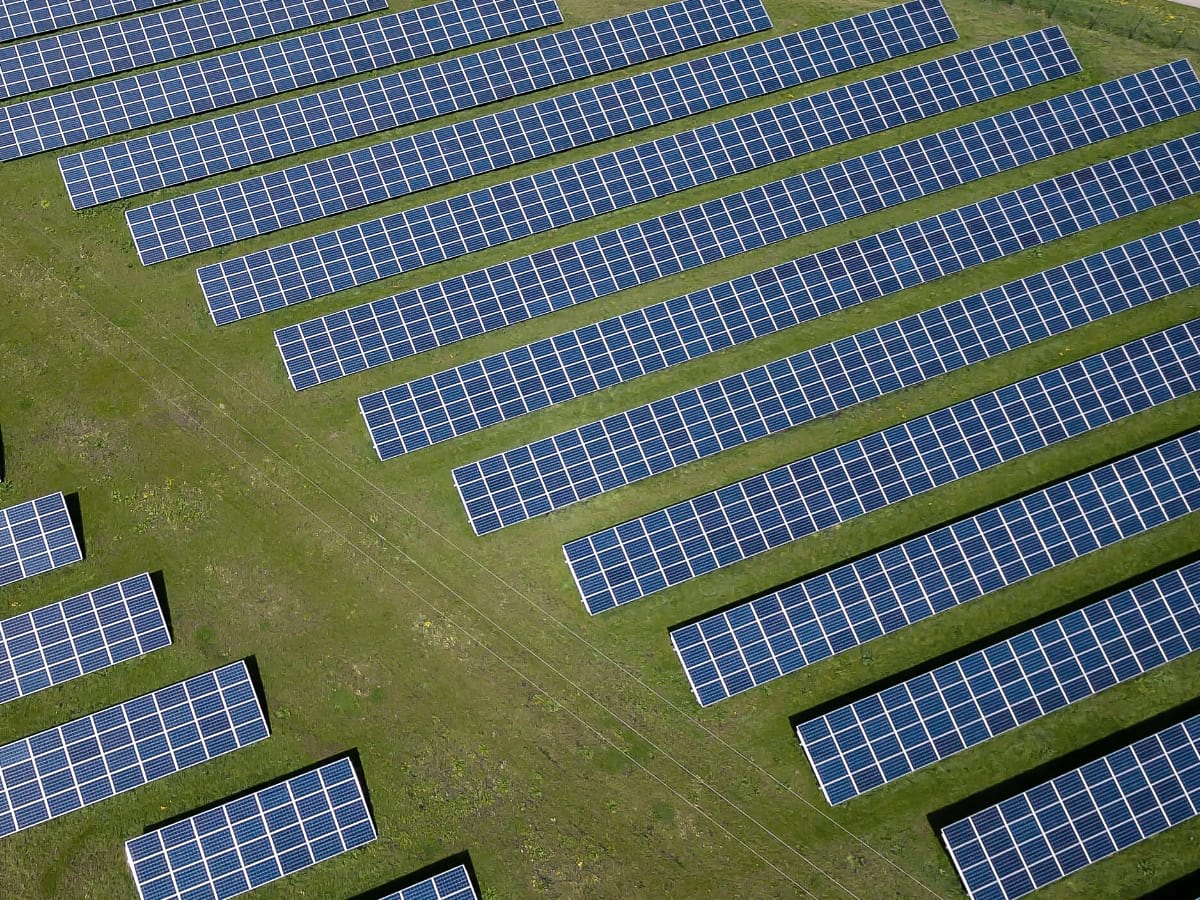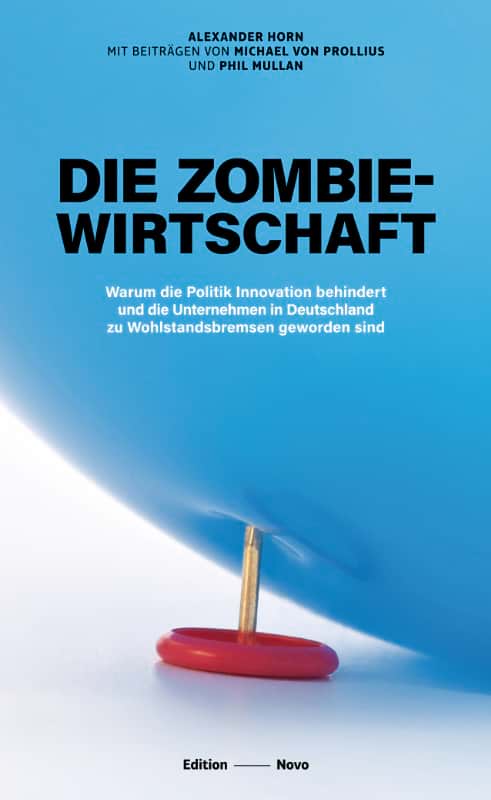22.09.2025
Energiewende am Scheideweg?
Von Alexander Horn
Wegen teurer Wind- und Solarenergie führt die Energiewende in ein immer größeres wirtschaftliches und soziales Fiasko. Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) sieht das, ist aber machtlos.
Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD die Erstellung eines Monitoringberichts zur Energiewende durch externe Forschungsinstitute vereinbart. Dessen Vorlage hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nun genutzt, um eine To-Do-Liste mit zehn „wirtschafts- und wettbewerbsfreundlichen Schlüsselmaßahmen“ vorzuschlagen, mit denen sie die Energiepolitik der vergangenen Jahrzehnte neu justieren und kosteneffizienter managen will. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei „zweifellos ein großer Erfolg“, so Reiche, denn sie erzeugten inzwischen fast 60 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland. Dennoch stehe die Energiewende nun an einem Scheideweg.
Endlich: Energiekosten im Fokus
Anders als bisher müssten „Verlässlichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Kostentragfähigkeit des Energiesystems“ ins Zentrum gerückt werden. Damit schlägt Reiche andere Töne an als ihre vielen Amtsvorgänger, die sich alle überzeugt zeigten, dass die Umstellung auf immer mehr Erneuerbare zu sinkenden Energiepreisen führen werde, keinen Energiemangel herbeiführe und die Systemstabilität nicht gefährde. Die entscheidende Frage sei, so Reiche in den ARD-Tagesthemen, ob der Umbau kosteneffizienter gelinge, denn andernfalls „steigen die Kosten so hoch, dass wir Unternehmen verlieren und der soziale Zusammenhalt gefährdet ist“.
Ohne an der kostentreibenden klima- und energiepolitischen Ausrichtung auf Klimaneutralität und der Umstellung auf ausschließlich erneuerbare Energie zu rütteln, will sie die Energiewende nun auf Kosteneffizienz trimmen. So soll die Förderung erneuerbarer Energien „markt- und systemdienlich“ erfolgen, eine „Synchronisierung“ des Ausbaus von Netzen und Erneuerbaren soll erreicht werden und der Wasserstoff-Hochlauf soll „pragmatisch“ gefördert werden. Kostensenkungen sollen zukünftig auch bei der Subventionierung erneuerbarer Energie erreicht werden, indem die Systemkosten, „also die Summe aus den Kosten für Erzeugung, Netze, Speicher und Versorgungssicherheit“, die diese verursachen als Entscheidungskriterium in der Energiepolitik herangezogen werden.
„In Anbetracht der gigantischen Kosten der Energiewende sind die kostendämpfenden Maßnahmen, die durch die Abarbeitung von Reiches To-Do-Liste erreicht werden können, nicht mehr als Peanuts."
Eine zentrale Rolle ihrer Schlüsselmaßnahmen soll eine „ehrliche Bedarfsermittlung und Planungsrealismus“ spielen, um beim Ausbau der Erneuerbaren nicht wie bisher kostspieligen politischen Wunschszenarien zu folgen. Damit hebt sie auf eine der Kernaussagen des Monitoringberichts ab. Dort wurde festgestellt, dass die bisherigen Prognosen zum zukünftigen Stromverbrauch viel zu hoch lagen. Inzwischen sei davon auszugehen, dass der Bruttostromverbrauch bis 2030 nicht etwa auf 750 Milliarden kWh ansteigen werde, sondern nur auf gut 600 Milliarden kWh, so Reiche. Mit der Anpassung der geplanten Netz- und Energieerzeugungskapazitäten an die Realität und den anderen vorgestellten Schlüsselmaßnahmen glaubt die Ministerin, den Kostenanstieg dämpfen und „Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit“ in Einklang bringen zu können.
Kostendämpfung reicht nicht
Das wird jedoch nicht funktionieren, denn in Anbetracht der gigantischen Kosten der Energiewende, die auf einen mittleren bis hohen einstelligen Billionenbetrag geschätzt werden – was eine gerade vom DIHK vorgestellte Studie erneut zeigt, die die Kosten auf 5,4 Billionen Euro beziffert – sind die kostendämpfenden Maßnahmen, die durch die Abarbeitung von Reiches To-Do-Liste erreicht werden können, nicht mehr als Peanuts. Das liegt vor allem daran, dass die kostentreibenden Prämissen der Klimapolitik, auf die sich CDU/CSU und SPD festgelegt haben, nämlich Klimaneutralität erreichen zu wollen und dies mit ausschließlich erneuerbaren Energien, unangetastet bleiben.
Zudem geht Kostendämpfung am Ziel vorbei, denn aufgrund des seit Anfang der 2000er Jahre gestiegenen und inzwischen hohen Anteils der Erneuerbaren am Stromverbrauch sind die Strompreise in Deutschland längst viel zu hoch. Dies hat die Wettbewerbsfähigkeit vor allem energieintensiverer Unternehmen kontinuierlich unterhöhlt, da es ihnen immer weniger gelungen ist, die in Deutschland steigenden Energie- und Stromkosten durch kostensenkende Produktivitätssteigerungen auszugleichen. Dadurch wurde seit 2018 in Deutschland eine Schrumpfung der Industrie in Gang gesetzt, die bis heute andauert und sich im Lauf der Jahre auf die gesamte Wirtschaft ausgedehnt hat.
Als Folge dieser Schrumpfung entwickelte sich – verdeckt durch Coronakrise und Ukrainekrieg – ein Teufelskreis aus rückläufigem Energie- und Stromverbrauch, einem dadurch stark steigenden Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch und infolgedessen weiter steigenden Strompreisen. Dies hat zu einer beschleunigten Erosion der Wettbewerbsposition sehr vieler Unternehmen geführt, die sie zu Produktionssenkungen bis hin zu Anlagen- und Betriebsstillegungen und Insolvenzen gezwungen hat. Infolgedessen ist die Produktion in den besonders betroffenen energieintensiven Branchen seit 2018 um mehr als 20 Prozent geschrumpft, im verarbeitenden Gewerbe, also einschließlich der energieintensiven Unternehmen, um etwa 15 Prozent.

Abb.1, Quelle: Statistisches Bundesamt, 2025.
Infolge der schrumpfenden Produktion ist der Stromverbrauch in Deutschland in den vergangenen Jahren – im völligen Gegensatz zu den Erwartungen und Prognosen – nicht etwa gestiegen, sondern sogar stark geschrumpft. Im vergangenen Jahr lag der Bruttostromverbrauch in Deutschland bei nur noch 518 TWh im Vergleich zu 593 TWh im Jahr 2018. Der Löwenanteil des Verbrauchsrückgangs geht aufgrund der immer dynamischer verlaufenden Deindustrialisierung auf das verarbeitende Gewerbe zurück. Während dort der Stromverbrauch in diesem Zeitraum um satte 17 Prozent auf nur noch 188 TWh eingebrochen ist, haben die sonstigen Verbraucher, darunter vor allem private Haushalte, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und Verkehr, ihren Verbrauch in Summe nur um etwa 10 Prozent reduziert.
„Eine Abkehr von der Energiewende würde den klima- und energiepolitischen Konsens der etablierten Parteien in Frage stellen, der ihnen als Vorkämpfer gegen die Klimakrise in weiten Teilen der Bevölkerung Glaubwürdigkeit und politische Legitimität verschafft hat."
Wegen der sich immer weiter öffnenden Preisschere zwischen rapide steigenden Strompreisen und vergleichsweise stabilen Preisen für fossile Energie (trotz steigender CO2-Besteuerung) sind offenbar stromintensive Betriebe von der voranschreitenden Deindustrialisierung besonders betroffen. Denn mit 17 Prozent im verarbeitenden Gewerbe der Stromverbrauch weit stärker eingebrochen als der Verbrauch von Kohle, Öl und Erdgas, der seit 2018 ‚nur‘ um 10 Prozent abgesackt ist.
Dass die nun niedrigere Strombedarfsprognose die Anpassung an ein wirtschaftliches Fiasko darstellt, räumt Reiche sogar selbst ein. „Die Wahrheit“ sei, so Reiche in den ARD-Tagesthemen, „dass die deutsche Industrie sehr viel weniger Strom verbraucht, weil sie Produktionsprozesse stillgelegt hat.“ Anstatt jedoch diese Erkenntnis durchzubuchstabieren, verklärt sie den durch Deindustrialisierung sinkenden Stromverbrauch, offenbar aus Angst vor der eigenen Courage und dem wohl folgenschweren Urteil aus den eigenen Reihen, sogar zur Chance, um Wettbewerbsfähigkeit und Klimaneutralität in Einklang zu bringen.
Klimapolitische Umkehr: Horrorszenario
Um die Deindustrialisierung zu beenden, müsste Reiche den weiteren Ausbau der Erneuerbaren stoppen, denn sie sind seit Jahrzehnten der Treiber für die in Deutschland steigenden Strompreise. Dies könnte sie erreichen, indem sie in einem ersten Schritt neue Anlagen und in einem zweiten Schritt die bestehenden Wind- und Solaranlagen dem Wettbewerb unterwirft. Dazu müsste sie, die in ihrem Zehn-Punkte-Plan versteckte Drohung wahrmachen, den Erneuerbaren die vollen Systemkosten, „also die Summe aus den Kosten für Erzeugung, Netze, Speicher und Versorgungssicherheit“ zuzurechnen. Außerdem müssten die EEG-Subventionen gestrichen werden.
„Um die Deindustrialisierung zu beenden, müsste Reiche den weiteren Ausbau der Erneuerbaren stoppen, denn sie sind seit Jahrzehnten der Treiber für die in Deutschland steigenden Strompreise."
Davon sind die etablierten Parteien von CDU/CSU bis zur Linken jedoch Lichtjahre entfernt, denn dies würde den klima- und energiepolitischen Konsens einschließlich Atom- und Kohleausstieg der vergangenen mehr als 25 Jahre in Frage stellen, der ihnen als Vorkämpfer gegen die Klimakrise in weiten Teilen der Bevölkerung Glaubwürdigkeit und politische Legitimität verschafft hat. Eine politische Abkehr würde jede einzelne Partei – zumal in Zeiten rückläufigen Wählerzuspruchs – in eine schwere Glaubwürdigkeitskrise stürzen. Da es soweit nicht kommen darf, stellt Reiche folgerichtig den weiteren Ausbau der Erneuerbaren nicht in Frage, die bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland decken sollen.
Systemkosten und Energiemärchen
Dass der sukzessive Ausbau der Erneuerbaren die Strompreise treibt, lässt sich daran erkennen, dass der Anstieg des Anteils der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch von 6 Prozent Anfang der 2000er Jahre bis 2019 auf 42,2 Prozent mit einem kontinuierlichen Anstieg der Strompreise einhergegangen ist. In diesem Zeitraum haben sich die realen Strompreise für private Haushalte verdoppelt. Seit 2019 ist der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch auf fast 60 Prozent angestiegen und in dessen Folge sind die Strompreise für private Haushalte von damals 30 Cent pro kWh auf inzwischen etwa 40 Cent pro kWh gestiegen. Die Strompreise lägen heute sogar noch etwa 6,5 Cent/kWh höher, wenn die EEG-Umlage im Volumen von knapp 20 Milliarden Euro nicht 2022 abgeschafft worden wäre und seitdem über den Staatshaushalt finanziert würde. Zieht man diese Subventionierung mit ein, sind die inflationsbereinigten Strompreise für private Haushalte innerhalb der vergangen etwa 6 Jahre um weitere knapp 40 Prozent gestiegen. Mit ähnlichen, teilweise sogar stärkeren Preissteigerungen mussten auch die Unternehmen zurechtkommen, wobei die Strompreise vor allem für Industrieunternehmen und Großverbraucher auf einem wesentlich niedrigeren Niveau liegen.

Abb. 2, Quelle: BDEW
Der kausale Zusammenhang zwischen dem steigenden Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch und Strompreisanstieg besteht darin, dass die sogenannten Stromgestehungskosten, also die reinen Produktionskosten der günstigsten Erneuerbaren, zwar an die Produktionskosten fossiler Kraftwerke heranreichen, aber die Systemkosten zur bedarfsgerechten Bereitstellung dieser Energie ein Vielfaches der Produktionskosten betragen. Im Unterschied dazu können fossile Kraftwerke ihre Stromerzeugung dem jeweiligen Bedarf anpassen. Dieses Manko der Erneuerbaren ist in den Anfängen der Energiewende kaum ins Gewicht gefallen, da der damals nur sehr geringe Anteil erneuerbarer Energie bei Dunkelflauten leicht kompensiert werden konnte. Inzwischen muss jedoch de facto ein vollständiges komplementäres Energiesystem aufrechterhalten werden, um die Volatilität der Erneuerbaren bis hin zu Dunkelflauten zu kompensieren.
Während die Erneuerbaren aufgrund politisch durchgesetzter Preisbildungsmechanismen sowie entsprechender Regulierung Vorrang bei der Energieeinspeisung genießen und bei viel Sonnenschein und Wind inzwischen die gesamte Stromversorgung in Deutschland abdecken, sind die fossilen Kraftwerke mit voranschreitendem Ausbau der Erneuerbaren immer mehr zu Reservekraftwerken geworden. Das macht jedoch den von ihnen gelieferten Strom immer teurer, da sie bei Bedarf jederzeit verfügbar sein müssen und die Betreiber gezwungen sind, die kompletten Investitions- und Betriebskosten einschließlich Personalkosten, in immer kürzeren Betriebszeiten zu verdienen. So wird die über das EEG-Gesetz hochsubventionierte erneuerbare Energie bei Hellbrisen an der Strombörse immer günstiger bis hin zu sogar negativen Preisen, während in wind- und sonnschwachen Phasen die fossilen Kraftwerke zum Einsatz kommen, die immer teureren Strom liefern. Darauf beruht das von CDU/CSU bis zur Linken gebetsmühlenartig wiederholte grüne Märchen von billiger erneuerbarer Energie.
Erneuerbare – Nein Danke!
Wie sehr die Strompreise aus dem Lot geraten sind, zeigt sich anhand des Vergleichs mit anderen Energieträgern. So zahlen private Haushalte in Deutschland aktuell etwa 12 Cent pro kWh Erdgas, während die Strompreise mit 40 Cent pro kWh etwa dreieinhalbmal so hoch liegen. Ähnlich ist die Diskrepanz bei den Preisen für Unternehmen, wobei das Preisniveau insbesondere bei Großverbrauchern in der Industrie auf einem deutlich niedrigeren Niveau liegt – nicht zuletzt, weil die Kosten der Energiewende zunehmend auf die privaten Haushalte, Dienstleistungsunternehmen und kleinere Betriebe abgewälzt werden. Obwohl die Bundesregierung mit immer mehr Subventionen versucht, die Folgen ihrer Energiepolitik zu dämpfen, steigen die Strompreise weiter. Das zeigt sich insbesondere an den rasant steigenden Netzentgelten und der Offshore-Netzumlage. Zusammen belasten sie den Strompreis mit inzwischen 12 Cent pro kWh, während diese Kosten für Bau, Betrieb und Instandhaltung der Netze bis Anfang der 2010er Jahre weniger als die Hälfte betrugen.
„Wegen der im Verhältnis zu anderen Energieträgern völlig aus dem Ruder gelaufenen Strompreise erzeugt die Energiewende ein immer größeres wirtschaftliches und soziales Fiasko."
Wegen der im Verhältnis zu anderen Energieträgern völlig aus dem Ruder gelaufenen Strompreise erzeugt die Energiewende ein immer größeres wirtschaftliches und soziales Fiasko, vor dem Ministerin Reiche zurecht warnt. Denn nun ist in Deutschland die Energie- und Klimapolitik auf dem Weg in die Klimaneutralität so weit fortgeschritten, dass alle Energieverbraucher in absehbarer Zeit ihren Verbrauch auf den um ein Vielfaches teureren Strom oder den nicht weniger teuren grünen Wasserstoff umstellen müssen, der mittels Elektrolyse aus Wind- oder Solarstrom gewonnen wird. Wie enorm der Preisschub bei Energie und den damit erzeugten Gütern sein wird, der in den nächsten Jahren auf Unternehmen und Bürger zukommt, lässt sich daran ermessen, dass in Deutschland im vergangenen Jahr nach mehr als 25 Jahren Energiewende erst 22,4 Prozent des Endenergieverbrauchs von Erneuerbaren gedeckt wurden. Im verarbeitenden Gewerbe, wo nur 30 Prozent des Energieverbrauchs durch Strom gedeckt wird, liegt der Anteil der Erneuerbaren bei nur 18 Prozent.
Vor der Umstellung auf Strom und Wasserstoff scheuen die Unternehmen trotz jahrzehntelanger Lobgesänge und Sonntagsreden ihrer Manager, Verbände und Gewerkschaften über diese Klima- und Energiepolitik zurück. Die ihnen bereits zufließenden und in Aussicht gestellten Subventionen und protektionistischen EU-Maßnahmen reichen längst nicht aus, um die wirtschaftlichen Nachteile steigender Energiekosten zu kompensieren. Trotz Milliardensubventionen für den Wasserstoffhochlauf beklagte der Nationale Wasserstoffrat – ein von der Bundesregierung 2020 eingesetztes Expertengremium dem die jetzige Bundeswirtschaftsministerin seitdem vorsitzt – bereits im vergangenen Jahr, dass es zwar „viele Bekenntnisse zu Wasserstoff und seinen Derivaten als wichtiger Säule zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft“ gebe, aber eine „immer größere Lücke zwischen dem politisch definierten Ambitionsniveau auf nationaler und europäischer Ebene und dessen praktischer Umsetzung bzw. Umsetzbarkeit“ bestehe. Die spiegele sich in der Differenz zwischen geplanten Wasserstoffprojekten und finalen Investitionsentscheidungen, denn bisher lägen Investitionsentscheidungen für nur 0,3 GW Kraftwerksleistung bis 2030 vor. Dies entspricht etwa der Leistung von 20 großen Windrädern.
Seitdem wurden viele dieser Investitionsentscheidungen auf Eis oder komplett ad acta gelegt, so etwa für das im sächsischen Boxberg vom Energiekonzern Leag geplante Wasserstoffkraftwerk. Die Absage begründete das Unternehmen mit veränderten politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine Rolle spielte unter anderem das Aus der Ampelregierung, denn dadurch konnte das geplante Kraftwerksicherheitsgesetz – das eine Förderung von Wasserstoffkraftwerken vorsah – nicht mehr verabschiedet werden.
„Die hohen Preise für erneuerbare Energie treiben jedoch nicht nur die Deindustrialisierung voran, der vor allem energieintensivere Betriebe zum Opfer fallen."
Sogar gigantische Subventionen zur Umstellung und zum dauerhaften Betrieb von Produktionsprozessen reichen inzwischen nicht mehr aus, um die Unternehmen zur Umstellung auf erneuerbare Energien zu bewegen, obwohl dies das wirtschaftliche Aus bestehender Anlagen bedeutet. Dies zeigt die Entscheidung des Stahlkonzerns ArcelorMittal, seine deutschen Stahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt nicht auf grünen Wasserstoff umzurüsten, wofür der Bund bereits Fördermittel in Höhe von 1,3 Milliarden Euro bewilligt hatte und der Bremer Senat weitere knapp 0,3 Milliarden zuschießen wollte. Selbst mit finanzieller Unterstützung sei die Wirtschaftlichkeit der Umstellung auf „grüne" Stahlproduktion nicht ausreichend gegeben, erklärte Reiner Blaschek, Chef der europäischen Flachstahlsparte von ArcelorMittal. „Die Rahmenbedingungen ermöglichen aus unserer Sicht kein belastbares und überlebensfähiges Geschäftsmodell." Wasserstoff sei derzeit noch nicht ausreichend vorhanden und viel zu teuer.
Wirtschaftliches und soziales Fiasko
Die hohen Preise für erneuerbare Energie treiben jedoch nicht nur die Deindustrialisierung voran, der vor allem energieintensivere Betriebe zum Opfer fallen. Die in Deutschland und in vielen EU-Ländern ähnlich hohen Strompreise dämpfen zudem den technischen Fortschritt und die Produktivitätsentwicklung in allen Bereichen der Wirtschaft, so dass die Wettbewerbsfähigkeit leidet. Denn arbeitssparende Automatisierung und Digitalisierung, etwa durch die Einführung von Maschinen, Robotern bis hin zu energieintensiveren Verfahren in der Nahrungsmittelerzeugung oder KI erhöhen die Energieintensität von Geschäftsprozessen. Hinzu kommt, dass viele innovative Produkte in der Herstellung und in der Anwendung wahre Energiefresser sind, wie etwa Autos, Flugzeuge, Raketen, Kunstdünger oder etwa Fleisch aus der Retorte. Daher können höhere Energiekosten die Rentabilität derartiger Investitionen in innovative Prozesse und Produkte erheblich mindern, so dass sie unwirtschaftlich werden und unterbleiben oder in Ländern mit niedrigeren Energiekosten erfolgen.
Die deutsche Energiewende führt aufgrund ihrer klimapolitischen Prämissen, erstens Klimaneutralität zu wollen und dies zweitens praktisch ausschließlich mit nur begrenzt verfügbarer und extrem teurer Wind- und Solarenergie erreichen zu wollen, immer tiefer in einer Sackgasse. Das Festhalten an diesen Prämissen hat gravierende Folgen für Wirtschaft und Wohlstand der Bürger, die sich – trotz gigantischer Schuldenaufnahmen – immer weniger bemänteln lassen. Unter diesen Prämissen wird die Deindustrialisierung weiter an Dynamik gewinnen, was umso problematischer ist, weil zudem die Einführung neuer energieintensiver Technik in Deutschland massiv beeinträchtigt oder sogar verhindert wird.
Dass Reiche die aus dem Ruder laufenden Stromkosten anspricht und sogar warnt, dass wir deswegen in Deutschland „Unternehmen verlieren und der soziale Zusammenhalt gefährdet“ wird, ist zwar ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und eröffnet eine neue Perspektive in der Diskussion. Die von ihr vorgeschlagenen „wirtschafts- und wettbewerbsfreundlichen Schlüsselmaßahmen“ für mehr Kosteneffizienz sind jedoch ein stumpfes Schwert, da sie den Ausbau der Erneuerbaren auf einen Anteil von 80 Prozent des Stromverbrauchs nicht problematisiert. Dieser wird jedoch die Strompreise zwangsläufig auf dem inzwischen weltweiten Spitzenniveau zementieren und dürfte sogar für weitere Preissteigerungen sorgen – mit fatalen Folgen für Wirtschaft und Wohlstand.