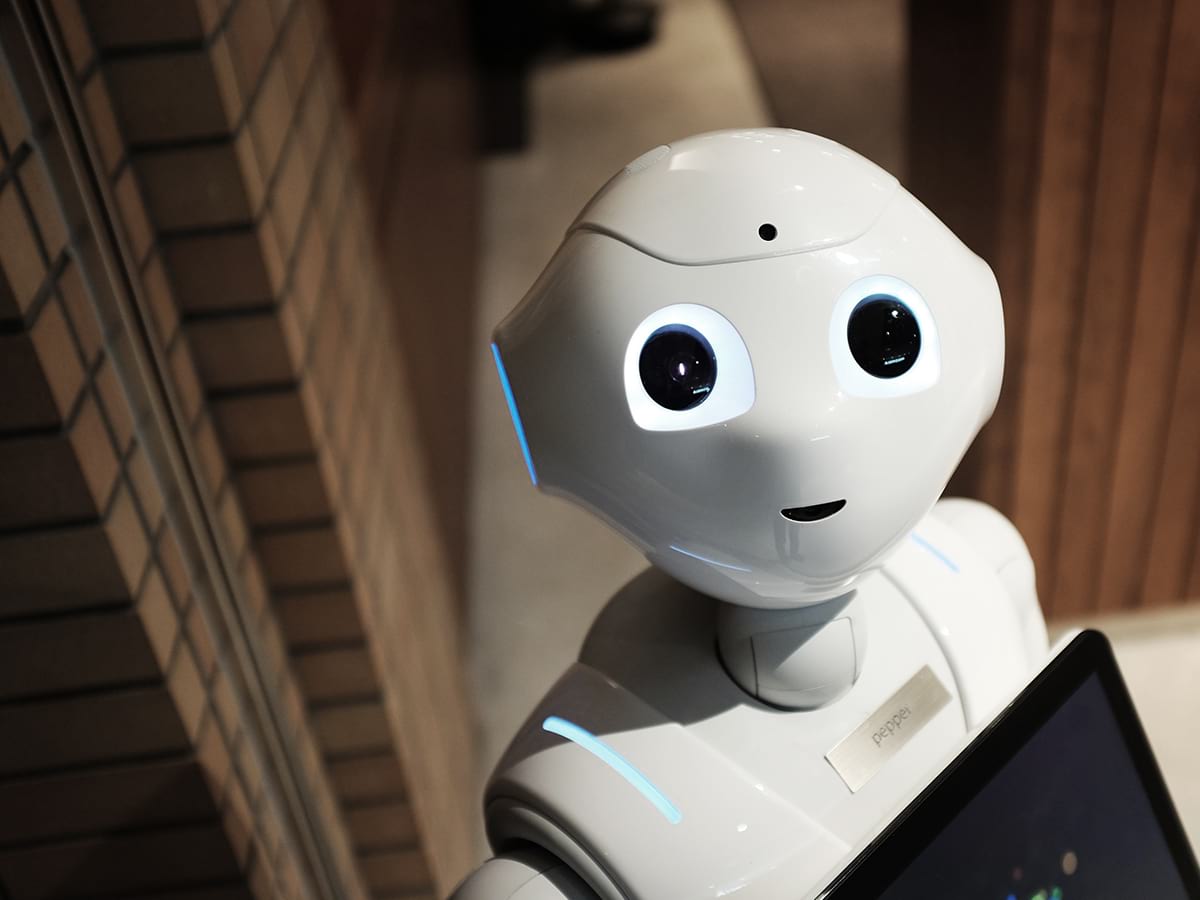11.05.2018
Die Disruptionsphobie der Stabilitätspolitiker
Wenn der Staat den Status quo erhalten will, blockiert er Dynamik und Innovation. Statt auf Abschottung sollte er auf Kreativität setzen.
Zu den faszinierenden Dimensionen der Staatstheorie gehört es, dass wir uns angewöhnt haben, das Wort vom „Staat“ in aller Regel unbedachtsam für so verschiedene Phänomene wie das Machtkonstrukt der (west-)römischen Könige, der (ost-)römischen Kaiser und ebenso für unsere heutigen Staaten in Europa zu verwenden. Man wird bei allem kaum fehlgehen in der Annahme, dass ein römischer Herrscher im Alltagsgeschäft tatsächlich simpel damit befasst war, seine eigenen gesellschaftlichen Privilegien zu erweitern und zu erhalten. Auf die Idee, dass es seine vordringliche Aufgabe sein könnte, in Tat und Wahrheit für Arme und Benachteiligte sozialverträgliche Politik zu betreiben, dürfte jedenfalls der durchschnittliche Patrizier nicht gekommen sein. Die jüngere Staatstheorie verortet den ernsthaft vorgetragenen Gedanken von einem „Staat für das Volk“ auch historisch erstmals bei dem deutschen Kanzler Otto von Bismarck.
In diesem Kontext war es also nur konsequent, dass die Staatstheoretiker des 19. Jahrhunderts in Deutschland auch intensiv über den legitimen Umfang staatlicher Machtbefugnisse stritten. Anders als die Sozialisten gingen die Liberalen davon aus, dass es primäre Aufgabe eines Staates sein solle, bestehende Rechte zu verteidigen, nicht aber neue Rechte erst entstehen zu lassen und dann machtvoll durchzusetzen. Die Polemik der Sozialisten gegen einen derart „schlanken“ Staat kulminierte in dem bis heute bekannten Schmähbegriff vom „Nachtwächterstaat“. In sozialistischen Augen war es völlig unzureichend, die Aufgabe eines Staates nur darin zu sehen, simpel bei Tag und Nacht für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Sozialisten betrachteten die Nivellierung der massiven Unterschiede der seinerzeitigen Vermögensverteilung vielmehr als die zentrale moralische Herausforderung für eine Politik durch das Volk und seine Repräsentanten – ein Umstand, der durch die industrielle Revolution, die mit dem 19. Jahrhundert in Europa machtvoll Einzug hielt, noch an Dynamik gewann.
Wirtschaftssteuerung in Deutschland
Aus den demokratischen Vorkämpfern, den sozialistischen Klassenkämpfern, den öffentlichen Demonstranten für neue Politik, wurden im Laufe der Zeit mehr und mehr staatlich alimentierte Wirtschaftsexperten innerhalb entstehender staatlicher und halbstaatlicher Institutionen, die – mit mehr oder minder glücklicher Hand im Einzelfalle – Umverteilung aus ihren Amtsstuben betrieben. Zudem trugen sie – was hier wesentlich ist – mit ihrer Politik dazu bei, die Innovationspotentiale einer freien Marktwirtschaft durch ein Übermaß an Regulierung einzudämmen. So wurde etwa im Jahr 1967 von der damaligen Großen Koalition das „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“ erlassen. Mit einem modellhaften, nationalökonomischen Quadrat aus politisch organisierter Preisstabilität, einem gleichzeitig hohen Beschäftigungsstand, einem Gleichgewicht des Außenhandels und einem dennoch stetigen Wachstum der Wirtschaft sollte das eigenwillige Paradox aus gleichzeitiger wirtschaftlicher Stabilität und ökonomischer Elastizität herbeiorganisiert werden.
„Die Abgrenzung an den gegenseitigen Interessensphären ist seither in die Amtsstuben und Gerichtssäle verlagert.“
Das liberale Credo, demzufolge niemand sonst als die je konkreten Vertragspartner selbst besser wissen kann, wie die wechselseitigen Interessenssphären zutreffend voneinander abwägend abgegrenzt werden können, wurde durch die staatsrechtliche Lehre der wirtschaftsintervenierenden Bundesrepublik in seinen Grundfesten ausgehebelt. Mit der Lehre von der „praktischen Konkordanz der Grundrechte“, die im Konfliktfalle alle beteiligten Menschen- und Bürgerrechte zu möglichst optimaler Entfaltung kommen lassen soll, wurde den beteiligten Privatrechtssubjekten die Verfügungshoheit über ihre eigenen Rechts- und Wirtschaftsangelegenheiten weitgehend entzogen. Die Abgrenzungsarbeit an den gegenseitigen Interessensphären ist seither in die Amtsstuben und – notfalls – in die Gerichtssäle verlagert. Unter solchen Umständen kann sich schwerlich eine Kultur herausbilden, in der ein risikofreudiges Unternehmertum gedeiht, das echte Innovationen vorantreibt, die unseren Wohlstand dauerhaft sichern können.
In den frühen 1990er-Jahren begannen in Deutschland weitere Bemühungen, das nationalökonomische Viereck des Stabilitätsgesetzes aus dem ersten Rezessionsjahr der Bundesrepublik Deutschland zu einem noch kleinteiligeren wirtschaftssteuernden Neuneck auszubauen. Oder anderes ausgedrückt: die Freiheit der Marktsubjekte noch weiter einzudämmen. Der steuernde Staat sollte jetzt zusätzlich auch noch die nationalen Lebensgrundlagen erhalten und verbessern, den wirtschaftlichen Strukturwandel erleichtern, regionale Wirtschaftsgefälle abbauen, Einkommen und Vermögen gleichmäßig verteilen und die Verbraucher schon vorsorgend vor Misshelligkeiten schützen. Jedes neue dieser fünf weiteren Ziele zeigt, wie sehr das Ursprungsparadox von gleichzeitiger Stabilität und Wachstum, von Sein und Werden, von Statik und Dynamik, von Festhalten und Loslassen wieder in den Mittelpunkt politischer Aktivität rückt.
Sterile OP-Säle
Die zentrale Schwierigkeit für ein derart ambitioniertes politisches Treiben ist bei zunehmend international komplexer werdenden wirtschaftlichen Zusammenhängen die Kunst der Beherrschung vernetzter ökonomischer Kausalitäten. Je gezielter ein bestimmter Lebenssachverhalt gesteuert werden soll, desto wichtiger ist es, ihn in seinen Voraussetzungen, seiner Durchführung und seinen Ergebnissen erfassen und steuern zu können. Jedes Kind kennt den nötigen Dreiklang derartiger Experimente aus dem naturwissenschaftlichen Schulunterricht: Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung und Versuchsergebnis müssen allesamt erkannt und akribisch beschrieben werden, um im Falle einer gezielten Wiederholung des Vorganges zu den gewollt exakt gleichen Zielen kommen zu können.
„Eine überbehütete Volkswirtschaft vergeht, statt zu bestehen oder gar zu wachsen.“
Jenes wirtschaftsbeherrschende und ökonomielenkende Denken hatte in den Staaten des untergegangenen Ostblocks, namentlich der Deutschen Demokratischen Republik, zu einer Praxis geführt, die am ehesten mit einer chirurgischen Operation in einem Krankenhaus vergleichbar ist. Während man dort den Operationssaal so weit wie irgend beherrschbar steril hält, um den geplanten Eingriff von unkontrollierbaren Außeneinflüssen frei zu halten, schotteten die Wirtschaftslenker der DDR ihre ökonomischen Verhältnisse gegen alle Einflüsse von außerhalb ab und hofften auf diese Weise, das Paradox aus gleichzeitigem Sein und Werden interventionspolitisch beherrschbar zu halten. Dass sie in diesem ökonomischen Sonderbiotop hinter ihrer Mauer indes tatsächlich weder substantiell Neues entstehen lassen konnten noch überhaupt das Bestehende zu erhalten vermochten, hat die Geschichte gezeigt. Eine überbehütete Volkswirtschaft vergeht, statt zu bestehen oder gar zu wachsen.
Um Bestehendes erhalten zu können oder es nach allen Möglichkeiten der ökonomischen Kreativität wachsen und fortschreiten zu lassen, bedarf es des Zulassens von Neuerungen. Dies aber bedeutet, auch Entwicklungen zuzulassen, die sich zum Zeitpunkt ihrer Zulassung als faktisch unbeherrschbar, weil unbekannt, darstellen. Jede Neuerung bietet nicht nur die Chance, erweiterte Horizonte zu erobern, sondern sie gefährdet auch den stabilitätspolitischen Konservierungswunsch. Ein Politiker und Staatenlenker, der die von ihm beherrschte Volkswirtschaft zu neuen Ufern führen möchte oder es wenigstens gestatten will, dass sie sich diese neuen Horizonte selbst erobert, ermöglicht notwendigerweise den ergebnisoffenen Prinzipienwiderstreit zwischen Progressivität und Konservierung.
Die europäische Wissenschaftsgeschichte hält drei anschauliche Beispiele dafür bereit, wie wissenschaftlicher Fortschritt zugleich auch immer mit erheblichen Destruktionspotentialen gegenüber dem Bestehenden und der bis dahin geschaffenen Ordnung verbunden ist. Die astronomische Entdeckung des heliozentrischen Weltbildes und die Überwindung des Geozentrismus ermöglichte gleichermaßen technische Fortschritte wie die Vernichtung der bis dahin als unverrückbar geglaubten politischen Ordnung. Desgleichen erschütterte die Erkenntnis der Evolutionstheorie das Selbstverständnis des Menschen als dem zentralen, göttlich beauftragten Wesen inmitten der Welt. Der durch die Evolutionstheorie verirrte Homo sapiens sah sich genötigt, seinem Selbstbewusstsein neue Sicherheiten zu schaffen.
„Wer die Vergangenheit verteidigt, verliert den Anschluss an den Fortschritt.“
Mit der dann gleich dritten Kränkung, nicht nur von dem eigenen Verstand gesteuert zu sein, sondern unentrinnbar auch mit der eigenen Triebhaftigkeit leben zu müssen, erweiterten sich die Destruktionspotentiale des wissenschaftlichen Fortschritts. Je mehr man lernte, desto weniger wusste man. Das war anstrengend und verwirrend. Kurz: Jedes Vorwärts konnte Verheißung eines Aufwärts sein, bot aber unausweichlich immer auch das Risiko, zu einem Abwärts zu werden. Wie sollten in solchen Kontexten auf Dauer Stabilität und Wachstum garantiert bleiben? Waren das nicht gleich zwei Wünsche auf einmal? Und schlossen die sich nicht in Wahrheit auch noch gegenseitig aus? Jene wissenschaftshistorischen und -theoretischen Verirrungen erwiesen sich – bis heute unverändert – als unlösbares Paradox: Wer Fortschritt zulässt, begründet das Risiko der Zerstörung von zuvor Erreichtem, wer Fortschritt verunmöglicht, dem droht, dass er Bestehendes verliert.
Träger Staat vs. Fortschritt
Unter den Bedingungen eines zunehmend internationalen Technik- und Wirtschaftswettbewerbes ergeben sich bei allem auch noch besondere Gefahrenlagen für jeden, der nicht über die nötigen Innovationen verfügt. Nur der, der Innovationen zuerst entdeckt, ist in der Position, sich potentiell schneller und also besser auf die Änderungen einzustellen, die sie für ihn mit sich bringen. Aus diesem Grund sind auch just Stabilitätspolitiker gegenüber solchen Politikern, die dezentrales Wachstum gestatten und fördern, in einem strukturellen Nachteil. Denn wer die Vergangenheit verteidigt, verliert den Anschluss an den Fortschritt. Rückwärts gewandte Politiker träumen zum Beispiel von rundfunkrechtlichen Lizenzen für Youtube-Kanäle, hoffen Drohnenkameras durch Führerscheinpflichten beherrschbar zu halten oder sinnieren über die Regulierung von Kryptowährungen. Während sie also noch versuchen, die Disruption ihrer alten, vertrauten Welten zu vermeiden oder wenigstens zu verzögern, schreiten die Entwicklungen andernorts bereit kreativ und destruktiv zugleich voran.
Die technischen Möglichkeiten der Überwachung und der Beherrschung von erkannten Kausalabläufen werden bei alledem zwar auch für Machthaber immer raffinierter und weiten sich aus. Machtausübung scheint bei Nutzung dieser Möglichkeiten also immer einfacher zu werden. Zugleich aber wird die Machterhaltung selbst durch permanenten und beschleunigten Fortschritt mit kontinuierlichen Disruptionen allüberall immer schwieriger. Insbesondere die Sehnsucht nach Stabilität, nach Bestand, nach Ruhe und nach dem Erhalt von Erreichtem kann von einem zentral steuernden und also notwendigerweise trägen staatlichen Ersatzgott immer schlechter erfüllt werden. Je quirliger und umtriebiger das ökonomische Gemeinwesen an seinen vielen dezentralen Hotspots wird, desto unmöglicher wird es für den Herrscher im Zentrum, selbst noch den verstehenden Überblick und mit ihm die Bedingung der Möglichkeit von Steuerung zu wahren.
Die Allokation von materiellen und immateriellen Ressourcen im ökonomisch und kommunikativ offenen globalen System vollzieht sich eigendynamisch, unvorhersehbar und ohne die Chance einer nachhaltigen Steuerbarkeit. Die technischen Potentiale des weltweiten Austauschs unter kreativen Individuen haben die Möglichkeiten hoheitlicher Steuerung und stabilitätswahrender Politik ausgehebelt. Dem Staatenlenker bleibt nur die Wahl, entweder offene Kreativität zu gestatten oder mit der ihm noch verbliebenen Machtfülle ein operationssaalartiges Sonderbiotop aus Abschottung und Gewaltherrschaft zu etablieren.
An dieser Stelle zentriert sich nun weltweit der relevante Staatsbegriff. Die Ausübung von akzeptierter organisatorischer Gewalt innerhalb eines bestimmten Gebietes steht vor zwei Möglichkeiten. Entweder sie öffnet sich der Welt und lässt den chancenlosen Wunsch nach völliger Beherrschbarkeit fahren. Oder sie schottet sich ab. Im zweiten Falle geht sie unter.