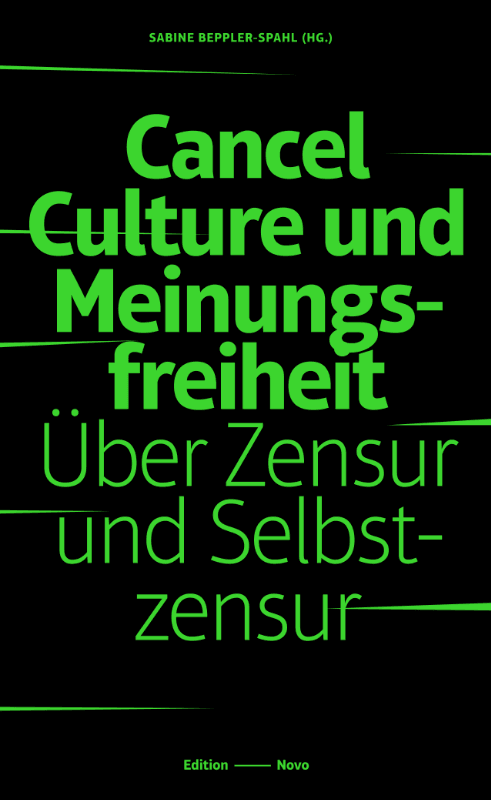17.02.2023
In der prüden Republik
Breit aufgestellte Volksparteien müssten Querköpfe wie Maaßen oder Sarrazin in ihren Reihen dulden können. Doch sie befinden sich im Schraubstock eines identitätspolitisch motivierten Konformismus.
Nach der Bundestagswahl hieß es angesichts des Debakels der CDU/CSU wie schon nach vielen anderen Wahlen, die Ära der Volksparteien sei vorbei. Neu war nach dieser Wahl, dass nun auch die „letzte“ Volkspartei davon betroffen schien, nachdem schon die SPD Jahre des Niedergangs hinter sich hatte. Die Gründe für den Abgesang auf die Volksparteien sind klar: Keine der „großen“ Parteien erreicht auch nur ansatzweise noch eine absolute Mehrheit, selbst mehr als 30 Prozent gelten schon als außergewöhnlich. Das war in der alten Bundesrepublik noch anders: CDU/CSU und SPD teilten sich weitgehend die Wählerschaft, auch wenn es für die absolute Mehrheit damals meist ebenso wenig reichte wie heute. Nur die CSU entsprach dem Ideal der Volkspartei. Die FDP verharrte als Klientelpartei gewissermaßen in der parteihistorischen Vergangenheit; die Grünen, die in den achtziger Jahren hinzukamen, waren eine Mischung aus Bewegung und Programmpartei, darin der SPD nicht ganz unähnlich und ebenfalls ein „Rückschritt“ aus der Perspektive der Volksparteien.
Ist aber wirklich die Stärke der Parteien das Maß dafür, ob sie intakte Volksparteien sind oder nicht? Dem Irrtum, die Masse mache eine Volkspartei aus, erlag die FDP, als sie sich unter dem Vorsitzenden Guido Westerwelle in einer Phase zweistelliger Wahlergebnisse auf Bundesebene ausmalte, in die Liga von CDU und SPD vorrücken zu können. Sie scheiterte daran, dass ihr ein Element fehlte: Sie zog zwar mehr Wähler an als früher, war dadurch aber nicht „Catch-all-party“, war nicht zum Spiegel der Gesellschaft, des ganzen Volkes geworden. Sie war immer noch Klientel- und Programmpartei mit begrenzter Mitgliederzahl geblieben. Die Grünen drohen diesen Irrtum zu wiederholen: Die Masse allein entscheidet nicht über den Status als Volkspartei. Was ist es dann? Und was bedroht den Status viel mehr als nur geschrumpfte Wahlergebnisse?
Der auf die Parteien gemünzte Satz im Grundgesetz („Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“) lässt zwar offen, welche Parteiform die Verfassung bevorzugt – das regelte später im Detail das Parteiengesetz, das nur Vorgaben über die demokratische Verfassung der Parteien macht. Aber schon im Grundgesetz steckt der Hinweis darauf, dass die Mitwirkung an politischer Willensbildung umso wirkungsvoller ist, wenn es dafür nur weniger Parteien bedarf, die in sich austragen und vorwegnehmen, was dann im Parlament verhandelt und beschlossen wird. Das sichert Stabilität, Akzeptanz und Kompromissfähigkeit, drei Kernbedürfnisse in der Nachkriegszeit. Vorbild vieler Verfassungspolitiker waren damals die USA und Großbritannien mit ihren zwei stabilen Parteiblöcken. Heute sieht man allerdings in Amerika, dass auch zwei Blöcke nicht den Sturm aufs Parlament verhindern.
„Pluralismus und die Toleranz gegenüber Unterschieden, Abweichungen und Gegensätzen machen den Kern einer Volkspartei aus.“
Parteien, die ihr Programm höher stellen als die Breitenwirkung, wollten die meisten Politiker des Parlamentarischen Rats nicht mehr haben. Ihnen schwebte, gezeichnet vom Dauerzank und vom Untergang der Weimarer Republik, eine Partei neuen Typs vor, den CDU und CSU, später auch die SPD im „Godesberger Programm“, am besten verwirklichten. Sie sollten nicht mehr in einer Ideologie, einem Milieu, einer Konfession gefangen sein, sondern sich öffnen und im Kleinen abbilden, was die Gesellschaft im Großen war.
Über die Gemeinschaft von Interessen hinaus Bindungen herzustellen, die aus einer Partei eine Gesellschaft im Kleinen machen, wird aber umso schwieriger, je mehr Milieus, je mehr Lebensstile, je mehr Interessengegensätze und je mehr unerbittlich gepflegte Identitäten diese Gesellschaft beherrschen. Gemeinhin wird die Auflösung traditioneller Milieus als Grund für schwächere Bindungen angeführt. Volksparteien müsste es die Arbeit aber eigentlich erleichtern, solange sich die vielen neuen Milieus nicht mehr durch die tiefen Gräben der alten abgrenzen oder gar bekämpfen. Das führt zu mehr Gleichheit und mehr Bewegung, muss aber nicht unbedingt zur Schwächung von Volksparteien führen. Sie sind nur dann bedroht, wenn neue Milieus identitätspolitisch ideologisiert werden.
Weit gefährlicher als die Ablösung alter Milieus ist deshalb für die Volksparteien deren Mitgliederschwund, weil er das Produkt einer auf Individualismus, Entpolitisierung und gleichzeitiger Milieu-Ideologie ausgelegten Lebensführung ist, die sich mit einer zur Schau getragenen Konfessionslosigkeit durchaus vertragen kann. Weniger Mitglieder heißt weniger Repräsentation, weniger Engagement, weniger Präsenz. Das wiederum bedeutet weniger organisatorisches Wurzelwerk in einer Gesellschaft, die gleichzeitig aber auf mehr Partizipation und „Basisbeteiligung“ Wert legt.
In einem wichtigen Punkt ähnelt diese Situation dem Aufbruch in der Nachkriegszeit. Die Volksparteien sollten damals auch eine Antwort auf die Parteien- und Politikverdrossenheit sein, auf das Misstrauen gegenüber dem Parlamentarismus und auf den Ansehensverlust des Staates nach Jahren der Diktatur. Sie sollten Aversionen gegen das „Parteiengezänk“ dämpfen, dem die Schuld an der Nazi-Diktatur gegeben wurde, dem aber gleichzeitig, wie schon zu Weimarer Tagen, die Sehnsucht nach einer geräuschlosen, harmonischen, „echten“ Demokratie entgegengesetzt wurde. Diese Sehnsucht begleitet auch die Parteienlandschaft der Gegenwart, dessen traditionellem Teil Konformität, Bürgerferne, „ewiger Streit“ und Inkompetenz vorgeworfen wird. Den Anspruch, Volkspartei neuen Stils zu sein, das zeigt der Aufstieg der AfD, können auch Parteien pflegen, die unter „Volk“ nicht ein Chaos der Interessen, sondern ein monolithisches und identitäres Wesen verstehen, dessen „Wille“ nur diese eine Volkspartei wahrhaft kenne.
„Symptomatisch für diese Sinnkrise, die Rückwirkungen auf die Stärke der Volksparteien hat, sind wiederkehrende Debatten in allen Parteien über Parteiausschlüsse.“
Diese alte Sehnsucht nach Konformität und Identität ist die eigentliche Bedrohung für die Volksparteien. Umgekehrt: Pluralismus und die Toleranz gegenüber Unterschieden, Abweichungen und Gegensätzen machen den Kern einer Volkspartei aus. Nicht die Masse und die Dichte sind entscheidend, sondern die Dehnung, das Spektrum und die Persönlichkeiten, die dafür stehen. Dieser Kern ist seit Jahren bedroht. Paradox daran ist, dass die schleichende Abnutzung der Volksparteien parallel zu einer Entideologisierung von Politik und Gesellschaft verläuft. Eigentlich sollte auch das ein Vorteil für sie sein. Je weniger Ideologie, desto einfacher müssten sich Bindungskräfte pflegen lassen. Das Gegenteil scheint aber der Fall zu sein. Dem Ende des Zeitalters der Ideologien folgt offenbar die Sehnsucht nach Ideologien in Bezirken, die früher davon verschont geblieben waren. Symptomatisch für diese Sinnkrise, die Rückwirkungen auf die Stärke der Volksparteien hat, sind wiederkehrende Debatten in allen Parteien über Parteiausschlüsse.
Schließt die CDU demnächst postum sogar Konrad Adenauer aus? Die Frage ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, nimmt man die regelmäßige Verunsicherung der CDU-Funktionäre durch Äußerungen aus dem Thüringer Wald zum Maßstab. Der erste CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler hatte einen ähnlichen Kampf gegen den „klaren Linksdrall“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geführt, den der frühere Präsident des Verfassungsschutzes und gescheiterte CDU-Direktkandidat Hans-Georg Maaßen zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Adenauer ging bis nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht, wo sein Versuch, einen „Staatssender“ zu gründen, kläglich scheiterte. Ergebnis war – als Konkurrenz zur ARD – das ZDF, das sich aber im Laufe der Jahre nicht unbedingt „rechter“ oder regierungsfreundlicher verhielt als die ARD. In Rückblicken auf diese Zeit wird Adenauer deshalb von Leuten mit Linksdrall gelegentlich als „autokratischer Herrscher“ bezeichnet, als gehe es um Viktor Orbán oder Wladimir Putin.
Andere Zeiten, andere Sitten, mag man sagen. Die Frage ist allerdings, ob die politischen Sitten damals nicht wesentlich offener, toleranter, interessierter, streitbarer waren als heute. Debatten über Thilo Sarrazin, Boris Palmer, Sahra Wagenknecht und Hans-Georg Maaßen zeigen in den jeweiligen Parteien und darüber hinaus ein Maß an politischer Prüderie, dass selbst die Adenauer-Zeit, die in anderer Beziehung wahrlich verklemmt und Tabu-beladen war, wie ein Hort der Freiheit wirkt. Vielleicht liegt es an der Naivität der jungen Bundesrepublik. Vielleicht liegt es an der Altklugheit der erwachsenen Bundesrepublik. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Tabubrecher von damals die Spießer von heute sind.
Auf jeden Fall liegt es immer wieder an den „Grenzen des Sagbaren“. Schon der Ausdruck ist verräterisch. Denn in der politischen Debatte sollte es nicht darum, sondern um die Grenzen des Gesagten gehen. So reicht aber ein dummer Gedanke, eine spitze Entgleisung, ein „Code-Wort“, eine winzige Provokation, eine Jugendsünde, und schon ist die Hölle los. Da die Grenzen so eng gezogen sind, haben Provokateure leichtes Spiel und springen die Provozierten wie auf Befehl über das Stöckchen, das ihnen hingehalten wird. Das Ritual des Provokateurs beginnt mit: Man wird ja noch mal sagen dürfen. Und endet mit: Ich habe gar nicht gesagt, was man doch wohl mal sagen darf. Auf der Gegenseite besteht das Ritual darin, nach Spurenelementen von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Totalitarismus zu forschen, um sich Argumente zu ersparen. Viele Leute schauen sich das an und kommen zu dem Schluss: Ich bin lieber vorsichtig und sage gar nichts mehr.
„Melden sich erst einmal die Maaßens dieser Welt zu Wort, ist es schon zu spät.“
Diese neue Form der Schweigespirale kann den Volksparteien nicht egal sein. Sie wirkt zwar disziplinierend. Die eng gezogenen Grenzen haben aber einen unsichtbaren Nachteil: Die Spirale wirkt auch nach innen. Fragen werden ausgeblendet, die vielen Leuten auf den Nägeln brennen (zum Beispiel der Linksdrall im öffentlich-rechtlichen Rundfunk). Melden sich erst einmal die Maaßens dieser Welt zu Wort, ist es schon zu spät. Mit ihrem eitlen Auftrumpfen wollen sie besonders mutig erscheinen, zerstören aber den Weg in eine sachliche Debatte durch hohle Phrasen. Die radikale Antwort, der Parteiausschluss, wird zum pawlowschen Reflex, hat aber nicht die befreiende Wirkung, die sich dessen Befürworter versprechen. Im Gegenteil. Das Abbild der Gesellschaft, für das die Volksparteien stehen sollten, droht selbst in der CDU, dem Prototyp der Volkspartei, zu dem schönen Bild zu werden, das man sich von dieser Gesellschaft wünscht. SPD, Grüne und Linkspartei waren dafür schon immer anfällig. Nun also auch die CDU. Ergebnis ist die AfD.
Volksparteien driften dadurch in die Intoleranz von Weltanschauungsparteien ab. Abweichler, Originale, Querköpfe, Spinner und Scharfmacher tun sich schon schwer genug in einer Volkspartei. Sie stehen am Rand, wo sie vielleicht auch hingehören. Aber sie gehören dazu, denn sie gehören zum Querschnitt der Gesellschaft, den sich jede Volkspartei auf die Fahne schreiben muss. In Weltanschauungsparteien dagegen sind entweder alle Spinner oder keiner. Da gilt die Stromlinie, nicht das offene Spektrum. Was sind die Grünen ohne Palmer? Die Linkspartei ohne Wagenknecht? Die SPD ohne Sarrazin? Die CDU ohne Maaßen? Auf der Suche nach Antworten fällt einem das Wort „sauber“ ein. Kein gutes Zeichen.
Es ist eine bittere Ironie, dass alle Parteien der Mitte in Deutschland seit Jahren „Zusammenhalt“ preisen, aber ständig damit beschäftigt sind, Verfahren zu finden, um einen „Ruck“ nach links oder rechts zu verhindern, oder, umgekehrt, um Ausgrenzungen zu rechtfertigen. Ist das Ursache oder Folge der Verschiebungen in der deutschen Parteienlandschaft? Nicht zu bestreiten ist jedenfalls, dass die Bedrohung der Volksparteien nicht nur Gründe hat, die von außen kommen. Die Auflösungserscheinungen haben auch damit zu tun, dass vor lauter Schweigespirale, Linientreue und Ausgrenzung aus dem Blick geraten ist, was die großen Parteien zu Adenauers Zeiten zu dem gemacht hat, was sie bis in die jüngste Zeit noch waren.
Für die Idee der Volkspartei spricht nach wie vor, dass selbstgewählte programmatische Engstirnigkeit, die Konzentration auf Interessengruppen und die Überhöhung von Interessen zu Identitäten die Willensbildung im Parlament erschweren und dessen Ansehen unterminieren. Vielfarbige Koalitionen, die angesichts der Schwäche der „großen“ Parteien geschlossen werden müssen, belasten wiederum jeweils die Glaubwürdigkeit der beteiligten Parteien. Ein wichtiger Nebeneffekt dieses Teufelskreises ist ein neuer Typ von Politiker, der sich als Doppelkopf von Partei und Bewegung versteht, die er wieder zur Mehrheitsfähigkeit führt. Diesen Typus zu verhindern, war in Deutschland aber ein wesentlicher Antrieb zur „Erfindung“ der Volkspartei.