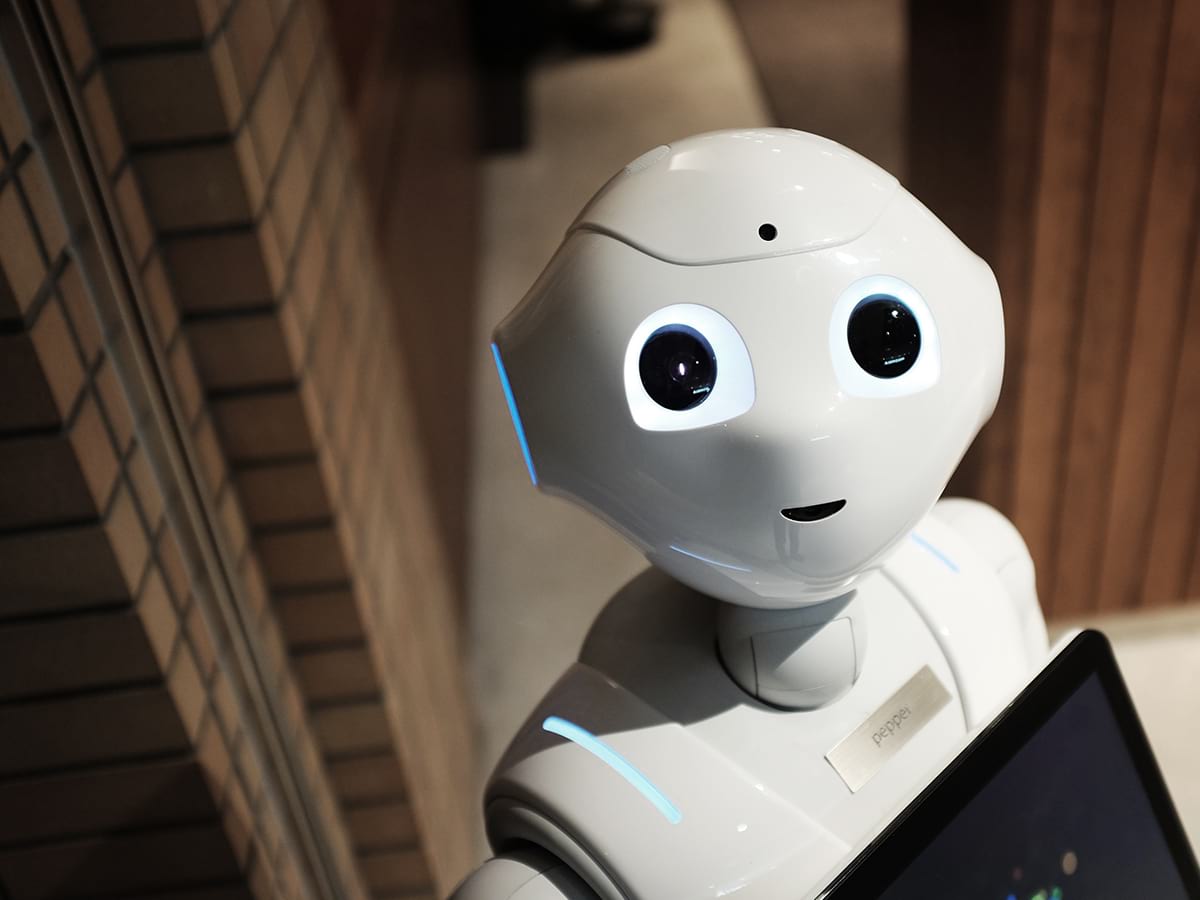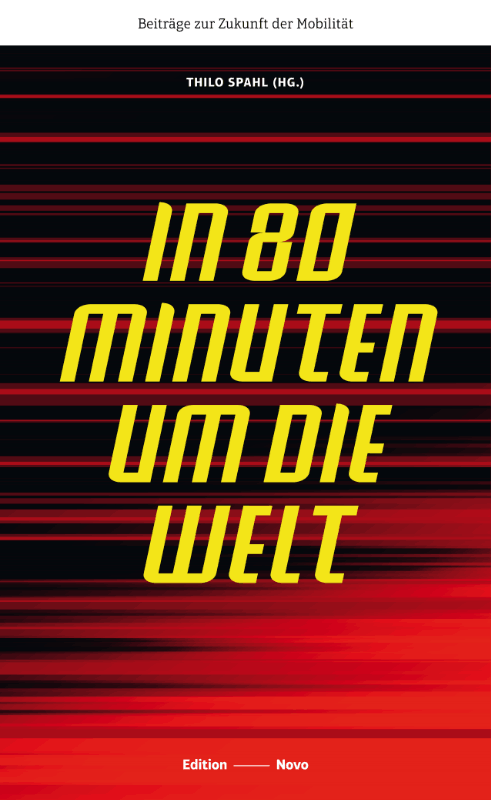12.11.2025
Führungsversagen im KI-Zeitalter
Von Norman Lewis
Um das technologische Veränderungspotential durch Künstliche Intelligenz auszuschöpfen und möglichst positiv zu gestalten, bedarf es einer anderen, einer mutigen Führungskultur.
Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht; sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig. (Seneca)
Das Paradox unserer Zeit besteht darin, dass die revolutionärste Technologie seit Generationen bislang bemerkenswert wenig Revolution hervorgebracht hat. Künstliche Intelligenz verspricht, Arbeit, Kreativität und sogar das Denken selbst neu zu definieren. Bislang sind die Auswirkungen jedoch seltsamerweise eher bescheiden. Die Produktivität ist nicht gestiegen. Unternehmen sind vorsichtig, ja sogar verwirrt. Trotz aller Diskussionen über Transformation experimentieren die meisten Unternehmen noch immer nur im Kleinen – sie setzen KI ein, um alltägliche Aufgaben zu automatisieren, Marketingtexte zu erstellen oder Arbeitsabläufe zu optimieren.
Der Grund hierfür liegt nicht in einer unzureichenden Technologie. Er liegt in einer mangelhaften Führung. Die Financial Times zitierte kürzlich Marcus Collins, Professor an der University of Michigan, der davon ausgeht, dass wir „die Bedeutung der Technologie für die Zukunft der Arbeit überbewertet haben”. Technologie sei lediglich „eine Erweiterung des menschlichen Verhaltens”. Mit anderen Worten: Die Zukunft der Arbeit ist nicht technologisch, sondern kulturell geprägt – es geht nicht um Maschinen, sondern um die Bedeutungen und Werte, die wir ihnen zuschreiben. KI hat keinen Willen, keine Meinung, keinen Zweck. Sie ist wertneutral. Es gibt kein KI-System auf der Welt, das nach dem Aufwachen beschließt, Menschen überflüssig zu machen. KI spiegelt das Beste oder Schlechteste unserer Menschlichkeit wider und erweitert es, je nachdem, wer führt und wie geführt wird.
Diese Beobachtung offenbart die zentrale Illusion unserer Zeit: den Glauben, dass die Zukunft etwas ist, das uns die Technologie bescheren wird, und nicht etwas, das Menschen durch Führungsstärke schaffen müssen. Die „KI-Revolution” ist in Wahrheit ein bemerkenswerter Spiegel – sie zeigt uns, wer wir sind, und nicht, was Maschinen leisten können.
Die Krise der Vorstellungskraft
Wenn die Verheißungen der KI ins Stocken geraten sind, dann nicht, weil die Werkzeuge begrenzt sind, sondern weil unsere Führungskräfte begrenzt sind. Das größte Hindernis für den Fortschritt ist heute nicht die Rechenleistung, sondern die menschliche Vorstellungskraft.
Führungskräfte in Unternehmen sind durch jahrzehntelange Verhaltensweisen geprägt – eine risikoscheue, auf Regelkonformität ausgerichtete Kultur, die Vorhersehbarkeit über Möglichkeiten stellt. Das moderne Geschäftsumfeld belohnt Vorsicht: Jede Entscheidung muss durch Daten gerechtfertigt sein, jede Innovation durch Vorschriften abgesichert, jede Idee vorab von einem Ausschuss genehmigt und jede Initiative von kurzfristigen oder vierteljährlichen Ergebnissen bestimmt sein. Diese Risikokultur, die aus einer jahrzehntelangen gesellschaftlichen Entwicklung hervorgegangen ist und durch Finanzkrisen noch verstärkt wurde, hat eine Generation von Führungskräften hervorgebracht, die zwar zu managen, aber nicht zu führen wissen.
„Milliarden werden für Algorithmen ausgegeben, die als Werkzeuge konzipiert sind, um das zu replizieren, was Menschen bereits tun, anstatt sich vorzustellen, was Menschen anders machen könnten.“
Sie sprechen die Sprache der Innovation, fürchten jedoch deren Folgen. Sie fordern Veränderungen, klammern sich aber gleichzeitig an das Vertraute. Wenn KI Einzug hält, versuchen sie instinktiv – wie schon bei früheren disruptiven technologischen Veränderungen –, sie in bestehende Prozesse zu integrieren, so dass sie eher zu einem Werkzeug für Effizienz als für Innovation wird. Das Ergebnis ist vorhersehbar: Milliarden werden für Algorithmen ausgegeben, die als Werkzeuge konzipiert sind, um das zu replizieren, was Menschen bereits tun, anstatt sich vorzustellen, was Menschen anders machen könnten.
Senecas Warnung ist heute genauso zutreffend wie vor zwei Jahrtausenden: „Weil wir sie nicht wagen, sind die Dinge schwierig.“ Unsere Schwierigkeit ist nicht technologischer Natur, sondern liegt in einer Kultur der Grenzen begründet, die Unsicherheit mehr fürchtet als Möglichkeiten begehrt.
Führung und Willenskraft
Die essentielle Wahrheit bezüglich KI – die allzu oft durch den Hype verschleiert wird – ist, dass sie weder Willenskraft noch Handlungsfähigkeit besitzt. Sie kann keine Entscheidungen treffen. Sie kann nicht begehren. Welche Auswirkungen sie auch immer auf die Welt hat, sie sind das Ergebnis menschlicher Entscheidungen: Wer sie entwickelt, wer sie einsetzt und zu welchem Zweck. KI als autonomen Akteur zu behandeln bedeutet, die Verantwortung für diese Entscheidungen abzugeben.
Führung hingegen ist genau die Kunst der Entscheidung – der Festlegung einer Richtung inmitten von Unsicherheit. Sie erfordert den Mut, ohne Garantien zu handeln. Die Philosophin Hannah Arendt schrieb einmal, dass Handeln das Wunder ist, das die Welt vor dem Verderben rettet, weil es etwas Neues ins Leben ruft – etwas, das nicht vorhergesagt werden konnte und auch nicht vorhergesagt worden wäre. Führung ist die menschliche Fähigkeit, dieses Wunder bewusst zu vollbringen.
„Die Maschine führt uns nicht, sie füllt nur das Vakuum, das eigentlich durch Führung ausgefüllt werden sollte.“
Und doch hat die moderne Unternehmenswelt eine Kultur geschaffen, die solche Handlungen systematisch unterbindet. Risikokomitees, Compliance-Abteilungen und Ordnungsrahmen für „verantwortungsvolle KI“, insbesondere solche, die von den EU-Technokraten in Europa vorangetrieben werden, dienen alle dazu, Führungskräfte vor Unsicherheiten zu schützen und Entscheidungsprozesse in Kontrollsysteme zu überführen. Das Ergebnis ist, dass Autorität – die moralische Legitimität zum Handeln – durch Verfahren ersetzt wurde. Führung ist performativ geworden: eine Frage von Botschaften und Kennzahlen statt von Überzeugung und Mut.
Die KI-Lücke bringt diese Hohlheit nur ans Licht. Wenn Führungskräfte davon sprechen, „dem Algorithmus zu vertrauen“ oder „die Daten entscheiden zu lassen“, drücken sie damit nicht ihr Vertrauen in die Technologie aus, sondern gestehen ihre mangelnde Selbstsicherheit ein. Die Maschine führt uns nicht, sie füllt nur das Vakuum, das eigentlich durch Führung ausgefüllt werden sollte.
Die moralischen Grundlagen von Führung
Wahre Führung beginnt nicht mit Systemen, sondern mit Charakter. Churchill schrieb: „Mut gilt zurecht als die wichtigste menschliche Eigenschaft, denn […] [er] garantiert alle anderen.“ Mut ist kein Leichtsinn, sondern die Fähigkeit, inmitten von Unsicherheit richtig zu handeln. Er ist die Tugend, die Wissen in Handeln und Überzeugung in Realität verwandelt.
Aber Mut allein reicht nicht aus. Er muss durch moralische Integrität gemildert werden – die Bereitschaft, sich der eigenen Fehlbarkeit zu stellen. Die große Gefahr der Führung besteht darin, dass dieselbe Selbstüberzeugung, die Handeln ermöglicht, zu Dogmatismus werden kann, wenn sie nicht hinterfragt wird oder nicht mehr rechenschaftspflichtig ist. Der Mut zum Handeln muss immer mit der Ehrlichkeit einhergehen, Fehler zu machen und zuzugeben.
Diese moralische Spannung definiert jede herausragende Führung. Sie ist es, die Autorität von Macht und Vision von Hybris unterscheidet. Autorität kann, wie Arendt und später Frank Furedi beobachtet haben, nicht behauptet werden; sie ist immanent, vorhanden, anerkannt und akzeptiert. Sie entsteht, wenn diejenigen, die führen, mit einer Überzeugung handeln, der andere vertrauen können. Sobald Autorität geltend gemacht wird, ist sie bereits zusammengebrochen. In unserem technologischen Zeitalter besteht die Versuchung, diese moralische Last auf Maschinen auszulagern – sich hinter der Neutralität des Codes zu verstecken. Aber kein System kann Menschen von der Verantwortung für ihre Entscheidungen entbinden. Führung bleibt unveränderlich eine moralische Handlung.
Fehlender Mut
Das eigentliche Hindernis für eine KI-getriebene Transformation der menschlichen Arbeit ist daher nicht die Technologie selbst, sondern ein Mangel an Mut. Wir haben Kontrolle mit Kompetenz verwechselt, Sicherheit mit Weisheit. Die heutige Führungskultur ist geprägt von Angst statt von Ambitionen. Wir schulen Führungskräfte darin, Fehler zu vermeiden, anstatt nach Großem zu streben.
Deshalb fällt es der aktuellen Generation von Führungskräften schwer, KI als mehr als nur ein Produktivitätswerkzeug zu sehen. Generative KI wird trotz ihres Potenzials als Optimierungsmechanismus eingesetzt – um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und Routinearbeiten zu automatisieren. Selten wird sie als Katalysator für neue Denk-, Schaffens- oder Vorstellungsweisen genutzt.
„Das ist die Essenz von Führung. Sie beginnt mit der Bereitschaft, sich etwas vorzustellen – seiner eigenen Vision so weit zu vertrauen, dass man danach handelt.“
Im Gegensatz dazu steht der Ansatz von jemandem wie Steve Jobs, der bekanntermaßen datengestützte Entscheidungen ablehnte. Apple entwarf seine Produkte nicht, indem es Kunden fragte, was sie wollten, sondern indem das Unternehmen sich etwas ausdachte von dem die Kunden nicht wussten, dass sie es brauchten. Jobs' Genialität war nicht technologischer, sondern imaginativer Natur: Er vertraute seinem Instinkt und glaubte, dass andere, wenn man ihnen etwas wirklich Neues zeigte, diesem Instinkt ebenfalls vertrauen würden.
Das ist die Essenz von Führung. Sie beginnt mit der Bereitschaft, sich etwas vorzustellen – seiner eigenen Vision so weit zu vertrauen, dass man danach handelt. Die heutige Generation von Führungskräften, die von Fokusgruppen und „evidenzbasierten” Entscheidungen besessen ist, hat diese Fähigkeit weitgehend verloren. In ihren Händen wird KI zu einem Spiegel der Mittelmäßigkeit – einer Technologie, die dazu dient, den Status quo zu festigen, anstatt ihn zu überwinden.
Die Zukunft der Menschheit zurückerobern
Das Zeitalter der KI ist angebrochen, das Zeitalter der Führung jedoch noch nicht. Die Gefahr, der wir gegenüberstehen, besteht nicht darin, dass Maschinen uns ersetzen werden, sondern dass wir uns selbst ersetzen – indem wir unsere Vorstellungskraft, unseren Mut und unsere moralische Verantwortung an risikoscheue Manager und Systeme abgeben, die lediglich unsere Ängste widerspiegeln.
„Führung ist keine algorithmische Funktion, sondern eine menschliche Kunst.“
Marcus Collins hat Recht: Die Zukunft der Arbeit ist nicht technologisch, sondern kulturell. KI ist lediglich eine Erweiterung des menschlichen Verhaltens – ein Verstärker der Werte, die wir ihr vermitteln. Wenn unsere Führungskräfte und diejenigen, die die Macht haben, diese Systeme zu kontrollieren und einzusetzen, vorsichtig, fantasielos und selbstschutzorientiert sind, wird KI diese Eigenschaften vergrößern. Wenn sie mutig, visionär und menschlich sind, wird KI stattdessen diese Eigenschaften verstärken.
Und hier liegt ein potenzielles Paradoxon, das sich als Rettung für die KI erweisen könnte: die Weisheit der Massen. Die Tatsache, dass heute jeder mit KI-Systemen wie ChatGPT Computerprogramme erstellen kann, zeigt, dass gewöhnliche Menschen, sobald sie sich dieser Möglichkeiten bewusst werden, zu einer beispiellosen Quelle der Fantasie und Problemlösung werden. Die entscheidende Frage lautet daher – in Anlehnung an Präsident Kennedy – nicht, was die KI für mich tun kann, sondern was wir mit ihr tun können. Führung ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Entscheidung. Sie ist es, die der KI Bedeutung, Richtung und Zweck verleiht.
Führung im Zeitalter der KI bedeutet nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern sie zu verwirklichen. Sie bedeutet, dort zu wagen, wo andere zögern, über die Grenzen der Daten hinaus zu denken und ohne die Sicherheit der Gewissheit zu handeln. Führung ist keine algorithmische Funktion, sondern eine menschliche Kunst. Und wie jede Kunst beginnt sie mit Mut.