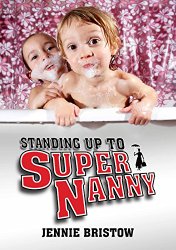01.04.2010
Laufpass für die Super-Nanny
Rezension von Ann Furedi
Jennie Bristows Buch Standing up to Supernanny erklärt und kritisiert die Flut der staatlichen Erziehungshilfen, mit denen ins Familienleben eingegriffen wird.
„Wir sind Erwachsene und keine Kinder, die man herumkommandiert. Wir sollten und müssen die Verantwortung für unsere Familien übernehmen – und Solidarität mit anderen Erwachsenen zeigen.“
Dieses Zitat aus dem Vorwort zu Jennie Bristows Buch Standing up to Supernanny fasst dessen Tenor gut zusammen. Das Buch ist ein Fanfarenstoß, mit dem Eltern aufgefordert werden, der Überzeugungskraft der Experten zu widerstehen, die uns glauben lassen, es gebe ein Erziehungsrezept, das zum perfekten Kind führe. Der „Tsunami“, der sich in Form von Erziehungsratschlägen auf junge Eltern ergießt, musste irgendwann eine Reaktion hervorrufen. Wie Bristow schreibt, gibt es unterdessen einige Mütter, die Autorinnen geworden sind, sowie Autorinnen, die Mütter geworden sind. Sie begegnen dem elterlichen Dampfkocher mit dem Ruf nach Rebellion. Klar, die „Super-Nanny“ wird nach wie vor von Millionen Fernsehzuschauern gesehen, die Bücherregale sind vollgestopft mit Ratgebern zur Kindererziehung, und die Zeitungen berichten über die Empfehlungen, die Regierungen oder andere offizielle Stellen zum Thema Familienleben hervorbringen. Man muss lange suchen, um eine Mutter oder einen Vater zu finden, der oder die sich nicht um die Sicherheit, die Ernährung, die schulischen Leistungen oder das allgemeine Wohlbefinden des eigenen Kindes Gedanken macht. Es war jedoch unvermeidlich, dass der misstrauisch-prüfende Blick auf das private Familienleben und der Druck, dem Eltern ausgesetzt sind, Unmut hervorrufen würde.
Genau so ist es gekommen – vor allem bei vielen Müttern aus der Mittelklasse. Sie glauben zwar, andere Menschen bräuchten Hilfe bei der Erziehung. Aber sie wehren sich gegen den überheblichen Ton der Experten, wenn sich diese an sie selbst richten. Nachdem ihnen die Ideologie verkauft wurde, jedes unangenehme Verhalten des Kindes sei das Resultat dysfunktionaler Elternschaft, mühen sie sich ab, ihre eigenen Schwierigkeiten beim Zubettbringen, Essen, Waschen usw. zu erklären. Ihnen wurde versprochen, dass die richtig durchgeführte Elternschaft stimulierend, spannend und lohnend sei. Umso mehr ihre Verwunderung und ihre Frustration, wenn sie merken, dass ein guter Teil des häuslichen Lebens aus stupider Eintönigkeit besteht.
Das Bild der unzufriedenen Mutter spiegelt sich im wachsenden Genre der „Neue-Mütter-Literatur“ wider. Diese Literaturform wehrt sich gegen den Glaubensgrundsatz der „perfekten Erziehung“ und zelebriert das dysfunktionale Chaos des normalen Familienlebens. Bei der Lektüre amüsieren wir uns über gestresste Mütter, die Kuchen aus dem Supermarkt verpacken, sodass er aussieht, als sei er selbst gebacken. Trotzdem vermag diese Art Lektüre nicht wirklich zu befriedigen, denn sie ist oberflächlich. Die Reaktionen vieler frustrierter Mütter sind rein reaktiv und bieten keine tiefen Einblicke.
Viele Autorinnen scheinen den wichtigen Punkt zu übersehen, dass der Druck, der auf Eltern lastet, eine „gute Mutter“ oder ein „guter Vater zu sein“, mehr beinhaltet, als sich für einen Lebensstil zu entscheiden. Sie erkennen nicht, welche Konsequenzen es hat, wenn man es zulässt, dass Behörden auf jegliche Art und Weise in unser Leben eindringen können. Ebenso wenig ist ihnen bewusst, dass es ernste Folgen für Eltern, Kinder und die Gesellschaft als Ganzes hat, wenn man sich nicht gegen die professionellen Diktate der Experten wehrt.
Die permanente und obsessive Beschäftigung mit den Themen Erziehung und Elternschaft macht uns introspektiv. Wir sind nur noch mit uns selber beschäftigt. Die Konsequenz ist, dass Eltern und Nicht-Eltern gegeneinander ausgespielt werden, weil man annimmt, ihre Werte müssten grundverschieden sein. Mütter und Väter werden von ihrer Familie entfremdet, indem die Spannungen, die zwangsläufig auftreten, wenn wir Kinder in unser Leben integrieren, übertrieben dargestellt werden. Es ist kein Zufall, wie Bristow feststellt, dass einer der lautesten Rufe der neuen Mütter der nach mehr „Zeit für sich selbst“ ist. Sie meinen damit Zeit zur Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse und Wünsche – losgelöst von den Anforderungen, die an uns als Partner, Mütter und Haushälter gestellt werden. Doch die Vorstellung, wir könnten nur wirklich wir selber sein, wenn wir allein und fernab von unseren elterlichen Pflichten sind, scheint zu bekräftigen, dass „ich“ wirklich nur „ich selbst“ sein kann, wenn ich meine sozialen Rollen nicht wahrnehmen muss. „Ich“ sein zu dürfen wird zu einer Flucht vor der Elternschaft, anstatt diese zu akzeptieren und als ein Teil des eigenen Seins anzunehmen.
Das Buch ist ebenso fesselnd wie viele Bücher der „Neue-Mütter-Bewegung“, aber es bringt uns weiter. Es konterkariert das gegenwärtige Bild von Eltern als Bösewichte oder Opfer, die den Rat und die Intervention der Experten benötigen, um die Familie zusammenzuhalten. Es zelebriert nicht unser vermeintliches Unvermögen (oder unsere Weigerung), uns anzupassen. Stattdessen zeigt Bristow, wie sowohl die neue Erziehungskultur als auch die hierzu entstandene Gegenbewegung Eltern von ihren Kindern entfremdet. Entfremdet hat sie uns auch von anderen Erwachsenen ohne Kinder und sogar von anderen Eltern. Sie hat zur Isolation und Fragmentierung des Familienlebens beigetragen.
Bristow bezieht sich auf eine Reihe von Beispielen aus der Politik und dem öffentlichen Leben, um zu zeigen, wie das Familienleben transformiert wurde: von einem Bereich, der einst vom öffentlichen Leben getrennt wurde und bei dem die Dynamik zwischen Eltern und Kindern noch als selbstverständlich galt, hin zu etwas, von dem man annimmt, es benötige Intervention und bewusste soziale Steuerung, damit es funktioniert. Kindererziehung muss zurückgefordert werden von denjenigen, die die Elternschaft professionalisieren wollen. Sie muss wieder als eine Beziehung etabliert werden, die auf spontaner Zuwendung und Autorität beruht, sagt Bristow. Der entscheidende Punkt ist, auf dem Schutz der Privatsphäre des Familienlebens zu bestehen. Dem Versuch des Staates, sich in das Familienleben hineinzudrängen, um damit die Erziehungsarbeit zu verbessern, muss eine Absage erteilt werden. Eltern sind nicht einfach nur Erziehungspartner des Staates beim Projekt der Kindererziehung. Vielmehr gehören unsere Familien uns. Sie können nur bestehen, wenn wir in ihnen leben, sie um uns herum aufbauen und uns um sie herum organisieren.
Elternschaft, räumt Bristow ein, ist eine generationelle und nicht einfach nur eine individuelle Verantwortung. Hierfür muss die Aufspaltung zwischen Eltern und Nicht-Eltern überwunden werden. Wir müssen erkennen, dass es über die elterliche Verantwortung hinaus eine Verantwortung gibt, die wir alle als Gemeinschaft haben.
Bristow hält fest, dass im Mittelpunkt der Politik und eines Großteils der Medienberichterstattung die Annahme steht, die meisten Familien seien „dysfunktional“, nicht in der Lage, ihre Aufgabe allein zu bewältigen, und müssten, bei allem, was sie mit ihren Kindern unternehmen, beraten werden. Doch, so ihre Schlussfolgerung, wir sind nicht gezwungen, uns wie Kinder aufzuführen, auch wenn die Erziehungskultur uns wie Kinder behandeln will. Wir können versuchen, unser Familienleben zu formen und die nächste Generation großzuziehen, wie wir es für richtig halten – unter Berücksichtigung der Werte, die uns nahe liegen.
Als Mütter brauchen wir nicht so sehr mehr „Ich-Zeit“, um wieder das zu sein, was wir vor unserer Mutterschaft waren, sondern wir brauchen mehr „Wir-Zeit“ mit denjenigen, denen wir vertrauen und auf die wir für Unterstützung, Rat und Zuspruch zurückgreifen können.